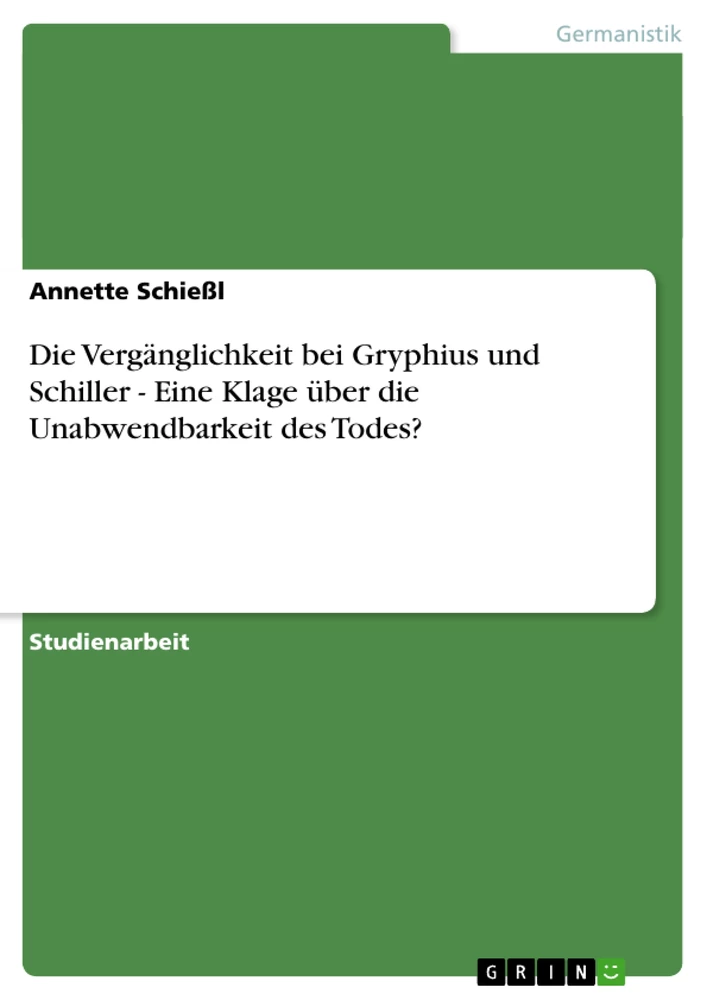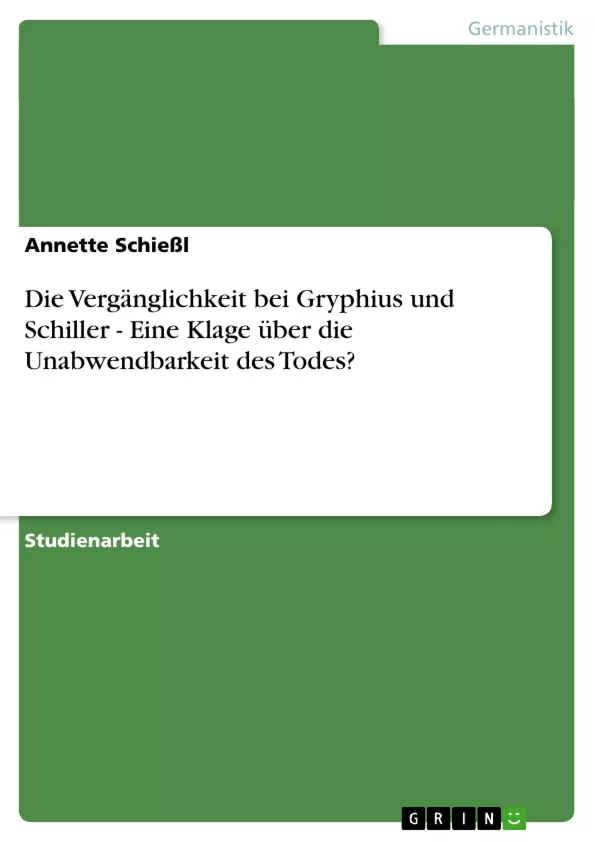The „idea of inconstancy [...] became an obsession with Gryph’s contemporaries to such an extent that it tended to become the rule in the seventeenth-century mind.” Diese Aussage bringt ganz genau auf den Punkt, welch große Bedeutung der Vanitas-Gedanke gerade in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges hatte, in dem Gryphius und seine Zeitgenossen mit Hunger, Seuchen und Pest zu kämpfen hatten. Aber auch Schiller, der im relativ abgelegenen, wohlbehüteten Weimar des 18. Jahrhunderts keineswegs mit solch existenziellen Nöten konfrontiert war, setzte sich mit diesem Thema noch über 150 Jahre später auseinander. Aus diesem Grund stehen sowohl Andreas Gryphius’ Gedicht „VANITAS, VANITATUM, ET OMNIA VANITAS. Es ist alles gãtz eytel“ als auch Schillers „Nänie“ unter dem Einfluss der Vergänglichkeits-Thematik, wobei allerdings schon des zeitlichen Abstandes wegen ein verschiedener Umgang mit der Problematik zu erwarten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Die Aufarbeitung der Vergänglichkeits-Thematik vor unterschiedlichem Hintergrund
- Parallele Darstellungsweisen in den beiden Gedichten
- Die Einhaltung formaler Kriterien von klassischen Formen
- Der geschlossene Aufbau in den beiden Gedichten
- Die Sonderrolle von „Es ist alles gãtz eytel“ und „Nänie“
- Unterschiede in der Gestaltung der Gedichte
- Die Aussage der Gedichte und Ansätze zur Intention von Gryphius und Schiller
- Die Epochenzugehörigkeit und die Sprache in den beiden Gedichten
- Besondere Kennzeichen von „Es ist alles gãtz eytel“ und „Nänie“
- Die Intertextualität in Gryphius Gedicht
- Schillers Bezug zur griechischen Antike und seine Vorstellung vom Schönheitsideal
- Abschließende Gedanken zur Trauer in den beiden Gedichten
- Die Auseinandersetzung mit dem Vanitas-Gedanken im Barock und der Aufklärung
- Der Einfluss der jeweiligen Epoche auf die künstlerische Gestaltung der Gedichte
- Formale Parallelen und Unterschiede in den Gedichten von Gryphius und Schiller
- Die Rolle von Intertextualität und antiken Referenzen in den Gedichten
- Die sprachliche Ausdrucksweise und die stilistischen Mittel der beiden Dichter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Vergänglichkeit in den Gedichten „Es ist alles gãtz eytel“ von Andreas Gryphius und „Nänie“ von Friedrich Schiller. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Dichter an dieses Thema vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Epochen und Lebensumstände. Es soll untersucht werden, inwiefern die Gedichte trotz unterschiedlicher Intentionen Gemeinsamkeiten in Form, Aufbau und Thematik aufweisen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Aufarbeitung der Vergänglichkeits-Thematik vor unterschiedlichem Hintergrund
Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Vergänglichkeitsthema im 17. und 18. Jahrhundert. Es wird erläutert, wie der Vanitas-Gedanke in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges bei Gryphius' Zeitgenossen präsent war, während Schiller im 18. Jahrhundert mit anderen Lebensbedingungen konfrontiert war. Trotz dieser Unterschiede beschäftigt sich auch Schiller mit der Vergänglichkeit, was zu verschiedenen Herangehensweisen und Interpretationen der Thematik führt.
2. Parallele Darstellungsweisen in den beiden Gedichten
Dieses Kapitel analysiert Gemeinsamkeiten in der Gestaltung der Gedichte „Es ist alles gãtz eytel“ und „Nänie“. Es werden formale Aspekte wie die Einhaltung klassischer Formen, der geschlossene Aufbau und die Sonderrolle der beiden Gedichte in ihren jeweiligen Sammlungen betrachtet. Es zeigt sich, dass beide Dichter strenge formale Strukturen nutzen und somit einen Bezug zu ihrer Epoche herstellen.
3. Unterschiede in der Gestaltung der Gedichte
Im dritten Kapitel werden die Unterschiede zwischen Gryphius' und Schillers Gedichten untersucht. Dabei wird auf die Aussage der Gedichte, die Intentionen der Dichter und die sprachlichen Besonderheiten fokussiert. Die Epochenzugehörigkeit und die jeweiligen sprachlichen Mittel werden im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Vergänglichkeit, Vanitas, Barock, Aufklärung, Andreas Gryphius, Friedrich Schiller, Sonett, Elegie, Intertextualität, formale Gestaltung, Epochenvergleich, sprachliche Analyse.
- Arbeit zitieren
- Annette Schießl (Autor:in), 2004, Die Vergänglichkeit bei Gryphius und Schiller - Eine Klage über die Unabwendbarkeit des Todes?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48938