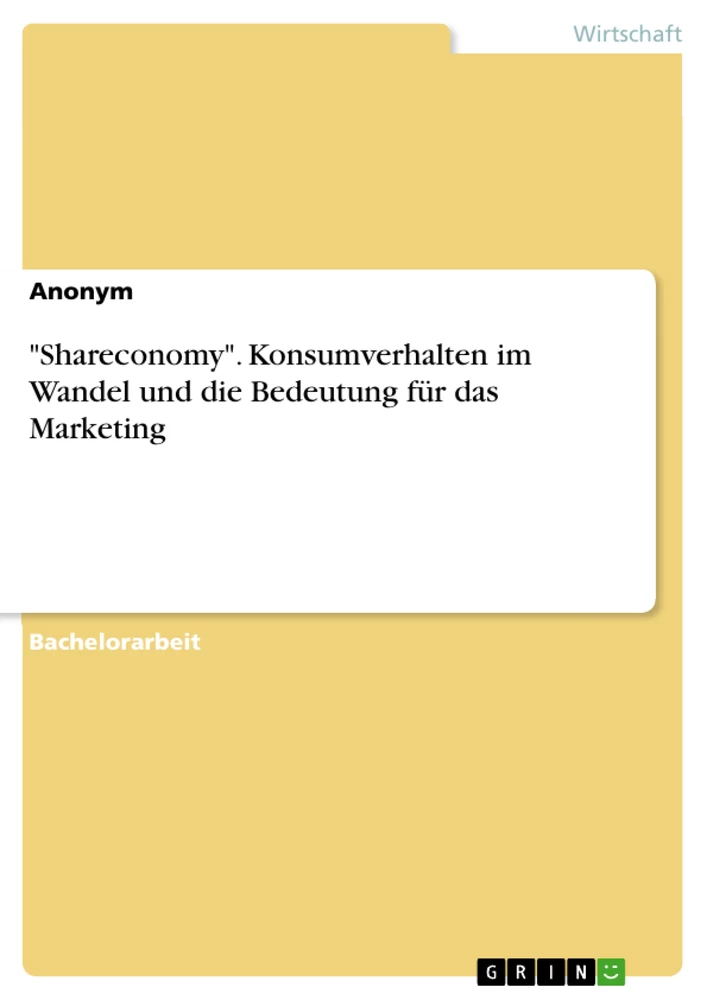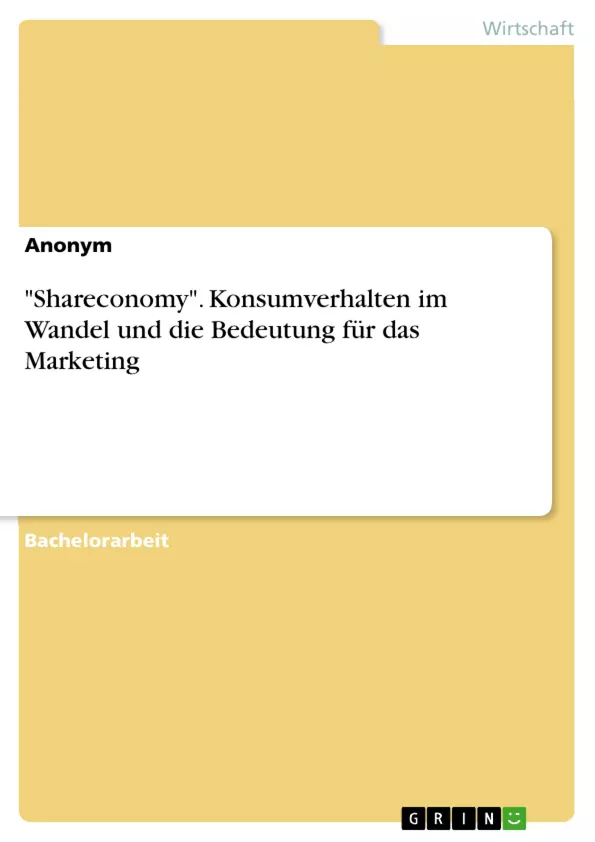Wie kam es zu den Veränderung in der Gesellschaft und zum derzeitigen Vormarsch der Share Economy? Welche Umweltbedingungen und welche Motive bewirken den Erfolg der neuen Konsumkultur und worin liegt dabei die Bedeutung für das Marketing? Mit der Beantwortung dieser Fragestellung befasst sich diese Arbeit.
Das Konsumverhalten und die Werteeinstellungen innerhalb der Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren verändert. Die eigene Lebensweise wird immer häufiger hinterfragt und Aspekte wie Nachhaltigkeit und Lebensqualität rücken in den Fokus der Menschen. In diesem Zusammenhang gewinnt die „Share Economy“ zunehmend an Bedeutung. Die Share Economy beruht auf dem Grundsatz zum gemeinschaftlichen Teilen, Tauschen und Leihen. Die Share Economy wird häufig als zusammengesetztes Wort „Shareconomy“ oder auch als „Sharing Economy“, „Collaborative Consumption“ oder „P2P Economy“ (Peer-to-Peer-Economy) bezeichnet. Sie geht ursprünglich auf Martin L. Weitzman mit dem Werk „The share economy: Conquering stagflation“ aus dem Jahr 1984 zurück.
Der amerikanische Ökonom sieht mit der Share Economy die Möglichkeit Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Stagflation aufzuhalten. Weltweit wurde im Dezember 2004 das erste Mal online bei Google nach dem Begriff Share Economy gesucht. Mittlerweile werden Autos, Wohnungen, Bücher, Kleidung, Schmuck und vieles mehr mithilfe von Online-Plattformen zur Verfügung gestellt, ausgeliehen und getauscht. Dies stellt Unternehmen und folglich auch das Marketing vor ungeahnte Herausforderungen, da weniger Produkte verkauft werden: Die Menschen wollen die Unternehmensmarke erleben, sich mit ihr verbunden fühlen und dies mit anderen teilen. Dafür müssen sie allerdings nicht mehr zwingend kaufen. Dies bewirkt einen Wandel in den Konsumgewohnheiten und fordert das Marketing zum Umdenken auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- Share Economy
- Der Weg zur Share Economy
- Merkmale der Ökonomie des Teilens
- Das Konsumverhalten
- Theoretische Grundlagen des Konsumverhaltens
- Psychische Faktoren
- Soziale Faktoren
- Persönliche Faktoren
- Das Konsumverhalten in der Share Economy
- Psychische, soziale und persönliche Faktoren in der Share Economy
- Sharing-Motive in den unterschiedlichen Share Economy Modellen
- Die Herausforderungen für das Marketing
- Herausforderungen durch die Umweltbedingungen
- Herausforderungen durch das Konsumverhalten
- Strategien für das Marketing in der Share Economy
- Branchenspezifische Strategien
- Branchenübergreifende Strategien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Share Economy und ihr Einfluss auf das Konsumverhalten. Dabei werden die Ursprünge und die Entwicklung der Share Economy beleuchtet, sowie ihre wichtigsten Merkmale und Ausprägungen dargestellt. Weiterhin werden die theoretischen Grundlagen des Konsumverhaltens betrachtet, um die Einflussfaktoren der Share Economy auf die Konsumentscheidungen zu verstehen. Ziel ist es, die Herausforderungen für das Marketing aufzuzeigen, die sich aus der veränderten Konsumkultur ergeben, und Handlungsempfehlungen für erfolgreiche Marketingstrategien in der Share Economy zu entwickeln.
- Die Entstehung und Entwicklung der Share Economy
- Die Merkmale und Ausprägungen der Share Economy
- Die Auswirkungen der Share Economy auf das Konsumverhalten
- Die Herausforderungen für das Marketing in der Share Economy
- Entwicklung und Analyse von Marketingstrategien für die Share Economy
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Share Economy ein und erläutert die Problemstellung, die die Arbeit behandelt. Sie beschreibt die Veränderungen im Konsumverhalten und die zunehmende Bedeutung der Share Economy. In Kapitel 2 wird die Share Economy genauer betrachtet, ihre Ursprünge und Anfänge erläutert, sowie ihre Merkmale und Ausprägungen dargestellt. Kapitel 3 behandelt die theoretischen Grundlagen des Konsumverhaltens, einschließlich der psychischen, sozialen und persönlichen Faktoren der Kaufentscheidung. Anschließend werden die verschiedenen Faktoren auf die Share Economy angewandt und analysiert, um die Motivation der Konsumenten für Sharing-Modelle zu verstehen. In Kapitel 4 werden die Herausforderungen für das Marketing betrachtet, die sich aus der Share Economy ergeben, sowohl durch veränderte Umweltbedingungen als auch durch das veränderte Konsumverhalten. Das Kapitel 5 präsentiert verschiedene Strategien für das Marketing in der Share Economy, sowohl branchenspezifische als auch branchenübergreifende Ansätze. Abschließend wird in Kapitel 6 ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Share Economy, dem Konsumverhalten, dem Marketing und den Herausforderungen, die sich aus der Veränderung des Konsumverhaltens in der Share Economy ergeben. Schlüsselbegriffe sind unter anderem „Sharing Economy", „Collaborative Consumption“, „P2P Economy", „Konsumverhalten", „Marketing", „Nachhaltigkeit", „Lebensqualität", „Motive", „Sharing-Modelle", „Strategien", „Umweltbedingungen", „Branchenspezifische Strategien", „Branchenübergreifende Strategien".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Share Economy“?
Die Share Economy (oder Sharing Economy) basiert auf dem gemeinschaftlichen Teilen, Tauschen und Leihen von Gütern statt des individuellen Besitzes.
Wer prägte den Begriff ursprünglich?
Der Begriff geht auf den amerikanischen Ökonomen Martin L. Weitzman und sein Werk aus dem Jahr 1984 zurück.
Welche Motive bewegen Menschen zum „Sharing“?
Zentrale Motive sind Nachhaltigkeit, Kostenersparnis, soziale Interaktion und eine gesteigerte Lebensqualität durch Zugang statt Besitz.
Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Marketing?
Da weniger Produkte verkauft werden, müssen Unternehmen Markenerlebnisse schaffen, die Verbundenheit fördern, auch wenn das Produkt nur geliehen wird.
Welche Faktoren beeinflussen das Konsumverhalten in der Share Economy?
Die Arbeit analysiert psychische, soziale und persönliche Faktoren, die den Wandel von der Kauf- zur Sharing-Kultur vorantreiben.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, "Shareconomy". Konsumverhalten im Wandel und die Bedeutung für das Marketing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489552