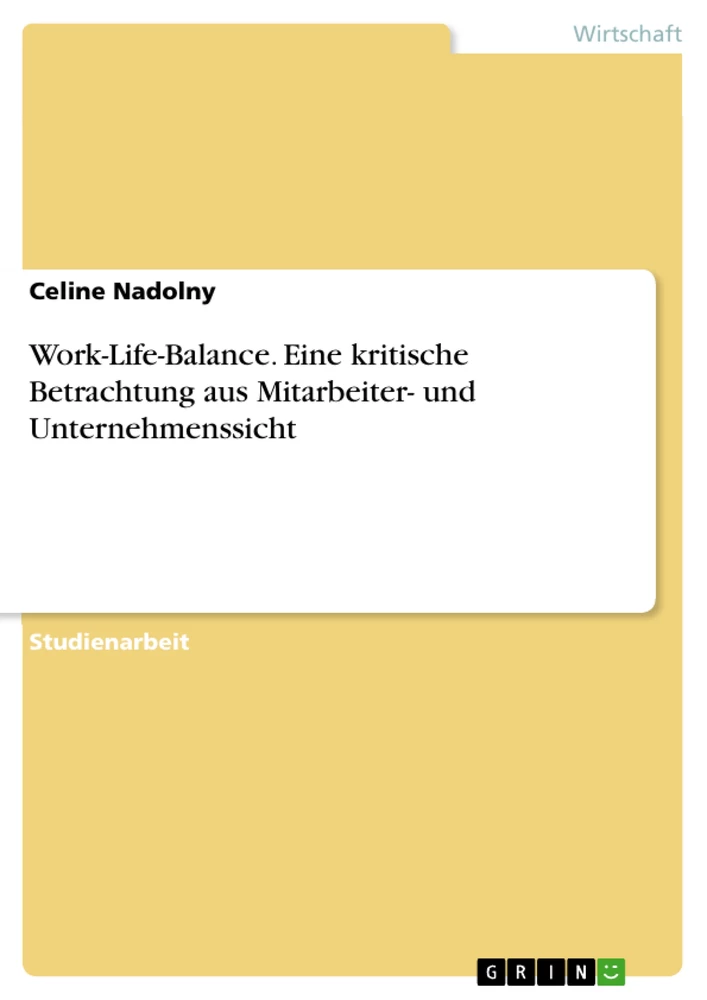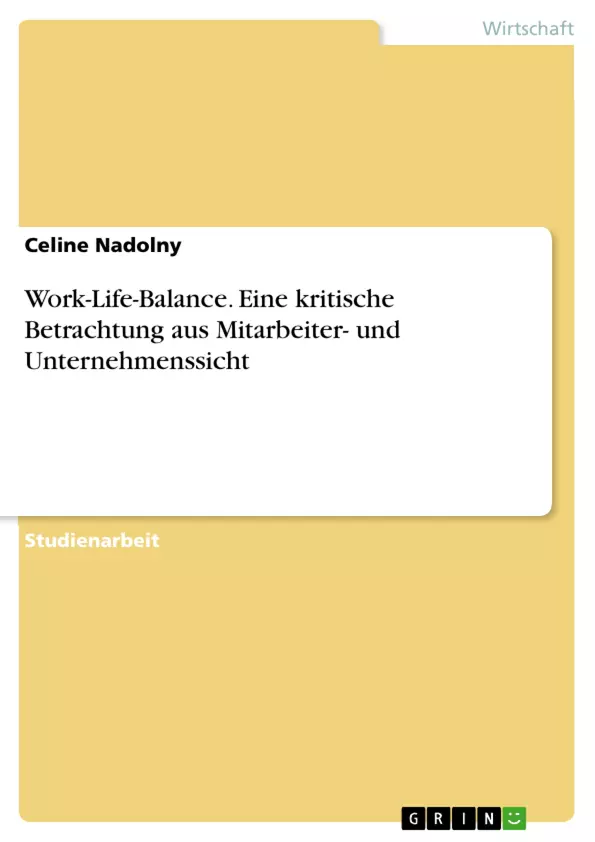Es gibt mittlerweile kaum noch ein größeres Unternehmen, das nicht in der einen oder anderen Form Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und des Privatlebens anbietet und damit auch mehr oder weniger explizit für sich wirbt. Aber woran liegt es dann, dass ein erheblicher Anteil der Erwerbstätigen über Probleme klagt und bei vielen Gesundheit oder private Bedürfnisse zu kurz kommen? Dies soll in dieser Arbeit ergründet werden, genauso wie die eventuellen Unterschiede zwischen mittleren und großen Unternehmen.
Work-Life-Balance hat innerhalb der letzten zehn Jahre in Literatur und Unternehmen an Präsenz gewonnen. Das weist auf ein bedeutsames gesellschaftliches Problem hin, das Spannungsfeld Familie und Beruf, das im Deutschen meist als „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ bezeichnet wird. Das Verständnis der Schnittstelle von Arbeit und Leben ist von entscheidender Bedeutung. Seine Ursprünge hat dies in verschiedenen sozialen Kontexten: die Berufstätigkeit von Frauen, veränderte Geschlechterrollen, der demografische Wandel, wechselhaftere Biografien und das Interesse von Unternehmen an flexiblen Arbeitskräften angesichts der Globalisierung.
Das Konzept umfasst über die wissenschaftliche hinaus auch eine normative Ebene (die Vorstellung eines gelungenen Lebens), eine Handlungsebene (die Harmonisierung der Lebensführung durch Handlungen und Lösungen) und eine Organisationsebene, die betrieblichen Praktiken und Maßnahmen sowie die Selbstdarstellung des Unternehmens. Das transnationale Konzept, das die Wechselbeziehungen zwischen Lebensbereichen untersucht, wird inzwischen auch von verschiedenen anderen Disziplinen aufgegriffen. Im Laufe der Jahre breitete sich die Forschungslandschaft dabei auf immer mehr wissenschaftliche Disziplinen aus. So wird Work-Life-Balance inzwischen nicht nur in seiner Theorie von Soziologen und Psychologen untersucht, sondern auch zunehmend praxisorientiert in der Politikwissenschaft, der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie in der BWL.
Quer durch alle Branchen zeigen sich gestiegene Belastungen, erhöhte Leistungsintensität infolge von verkürzten Innovationszyklen und verstärktem Kundendruck durch erhöhte Marktanforderungen. Die Adressaten vieler Ratgeber zum Thema Work-Life-Balance sind allerdings Individuen, die Beruf, Karriere, Kinder und eigene Bedürfnisse in ein für sie stimmiges Verhältnis bringen wollen. Unterstützung erhalten sie dabei zunehmend auch von Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Theoretische Ansätze
- 2.1 Work-Life-Balance Definition
- 2.2 Work-Life-Ideologien
- 2.3 Chancen und Risiken von Work-Life-Balance
- 2.3.1 Chancen und Risiken aus Unternehmenssicht
- 2.3.2 Chancen und Risiken aus Mitarbeitersicht
- 3. Praxisteil
- 3.1 Verständnis für Work-Life-Balance aus Mitarbeiter- und Unternehmenssicht
- 3.2 Erfahrungen mit Work-Life-Balance-Angeboten im eigenen Unternehmen aus Mitarbeiter- und Unternehmenssicht
- 3.3 Chancen und Risiken von Work-Life-Balance-Angeboten im eigenen Unternehmen aus Mitarbeiter- und Unternehmenssicht
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Work-Life-Balance und analysiert die Herausforderungen und Chancen aus der Sicht von Mitarbeitern und Unternehmen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für das Spannungsfeld zwischen beruflichen und privaten Lebensbereichen zu entwickeln und die Bedeutung von Work-Life-Balance-Strategien zu beleuchten.
- Definition und Entwicklung des Work-Life-Balance-Konzepts
- Theoretische Ansätze und Ideologien im Zusammenhang mit Work-Life-Balance
- Chancen und Risiken von Work-Life-Balance-Strategien für Mitarbeiter und Unternehmen
- Praktische Erfahrungen mit Work-Life-Balance-Angeboten in Unternehmen
- Bedeutung von Work-Life-Balance im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Work-Life-Balance und stellt die Problemstellung sowie die Vorgehensweise der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zum Thema Work-Life-Balance vorgestellt, darunter Definitionen, Ideologien und eine Analyse der Chancen und Risiken aus der Sicht von Mitarbeitern und Unternehmen. Der Praxisteil widmet sich den Erfahrungen mit Work-Life-Balance-Angeboten im eigenen Unternehmen. Dabei werden die Perspektiven von Mitarbeitern und Unternehmen betrachtet und Chancen sowie Risiken beleuchtet. Das Kapitel "Fazit" fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Relevanz von Work-Life-Balance-Strategien für die Zukunft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Kernbegriffen Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Lebensführung, Unternehmenskultur, Personalmanagement, Flexibilität, Chancen und Risiken, Mitarbeitermotivation, Arbeitszeitgestaltung und Mitarbeiterzufriedenheit. Die Betrachtung umfasst sowohl theoretische Ansätze als auch praktische Erfahrungen mit Work-Life-Balance-Angeboten in Unternehmen.
- Citation du texte
- Celine Nadolny (Auteur), 2019, Work-Life-Balance. Eine kritische Betrachtung aus Mitarbeiter- und Unternehmenssicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490032