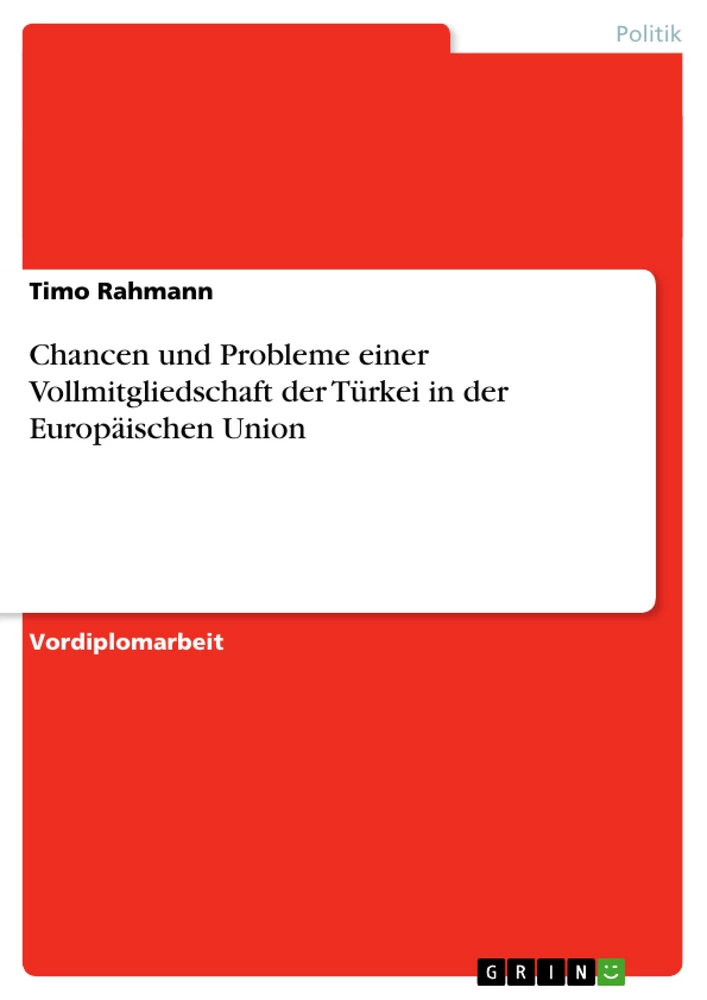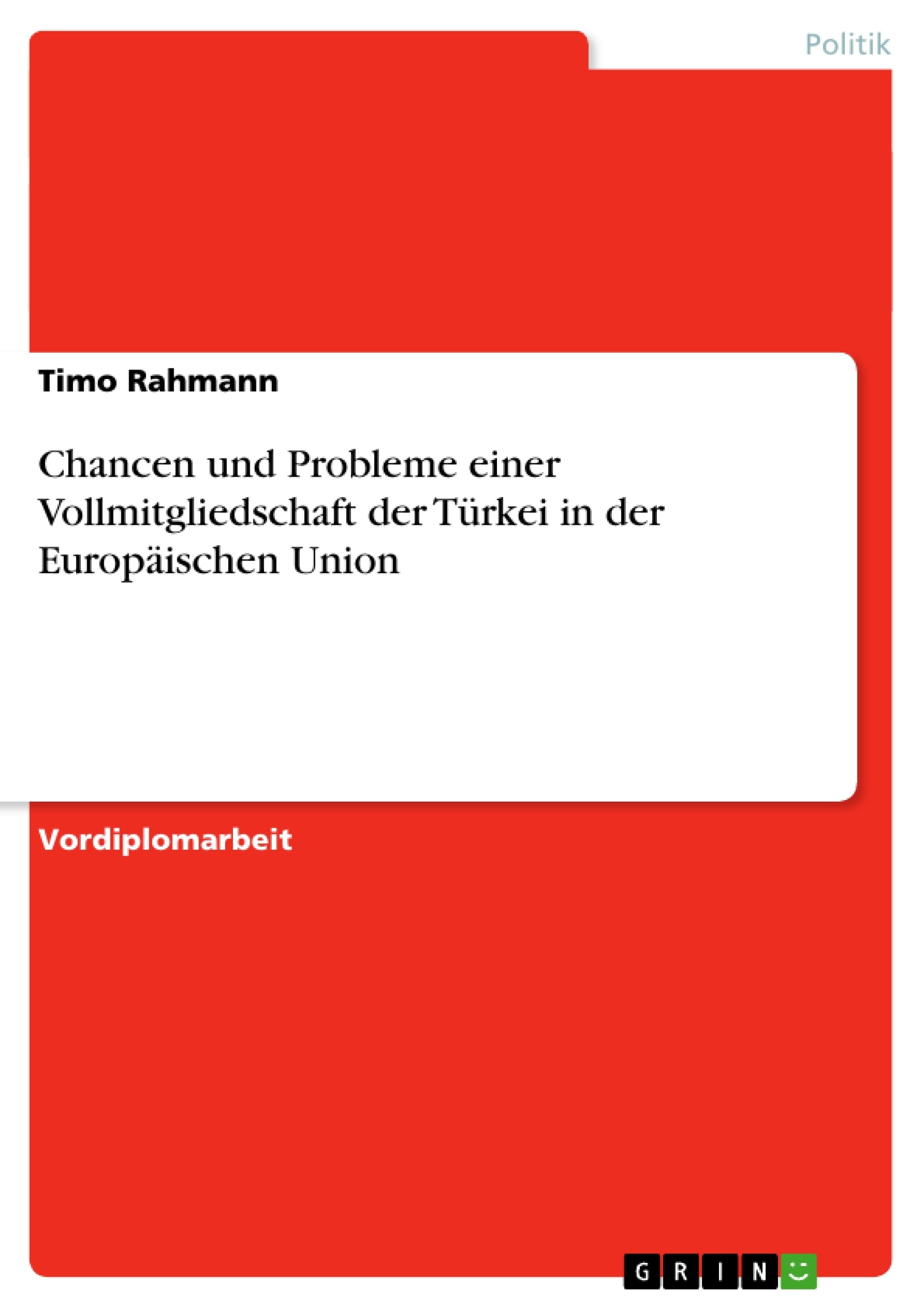Die Diskussion um eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union ist im letzten Jahr erneut entfacht worden und wurde mit großer Intensität geführt. Verschiedene Ereignisse, wie die vorgezogenen Neuwahlen in der Türkei, das Reformpaket der türkischen Regierung und die Entscheidung des Europäischen Rates auf seinem Gipfeltreffen in Kopenhagen haben diese Debatte immer wieder in den Fokus des öffentlichen wie wissenschaftlichen Interesses gebracht. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die EU vor großen Herausforderungen steht. Mit der Entscheidung von Kopenhagen im Dezember 2002 wird die Erweiterung um zehn neue Mitglieder im Jahr 2004 Realität und die Union hat sich so dem großen Ziel einer Erweiterung ohne nachlassende Integrationsfähigkeit verpflichtet. Die aktuellen Diskussionen um den Irak-Konflikt haben einerseits die Frage nach einer einheitlichen Position der EU in außenpolitischen Belangen neugestellt und andererseits das Spannungsfeld zwischen Europäischer Außenpolitik und transatlantischen Konstellationen abermals verdeutlicht, in welchem die Türkei seit langem steht. Die Türkei stellt unter den Beitrittskandidaten schon allein durch ihre Größe und ihre geopolitisch exponierte Lage eine Besonderheit dar. Hinzu kommt der Umstand, dass die Türkei einer der wenigen Staaten ist, bei denen prinzipielle Bedenken über die Vereinbarkeit von Werten und Traditionen mit denjenigen der EU-Majorität eine Rolle spielen. Der politische Teil der Kriterien steht im türkischen Kontext zumeist im Mittelpunkt. Die vorhandenen wirtschaftlichen Probleme des Beitritts wurden nicht mit vergleichbarer Leidenschaft diskutiert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den politischen Kriterien von Kopenhagen im türkischen Kontext. Es soll der Versuch unternommen werden, die Argumente für und wider einen Beitritt zu differenzieren und zu erläutern. Da den momentanen Debatten eine lange Geschichte der Beziehungen zwischen EU und Türkei zu Grunde liegt, soll diese in einem ersten Schritt geschildert werden, hierzu gehört, auch die Rolle
Deutschlands gesondert zu betrachten. Die Analyse verschiedener Bereiche des türkischen Staats soll in einem zweiten Schritt behandelt werden. Hierbei werde ich auf die politischen Institutionen, die Menschenrechte und die Minderheitenproblematik eingehen. In der Schlussbetrachtung möchte ich einige Argumente nochmals zur Sprache bringen und neue Fragen aufwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union seit dem Assoziationsabkommen von 1964
- Die Erwartungen und Interessen von Europäischer Union und Türkei
- Die Rolle Deutschlands in der Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei
- Die politischen Kriterien von Kopenhagen
- Der türkische Kontext
- Stabile politische Institutionen
- Menschenrechte und Minderheitenschutz
- Schlussbetrachtung
- Verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Chancen und Problemen einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Sie analysiert die politischen Kriterien von Kopenhagen im türkischen Kontext und beleuchtet die lange Geschichte der Beziehungen zwischen EU und Türkei, insbesondere die Rolle Deutschlands. Die Arbeit untersucht die politischen Institutionen, die Menschenrechte und die Minderheitenproblematik in der Türkei im Hinblick auf die Einhaltung der Kopenhagener Kriterien.
- Politische Kriterien von Kopenhagen
- Beziehungen zwischen der Türkei und der EU
- Rolle Deutschlands in der Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei
- Politische Institutionen in der Türkei
- Menschenrechte und Minderheiten in der Türkei
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei in der EU und stellt die zentralen Themen der Arbeit vor. Kapitel II. skizziert die Geschichte der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei seit dem Assoziationsabkommen von 1964. Kapitel III. beleuchtet die Erwartungen und Interessen beider Seiten an einer möglichen Mitgliedschaft. Kapitel IV. konzentriert sich auf die Rolle Deutschlands in der Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei. In Kapitel V. werden die politischen Kriterien von Kopenhagen im türkischen Kontext analysiert, einschließlich der politischen Institutionen, der Menschenrechte und der Minderheitenproblematik.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die politische Integration der Türkei in die Europäische Union, die Einhaltung der politischen Kriterien von Kopenhagen, die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei, die Rolle Deutschlands in der Debatte um die türkische Mitgliedschaft, die politischen Institutionen, die Menschenrechte und die Minderheitenproblematik in der Türkei.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kopenhagener Kriterien für einen EU-Beitritt?
Dazu gehören stabile politische Institutionen, die Wahrung der Menschenrechte, Minderheitenschutz sowie eine funktionierende Marktwirtschaft.
Warum ist der Beitritt der Türkei besonders umstritten?
Neben der geopolitischen Lage und Größe spielen Bedenken über die Vereinbarkeit von Werten und Traditionen sowie die Menschenrechtssituation eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielt Deutschland in der Debatte?
Deutschland hat aufgrund seiner engen historischen und sozialen Verflechtung mit der Türkei ein besonderes Interesse und nimmt eine einflussreiche Position in der EU-Debatte ein.
Was ist das Assoziationsabkommen von 1964?
Es legte den Grundstein für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und stellte der Türkei bereits früh eine spätere Mitgliedschaft in Aussicht.
Wie wird die Minderheitenproblematik in der Türkei bewertet?
Die Arbeit analysiert den Minderheitenschutz als Teil der politischen Kriterien, die für eine Vollmitgliedschaft zwingend erfüllt sein müssen.
- Quote paper
- Timo Rahmann (Author), 2003, Chancen und Probleme einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49089