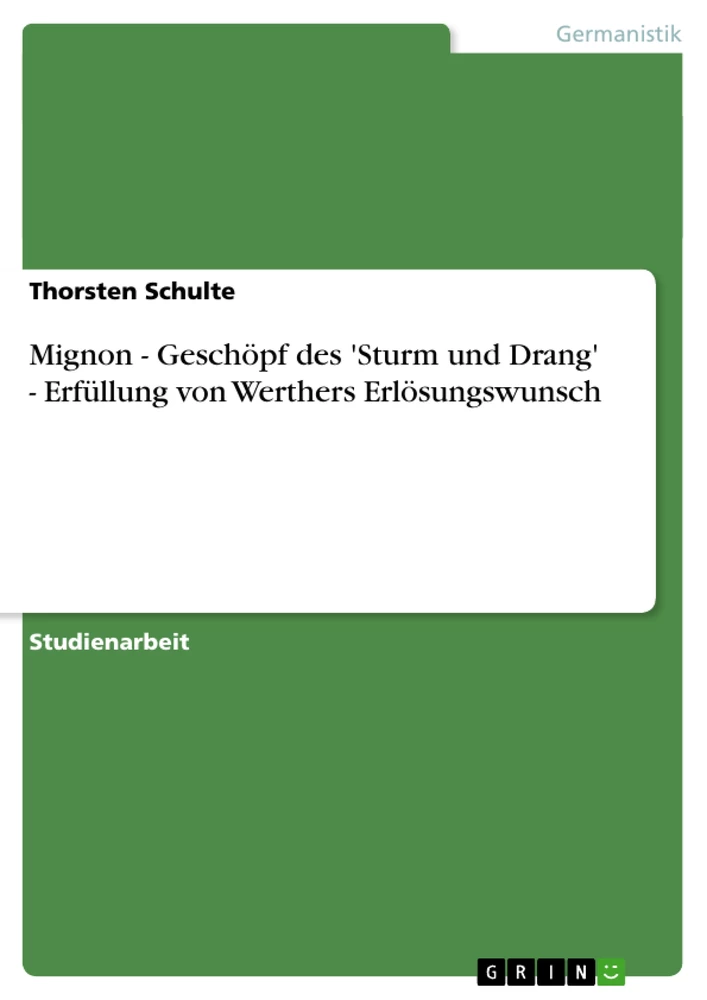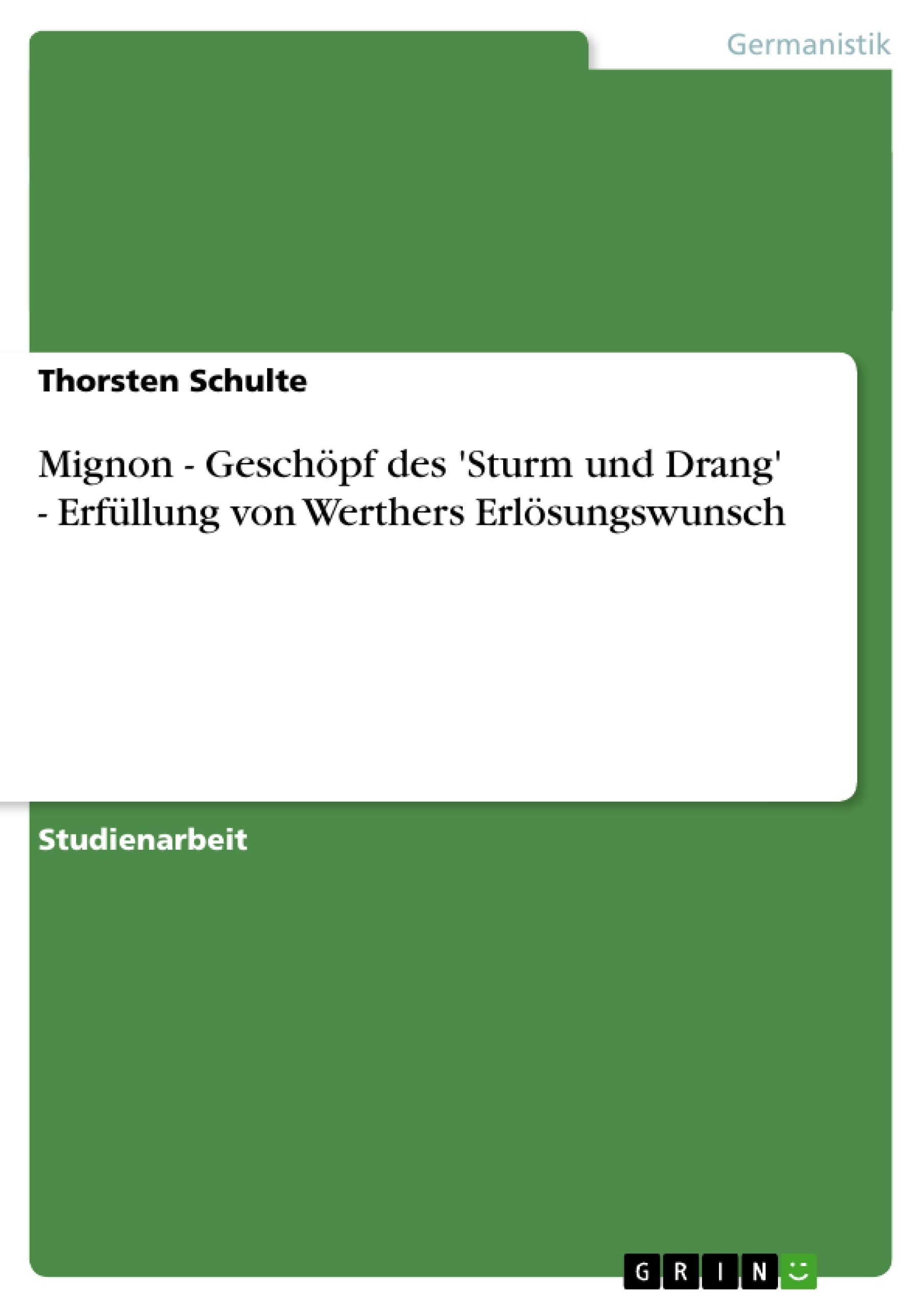Schiller schrieb am 28. Juni 1796 an Goethe: „Aus der Masse der Eindrücke, die ich empfangen, ragt mir in diesem Augenblick Mignons Bild am stärksten hervor. Ob die so stark interessierte Empfindung hier noch mehr fordert, als ihr gegeben worden, weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Es könnte auch zufällig sein, denn beim Aufschlagen des Manuscripts fiel mein Blick zuerst auf das Lied, und dieß bewegte mich so tief, daß ich den Eindruck nachher nicht mehr auslöschen konnte“1. Und am 23. Oktober 1796 ergänzte er: „Mignon wird wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweiten Lesen die tiefste Furche zurücklassen“2. Dieser Eindruck wurde von vielen zeitgenössischen und auch späteren Kritikern des „Wilhelm Meister“ geteilt.
Wie kann diese tiefe Furche in Worte gefasst werden? Worin liegt der Zauber, den Mignon auf Schiller und unzählige weitere Leser ausübte? Mignon wirbelt durch den Roman und ist tatsächlich schwer zu fassen. Dennoch ist es sicherlich möglich, sich über Attributzuschreibungen der Figur Mignon zu nähern und eine Interpretation auf die wesentlichen Eigenschaften der Mignon zu stützen. Nach der Attributzuschreibung wird sich die Möglichkeit ergeben, Mignon als Symbol des „Sturm und Drang“ zu deuten, bzw. in ihr nicht nur wichtige romantische Wesenszüge zu erkennen - wie es bereits viele Interpreten behaupteten -, sondern sie eindeutig als Relikt des „Sturm und Drang“ zu sehen. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass eine solche Analyse in einer langen Tradition steht. Über Mignon ist viel geschrieben worden, und die Interpretationen der letzten einhundert Jahre könnten unterschiedlicher kaum sein. Viele widmeten sich einzelnen Merkmalen der Mignon und konnten für das Ganze wenig bewirken. Die vorliegende Arbeit nimmt stets auf die lange Tradition der Mignon-Forschung Bezug, die für die Zielsetzung dieser Arbeit interessanten Aspekte der verschiedenen Aufsätze und Bücher werden zusammengetragen und der hier zu Grunde liegenden Fragestellung zugeordnet.
Zum Schluss soll die Frage beantwortet werden, ob Mignon als Teil des „Sturm und Drang“ in den „Lehrjahren“ direkten Bezug auf die „Leiden des jungen Werther“ nimmt. Die Frage ist, ob Mignon die Werther-Thematik nicht nur aufnimmt, sondern sie sogar weiterentwickelt. Die These ist, dass in Mignon der Erlösungswunsch von Werther noch einmal Gestalt annimmt. An Mignon erfüllt sich, was für Werther Verheißung bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mignon das geheimnisvolle Wesen
- Mignon – Attributzuschreibung
- Hermaphroditismus
- Animalisierung
- Zitherspiel und Gesang
- Epiphanie und Liebesreligion
- Mignon Symbol einer unüberwindbaren Lebensstufe
- Leidenschaft ohne Ende
- Mignon – Geschöpf des `Sturm und Drang'
- Das Herz als bestimmende Instanz
- Erfüllung von Werthers Erlösungswunsch
- Abschied von der Naturpoesie
- Résumé
- Sigelliste
- Literatur
- Internet
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Figur der Mignon in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Ziel ist es, die charakteristischen Eigenschaften Mignons zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext des „Sturm und Drang“ zu beleuchten. Dabei wird besonders auf die Frage eingegangen, ob Mignon als Weiterentwicklung der Werther-Thematik verstanden werden kann.
- Mignons geheimnisvolles Wesen und ihre Attributzuschreibungen
- Mignon als Symbol einer unüberwindbaren Lebensstufe und die Rolle der Leidenschaft
- Die Verbindung von Mignon zum „Sturm und Drang“ und ihre Rolle als „Geschöpf“ dieser Epoche
- Mignons Beziehung zur Werther-Thematik und die mögliche Erfüllung von Werthers Erlösungswunsch
- Die Entwicklung von Naturpoesie im Werk Goethes und ihre Bedeutung für Mignons Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die große Rezeption der Figur der Mignon in der Literaturkritik und stellt die Forschungsfrage nach dem Zauber und der tiefgreifenden Wirkung Mignons auf die Leser dar. Kapitel 2 führt in das geheimnisvolle Wesen Mignons ein und beschreibt ihren Hintergrund sowie ihre charakteristischen Merkmale. Kapitel 3 analysiert verschiedene Attributzuschreibungen der Figur, unter anderem den Hermaphroditismus, die Animalisierung und die Verbindung von Zitherspiel und Gesang. Kapitel 4 betrachtet Mignon als Symbol einer unüberwindbaren Lebensstufe, die von einer unerbittlichen Leidenschaft geprägt ist.
Das 5. Kapitel untersucht Mignon als „Geschöpf des „Sturm und Drang“ und betrachtet ihre Beziehung zu den Ideen dieser Epoche. In diesem Zusammenhang wird die Rolle des Herzens als bestimmende Instanz, die Erfüllung von Werthers Erlösungswunsch und der Abschied von der Naturpoesie beleuchtet.
Schlüsselwörter
Mignon, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, „Sturm und Drang“, Werther-Thematik, Erlösungswunsch, Naturpoesie, Attributzuschreibung, Hermaphroditismus, Animalisierung, Zitherspiel, Gesang, Symbol, Lebensstufe, Leidenschaft.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Schulte (Autor:in), 2004, Mignon - Geschöpf des 'Sturm und Drang' - Erfüllung von Werthers Erlösungswunsch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49102