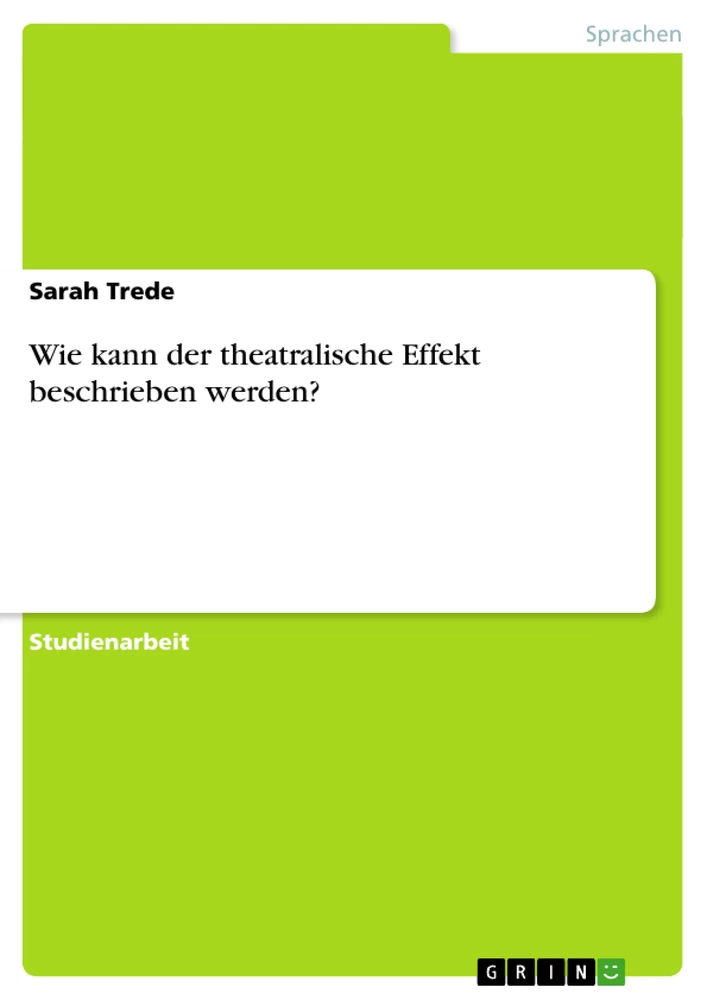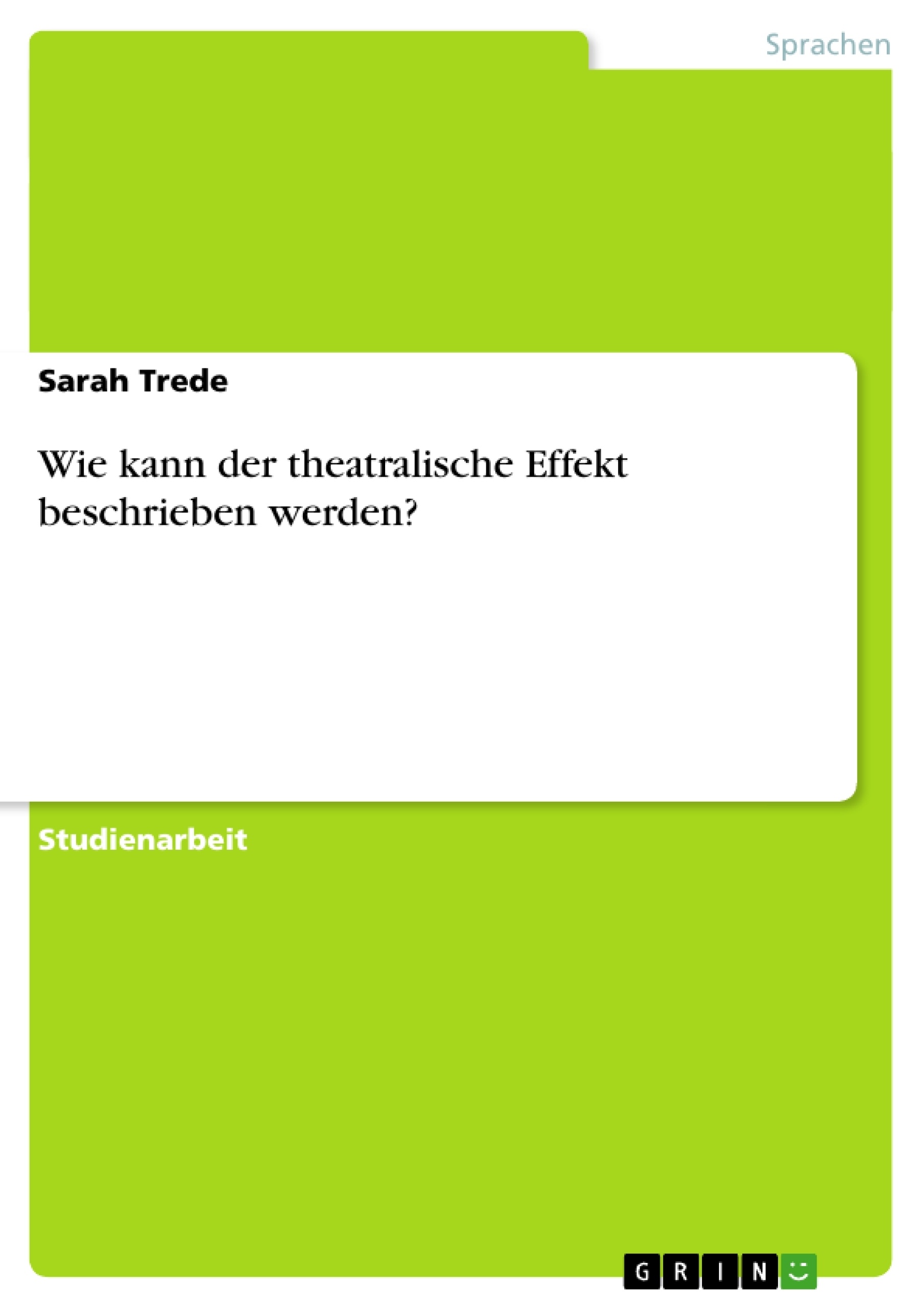Die Begriffe „Theater“ und „theatralisch“ sind zwar allgemein geläufig und werden vor allem im umgangssprachlichen Wortgebrauch häufig, aber eher im negativierenden Wortsinne von ‚affektiert’ und ‚gekünstelt’ verwendet, bei der Beschäftigung mit der Literatur zu meinem Referatsthema (Theaterwissenschaftliche Basistheorien: „Das Theater, Das Theatralische“) ist mir aber aufgefallen, dass es auch in der wissenschaftlichen, das Theater betreffenden, Literatur kaum konkrete Aussagen zum inhaltlichen Gehalt dieser Termini gibt, also was genau im „Gesamtkonstrukt Theater“ nun den Ausdruck „das Theatralische“ ausmacht und damit auch das Thema der Theaterwissenschaft konstituiert, weshalb dieser auch immer wieder eine gewisse Inhaltslosigkeit vorgeworfen wurde und wird.
Verschiedene Aussagen und Textstellen, die Fragen zum allgemeinen Konzept des Theaters, zu seinem konstituierenden Element aufwerfen, sind mir besonders aufgefallen. Auf zwei von diesen will ich im folgenden detaillierter eingehen, um dadurch dem abstrakten Gesamtkonstrukt „Theater“ und dem Begriff des „theatralischen“ darin näher zu kommen.
Die erste Aussage zum Theater, hier speziell in seinem Teilbegriff der Aufführung, stammt von Aristoteles, er sagt in seiner Poetik am Ende des 6. Kapitels:
„Die Inszenierung vermag zwar die Zuschauer zu ergreifen; sie ist jedoch das Kunstloseste und hat am wenigsten etwas mit der Dichtkunst zu tun. Denn die Wirkung der Tragödie kommt auch ohne Aufführung und Schauspieler zustande. Außerdem ist für die Verwirklichung der Inszenierung die Kunst des Kostümbildners wichtiger als die der Dichter.“
Das Theater wird von Aristoteles also eindeutig abwertend beurteilt, während er das Drama, wie er davor betont, sehr hochstellt. Seine Einstellung zum Verhältnis von Drama und Theater wird von Vielen, die nach ihm kommen, geteilt und besitzt teilweise bis heute ihre Gültigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der dramatische Text als theatrale Ausgangsbasis
- Was macht „die Theaterhandlung“ und was „die theatralische Handlung aus?
- Die Minimalforderung
- Die theatralische Wirkung des Raums
- Die Relevanz von Schauspieler und Zuschauer für den theatralischen Effekt
- Zusammenfassende Überlegungen zum theatralischen Effekt und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Konzept des „theatralischen Effekts“ und untersucht, was genau diesen Effekt im Kontext von Theater ausmacht. Dabei wird auf die Beziehung zwischen Drama und Theater eingegangen und diskutiert, wie die theatralische Umsetzung eines dramatischen Textes zu verstehen ist.
- Die Abwertung des Theaters im Verhältnis zum Drama und die damit verbundene Frage der „Werktreue“
- Die minimalistische Theaterdefinition nach Peter Brook und die Frage nach den zusätzlichen Mitteln, die zur Theaterhandlung beitragen
- Die Vielfältigkeit des Begriffs „Theater“ und seine Bedeutung in der deutschen Sprache
- Die Rolle des Schauspielers und des Zuschauers im theatralischen Prozess
- Die Transformation des Dramentextes in eine Theaterpartitur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Wesen des „theatralischen Effekts“ dar. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen der hohen Wertschätzung des Dramas und der Abwertung der theatralischen Inszenierung, die sich durch die Geschichte zieht.
Kapitel 2 analysiert das Verhältnis zwischen Drama und Theater und diskutiert die Frage der „Werktreue“ im Prozess der theatralischen Umsetzung. Die Schwierigkeit, einen Dramentext unverändert auf die Bühne zu übertragen, wird erläutert, und es wird die Rolle von Dramaturg und Regisseur als „Zweitoratoren“ in diesem Prozess hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: theatralischer Effekt, Drama, Theater, Theaterhandlung, theatralische Handlung, Werktreue, Theaterpartitur, Dramaturgie, Inszenierung, Schauspieler, Zuschauer, Raum, Minimalforderung, gesellschaftliche und kulturelle Stellung, persuasiv.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "theatralische Effekt"?
Es handelt sich um das spezifische Element, das eine Aufführung von einem rein gelesenen dramatischen Text unterscheidet und die Wirkung auf den Zuschauer konstituiert.
Wie beurteilte Aristoteles die Inszenierung?
Aristoteles bewertete die Inszenierung eher abwertend als "kunstlos" und sah die Wirkung der Tragödie primär in der Dichtkunst (dem Drama) begründet.
Was ist die Minimalforderung nach Peter Brook?
Peter Brook definiert Theater minimal als einen leeren Raum, durch den ein Mensch geht, während ihm ein anderer zusieht.
Was bedeutet "Werktreue" im Theater?
Werktreue bezeichnet den Versuch, einen dramatischen Text möglichst unverändert auf die Bühne zu bringen, was jedoch aufgrund der Transformation in eine Theaterpartitur oft schwierig ist.
Welche Rolle spielt der Zuschauer für den theatralischen Effekt?
Der Zuschauer ist essenziell, da der theatralische Effekt erst durch die Interaktion und Wahrnehmung im Raum zwischen Schauspieler und Publikum entsteht.
- Arbeit zitieren
- Sarah Trede (Autor:in), 2005, Wie kann der theatralische Effekt beschrieben werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49106