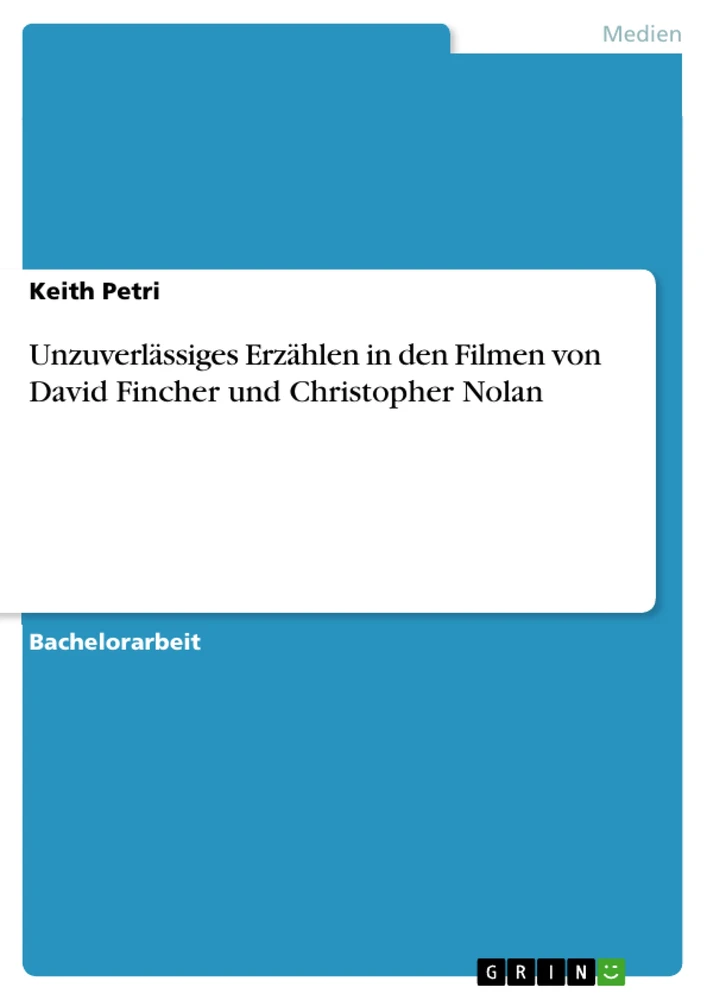Das Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der unzuverlässigen Erzählstile anhand der Regisseure David Fincher und Christopher Nolan.
Wer kennt nicht dieses trügerische Gefühl: Man beginnt einen vermeintlich alltäglichen Film anzuschauen, welcher mit den Genreerwartungen des jeweiligen Zuschauers übereinzustimmen scheint. Doch dann geschieht es. Das Unerwartete. Eine Wendung, die die Umdeutung der bisherigen gesehenen Ereignisse erfordert. Dies ist eine der vielen Varianten des unzuverlässigen Erzählens, welches in der folgenden Arbeit in Bezug auf die Filme David Finchers und Christopher Nolans analysiert wird.
Das Thema des unzuverlässigen Erzählens ist keine Erfindung des Medium Films, sondern wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in der Literatur geprägt. Die erstmalige Definition des Begriffs erfolgte durch Wayne Booth in The Rhetoric of Fiction Anfang der 60er Jahre. Aus der Literatur wurde dieser Erzählstil analog auf den Film übertragen. Das unzuverlässige Erzählen erlangte in den letzten 25 Jahren im US-amerikanischen und westeuropäischen Film immensen Wachstum und kann daher nicht nur als eine Modeerscheinung gesehen werden, weswegen dies sowohl für Laien als auch für Filmwissenschaftler einen besonderen Stellenwert einnimmt. Eine regelrechte Begriffsvielfalt ist bezüglich des unzuverlässigen Erzählens im Film seit geraumer Zeit vorhanden. Begriffe wie Mind-Bender, Postmodernes Erzählen, Puzzle Films, Falsche Fährten, Kino der Lüge, Plot Twist u.v.m. werden oftmals als Synonym oder Äquivalenz gesehen, da es an einer exakten wissenschaftlichen Begriffstrennung mangelt. Daher verwende ich einige Autoren für ein theoretisches Grundgerüst, welches ich für meine Analyse bezüglich des unzuverlässigen Erzählens bei David Fincher und Christopher Nolan heranziehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Unzuverlässiges Erzählen im Film
- Abgrenzung der Begriffe: Plot Point und (Final-) Plot Twist
- Bestimmung eines Protagonisten und Antagonisten
- Die unzuverlässigen Erzählstile von Fincher und Nolan
- David Fincher
- Ausweglosigkeit der Protagonisten
- Informationsexzess
- Das unzuverlässige Erzählen bei Nolan
- Ambivalenz der Protagonisten und Antagonisten
- Informationsdefizit
- David Fincher
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das unzuverlässige Erzählen in den Filmen von David Fincher und Christopher Nolan. Dabei werden die Besonderheiten ihrer Erzähltechniken, die zur bewussten Täuschung der Zuschauer eingesetzt werden, untersucht und verglichen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Strategien des unzuverlässigen Erzählens aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie in den jeweiligen Filmen eingesetzt werden, um die Interpretation des Zuschauers zu beeinflussen.
- Unzuverlässiges Erzählen im Film
- Analyse der spezifischen Erzähltechniken von Fincher und Nolan
- Vergleich der Strategien des unzuverlässigen Erzählens bei beiden Regisseuren
- Der Einfluss des unzuverlässigen Erzählens auf die Interpretation des Zuschauers
- Die Rolle von Informationsexzess und Informationsdefizit im unzuverlässigen Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik des unzuverlässigen Erzählens im Film einführt und die Besonderheiten des Erzählens bei Fincher und Nolan hervorhebt. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen des unzuverlässigen Erzählens im Film dargelegt. Dazu gehören die Abgrenzung von Begriffen wie Plot Point, Plot Twist und Final Plot Twist sowie die Bestimmung von Protagonist und Antagonist. Der Hauptteil der Arbeit analysiert die unzuverlässigen Erzähltechniken von Fincher und Nolan. Bei Fincher werden die Ausweglosigkeit der Protagonisten und der Informationsexzess als zentrale Elemente des unzuverlässigen Erzählens beleuchtet. Bei Nolan liegt der Fokus auf der Ambivalenz der Protagonisten und Antagonisten sowie dem Informationsdefizit, das er in seinen Filmen bewusst einsetzt. Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse in einem Fazit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Unzuverlässiges Erzählen, David Fincher, Christopher Nolan, Plot Twist, Informationsexzess, Informationsdefizit, Ambivalenz, Ausweglosigkeit, Film, Analyse, Vergleich, Genre, Interpretation, Zuschauer, Täuschung, Erwartungshaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter unzuverlässigem Erzählen im Film?
Es beschreibt eine Erzählweise, bei der der Zuschauer bewusst getäuscht wird, sodass sich am Ende herausstellt, dass die gezeigten Ereignisse anders abgelaufen sind als dargestellt.
Wie unterscheidet sich der Stil von David Fincher und Christopher Nolan?
Fincher nutzt oft einen "Informationsexzess" und thematisiert die Ausweglosigkeit seiner Figuren. Nolan hingegen arbeitet häufig mit einem "Informationsdefizit" und zeitlichen Verschachtelungen.
Was ist ein Plot Twist?
Ein Plot Twist ist eine überraschende Wendung in der Handlung, die eine Umdeutung der bisher gesehenen Ereignisse erfordert.
Woher stammt der Begriff des unzuverlässigen Erzählens?
Der Begriff wurde ursprünglich in der Literaturwissenschaft geprägt, insbesondere durch Wayne Booth in seinem Werk "The Rhetoric of Fiction" Anfang der 60er Jahre.
Warum sind "Puzzle Films" heute so populär?
Diese Filme fordern den Zuschauer aktiv heraus, mitzudenken und die Wahrheit hinter den Bildern selbst zu entschlüsseln, was über das bloße Konsumieren hinausgeht.
Was ist die Rolle von Ambivalenz bei Nolans Charakteren?
Nolan lässt oft offen, wer Protagonist und wer Antagonist ist, was das Gefühl der Unzuverlässigkeit verstärkt und den Zuschauer im Unklaren lässt.
- Quote paper
- Keith Petri (Author), 2017, Unzuverlässiges Erzählen in den Filmen von David Fincher und Christopher Nolan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491174