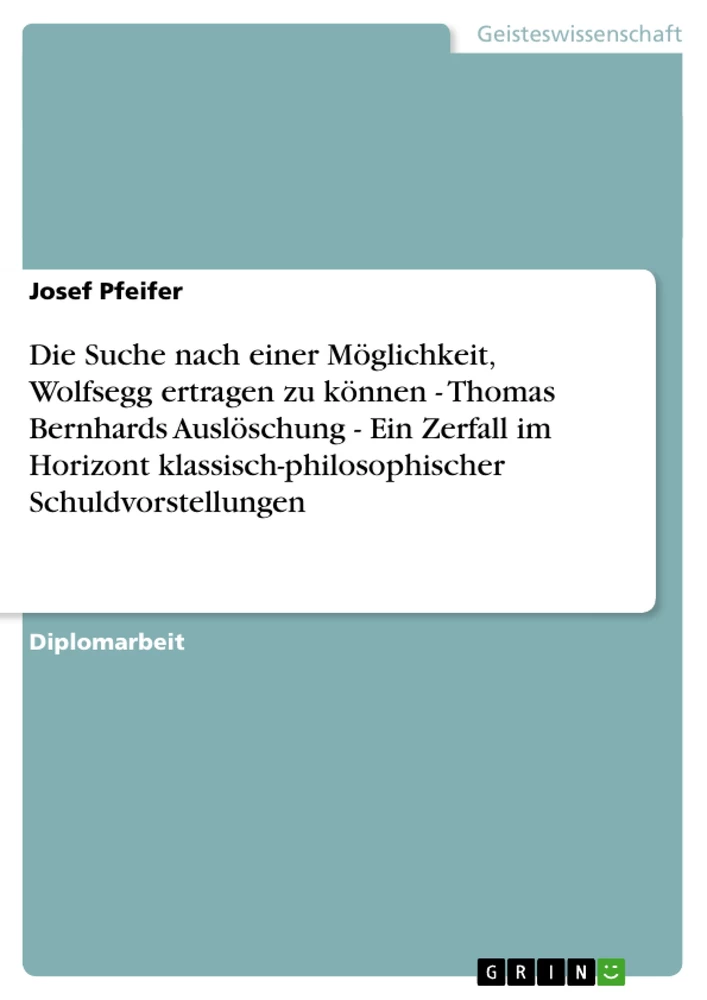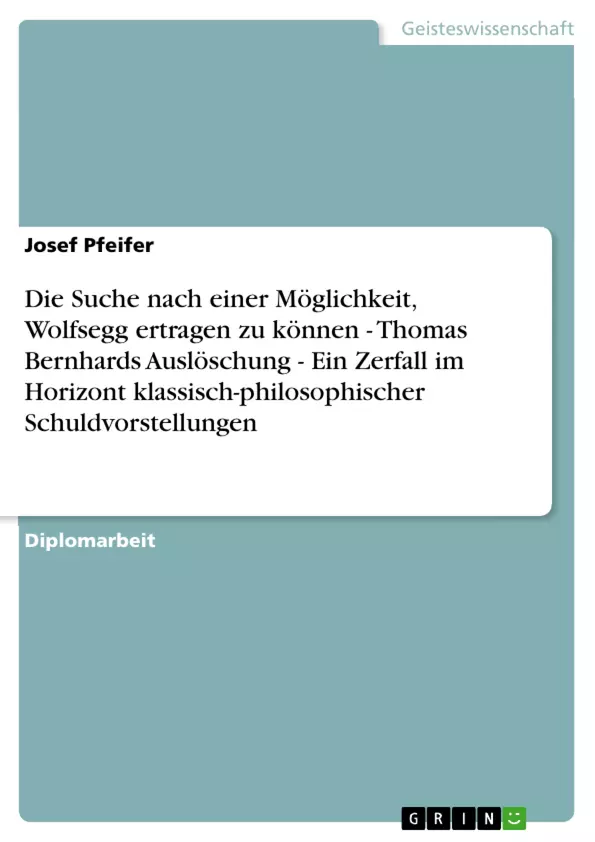EINLEITUNG
Ein prunkvolles Schloß mit schönen Nebengebäuden, unter denen eine Orangerie und eine sogenannte Kindervilla als besonders gelungene Gebäude zusätzlich noch herausragen. An jedem Detail dieses Bauwerks bemerkt man die große Behutsamkeit und den unglaublichen Kunstverstand, mit dem jede Kleinigkeit angefertigt wurde, so daß man hier ohne zu übertreiben von einem steinernen Zeugen einer glanzvollen Epoche sprechen kann. Dies zeigt sich gleich beim Eintritt ins Hauptgebäude: hier müßte wohl auch ein weitgereister Besucher lange nachdenken, ob er wohl jemals ein schöneres Vorhaus zu Gesicht bekommen hat, daß trotz aller Kunstfertigkeit die absolute Strenge herrschaftlicher Größe ausstrahlt. Auch die sonstigen Gebäude wirken in ihrer vornehmen Pracht ehrfurchtgebie-tend auf den Betrachter. Zum Schloß gehören ferner noch ein riesiger Grundbesitz, Wälder, Ländereien und Jagden; zudem bietet es dem Besucher einen der schönsten Aussichtspunkte des Landes, und wird andererseits durch einen dichten Hochwald vor den neugierigen Blicken derer, die es nicht sehen sollen, geschützt.
Der Eigentümer dieser beschriebenen Anlage müßte sich doch eigentlich sehr glücklich schätzen. Daß dies nicht a priori gegeben sein muß, zeigt die Geschichte des Franz-Josef Murau, der durch einen tragischen Unglücksfall unvermutet zum Alleinerben dieser riesigen Besitzung wird. Er empfindet dieses Erbe aber weniger als Glücksfall, denn als Anlaß zu Angst und Sorge, ja sogar als Bedrohung. Denn Wolfsegg, so der Name dieses Schlosses steht nicht nur für die oben beschriebene Pracht, sondern auch für etwas, das Murau seinen "Herkunftskomplex" (AL 201) nennt. Gemeint ist damit seine leidvolle Kindheit und Jugend in eben diesem Prunkbau, geprägt einer geistfeindlichen familiären Umgebung, die im Nationalsozialismus ihr einziges Ideal neben dem Katholizismus sah, und kein Verständnis für ihren kunstsinnigen Nachkommen entwickelte. Murau wäre wohl daran zerbrochen, hätten nicht die - allzu seltenen - Besuche seines geliebten Onkels Georg, sowie der Rückzug in eine der fünf Wolfsegger Bibliotheken - eigentlich sind es ja sechs - zeitweilige Fluchten aus dem tristen Alltag ermöglicht.
Wenn Murau über Wolfsegg spricht, so geschieht dies fast ausnahmslos in anklagender Form, wobei das Verhalten seiner Familie während der NS-Zeit ein bevorzugtes Ziel seiner Angriffe sind.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ERSTER TEIL: SCHULD - EIN HISTORISCH-SYSTEMATISCHER ÜBERBLICK
- 1. Begriffsklärung.
- 2. Typologien von Schuld in ihrer historischen Entwicklung...
- 2.1. Der magische Schuldbegriff.
- 2.2. Der mythische Schuldbegriff.
- 2.2.1. Exkurs: Mythische Schuldbegründung in der griechischen Tragödie.
- 2.2.2. Platon und Aristoteles......
- 2.3. Der rationale Schuldbegriff ......
- 3. Die Sicht des Menschen im Kontext der Typologien von Schuld…..\n
- 4. Systematische Konzeptionen von Schuld
- 4.1. Augustinus…......
- 4.2. Kant
- 4.3. Existenzphilosophie.
- 4.3.1. Kierkegaard
- 4.3.2. Jaspers….......
- 4.3.3. Heidegger..\n
- 4.3.4. Sartre.........
- ZWEITER TEIL: SCHULD IN \"WOLFSEGG\"
- 1. Hinführung .......
- 2. Vom \"Ursprung alles Bösen\" - \"Wolfsegg” im Spiegel von historisch-\nsystematischen Schuldtypologien.........
- 3. \"Die Meinigen abschaffen\" - Muraus Schuldgefühle.\n
- 4. Schuldbefreiung.
- 4.1. Martin Buber - \"Existentialschuld\" und \"personhaft gewordenes\nGewissen\"..\n
- 4.2. Arthur Schopenhauer - \"Verneinung des Willens zum Leben\"\n
- 5. Schuld und Erinnerung.....
- 5.1. Das vergessene Massengrab.......
- 5.2. Der \"Italiener\" - ein Gast als erfolgloser Therapeut.\n
- 5.3. Die \"Selbstauslöschung\".
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie die Schuld des Protagonisten Franz-Josef Murau im Kontext eines klassisch-philosophischen Schuldbegriffs zu verstehen ist. Sie analysiert Muraus Bemühungen, sich von seinem Herkunftskomplex zu lösen, und hinterfragt, inwieweit diese erfolgreich sind.
- Entwicklung des Schuldbegriffs in der klassischen abendländischen Philosophie
- Analyse der Schuldtypologien in Thomas Bernhards Roman "Auslöschung"
- Die Rolle von Erinnerung und Vergebung in der Bewältigung von Schuld
- Existenzphilosophische Konzepte der Schuld und ihre Relevanz für Muraus Situation
- Die Frage der Selbstauslöschung als mögliche Form der Befreiung von Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil der Arbeit liefert einen historischen und systematischen Überblick über den Schuldbegriff. Die Entwicklung des Schuldverständnisses wird von archaischen Konzepten über mythische Schuldbegründungen bis hin zu rationalen Konzeptionen in der klassischen Philosophie beleuchtet. Verschiedene Denker wie Zarathustra, Homer, Hesiod, Platon, Aristoteles, Augustinus, Kant, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger und Sartre werden in diesem Kontext analysiert.
- Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der Schuld in Thomas Bernhards Roman "Auslöschung" und deren Interpretation im Spiegel der im ersten Teil dargestellten Schuldtypologien. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Protagonisten Franz-Josef Murau und seinen Schuldgefühlen im Zusammenhang mit seiner Familiengeschichte und der NS-Vergangenheit Wolfseggs gewidmet.
- In diesem Zusammenhang werden die Ansätze von Martin Buber und Arthur Schopenhauer hinsichtlich Schuld und Vergebung in Bezug auf Muraus Situation analysiert. Zudem wird die Rolle der Erinnerung und des vergessenen Massengrabs in Wolfsegg im Kontext von Schuld und Vergangenheitsbewältigung untersucht.
Schlüsselwörter
Schuld, Schuldbegriff, Thomas Bernhard, "Auslöschung", Wolfsegg, Franz-Josef Murau, NS-Vergangenheit, Familiengeschichte, Erinnerung, Vergebung, Existenzphilosophie, Martin Buber, Arthur Schopenhauer, Selbstauslöschung, Herkunftskomplex
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Thomas Bernhards Roman „Auslöschung“?
Der Roman handelt von Franz-Josef Murau, der nach dem Tod seiner Familie das Schloss Wolfsegg erbt. Er versucht, sich durch das Schreiben von seinem belastenden „Herkunftskomplex“ und der NS-Vergangenheit seiner Familie zu befreien.
Wie wird Schuld in der Arbeit definiert?
Die Arbeit gibt einen Überblick über historische Schuldtypologien, vom magischen und mythischen Schuldbegriff der Antike bis hin zu rationalen und existenzphilosophischen Konzepten (z.B. bei Heidegger oder Sartre).
Was versteht Murau unter seinem „Herkunftskomplex“?
Damit meint er seine leidvolle Kindheit in einer geistfeindlichen, nationalsozialistisch und katholisch geprägten Umgebung, die kein Verständnis für seine Kunstsinnigkeit hatte.
Was bedeutet „Selbstauslöschung“ in diesem Kontext?
Es ist der Versuch des Protagonisten, Wolfsegg und seine eigene Herkunft durch den Akt des Niederschreibens geistig zu vernichten, um eine Befreiung von der Schuld zu erreichen.
Welche Rolle spielt Martin Buber in der Analyse?
Bubers Konzepte der „Existentialschuld“ und des „personhaft gewordenen Gewissens“ werden herangezogen, um Muraus individuelle Schuldgefühle und seine Suche nach Vergebung zu untersuchen.
- Citar trabajo
- Josef Pfeifer (Autor), 2001, Die Suche nach einer Möglichkeit, Wolfsegg ertragen zu können - Thomas Bernhards Auslöschung - Ein Zerfall im Horizont klassisch-philosophischer Schuldvorstellungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4913