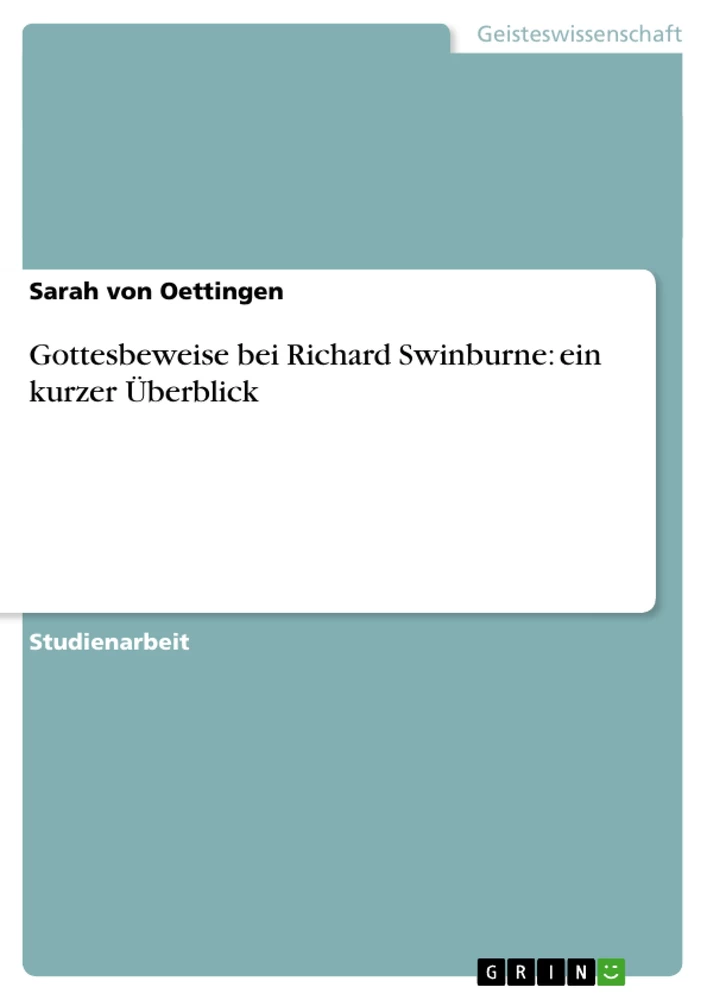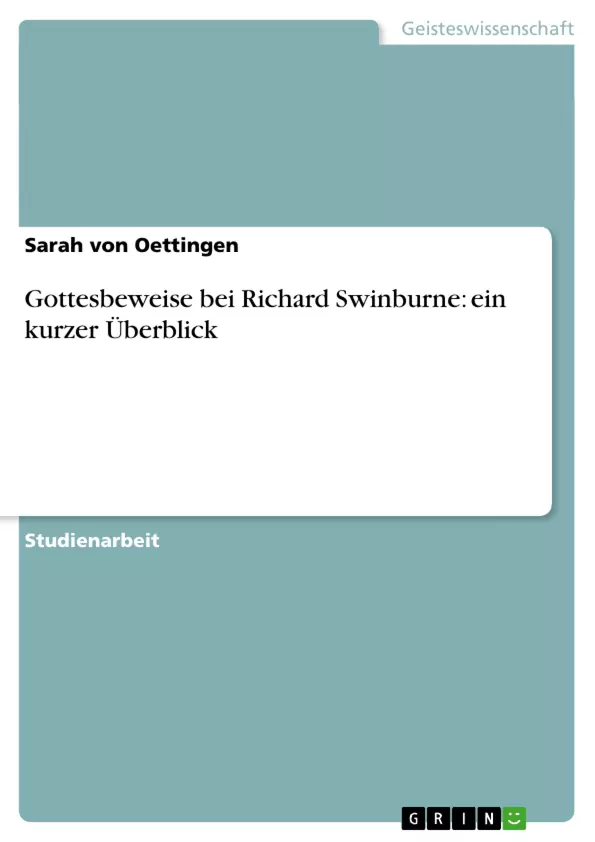I. Einführung in Leben und Werk:
I.1. Biographische Notiz:
Richard Swinburne wurde 1934 in England geboren.
Er erwarb das Diplom des M. A. und B. Phil. für Philosophie und ein Diplom in Theologie in Oxford. Anschließend war er Research Fellow für Wissenschaftsgeschichte und - philosophie an den Universitäten Oxford und Leeds. Von 1963 bis 1972 war er Dozent für Philosophie an der Universität Hull, von 1972 bis 1984 lehrte er als Professor für Philosophie an der Universität Keele. Seit 1985 ist er als Professor für Christliche Theologie an der Universität Oxford tätig.
Swinburne gilt als einer der Hauptvertreter der Analytischen Religionsphilosophie, die versucht, indem sie religiöse Aussagen und deren Bedeutungen untersucht, das Problem des religiösen Glaubens und der Rationalität religiösen Glaubens zu bearbeiten.
Unter zahlreichen Veröffentlichungen sind besonders folgende Werke Swinburnes zu nennen :
The Concept of Miracle (London 1971), The Coherence of Theism (Oxford 1977), The Existence of God (Oxford 1979), Faith and Reason (Oxford 1981 ; zs. mit S. Shoemaker).
Im Folgenden werde ich mich mit einem Ausschnitt aus dem Werk ,,Die Existenz Gottes" von Richard Swinburne beschäftigen. Zunächst werde ich die Grundlage der Argumentation Swinburnes darstellen, um mich anschließend mit seinem kosmologischen und teleologischen Argument zu befassen.
In seinem Werk setzt sich Swinburne mit der Frage nach der Existenz Gottes auseinander. Seiner Argumentation liegt die Annahme zugrunde, daß sich ,,aufgrund rationaler Argumente einigermaßen gut begründete Ergebnisse (bezüglich der Frage nach der Existenz Gottes) erzielen" ließen, d.h. daß die Vernunft wahrscheinliche, nicht aber zweifelsfreie Aussagen über die Existenz Gottes machen könne. In diesem Sinne ist es nicht Swinburnes Anliegen, die Existenz Gottes zu beweisen, sondern es geht ihm vielmehr darum, den schon vorhandenen Glauben rational und plausibel zu machen. In der ,,religiösen Praxis (bleibe somit) ein weiter Raum für den Glauben" bestehen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung in Leben und Werk
- I.1. Biographische Notiz
- II. Grundlage der Argumentation
- III. Das kosmologische Argument
- IV. Das teleologische Argument
- IV.1. Das teleologische Argument durch zeitliche Ordnung
- IV.2. Das teleologische Argument durch Analogieschluss
- V. Abwägen der Wahrscheinlichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In diesem Werk befasst sich Richard Swinburne mit der Frage nach der Existenz Gottes. Seine Argumentation basiert auf der Annahme, dass sich durch rationale Argumente wahrscheinlichkeitsbasierte Erkenntnisse über die Existenz Gottes erzielen lassen. Ziel ist es nicht, Gottes Existenz zu beweisen, sondern den bestehenden Glauben rational und plausibel zu machen.
- Analyse der rationalen Argumentation für Gottes Existenz
- Untersuchung des kosmologischen Arguments
- Bewertung des teleologischen Arguments
- Abwägung der Wahrscheinlichkeit von Gottes Existenz
- Untersuchung der Rolle von Naturgesetzen und Ordnung im Universum
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung in Leben und Werk
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Richard Swinburnes Leben und Werk. Es beleuchtet seine akademische Laufbahn und seine bedeutenden Veröffentlichungen, insbesondere das Werk „Die Existenz Gottes“, auf das sich der Text konzentriert.
II. Grundlage der Argumentation
Swinburne legt die Grundlage seiner Argumentation dar, indem er die Annahme einführt, dass keine zweifelsfreien Aussagen über die Existenz Gottes möglich sind. Stattdessen geht es um die Wahrscheinlichkeit von Argumenten für oder gegen Gottes Existenz. Swinburne unterscheidet dabei zwischen deduktiven und induktiven Argumenten und analysiert deren unterschiedliche Beweisstärke.
III. Das kosmologische Argument
Dieses Kapitel befasst sich mit dem kosmologischen Argument, das aus der Existenz des komplexen physischen Universums die Existenz eines Gottes folgert. Swinburne verteidigt die Berechtigung des Forschens nach dem Ursprung der Welt und untersucht die verschiedenen Erklärungen für die Existenz des Universums. Er stellt fest, dass das kosmologische Argument ein induktives Argument ist, das die Existenz Gottes wahrscheinlicher erscheinen lässt als ihre Abwesenheit.
IV. Das teleologische Argument
Das teleologische Argument, das in diesem Kapitel behandelt wird, bezieht sich auf die Ordnung und Regelmäßigkeit des Universums. Swinburne untersucht sowohl das teleologische Argument der zeitlichen Ordnung als auch das Argument durch Analogieschluss. Er widerlegt Einwände gegen die Objektivität der Ordnung im Universum und argumentiert, dass die Naturwissenschaft diese Ordnung nicht erklären kann. Somit lässt die zeitliche Ordnung auf eine handelnde Person, nämlich Gott, schließen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieses Textes sind: Existenz Gottes, rationale Argumentation, kosmologisches Argument, teleologisches Argument, deduktive und induktive Argumente, Ordnung im Universum, Naturgesetze, Wahrscheinlichkeit, Beweisstärke, C-induktives Argument, personale Erklärung.
- Quote paper
- Sarah von Oettingen (Author), 2001, Gottesbeweise bei Richard Swinburne: ein kurzer Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4914