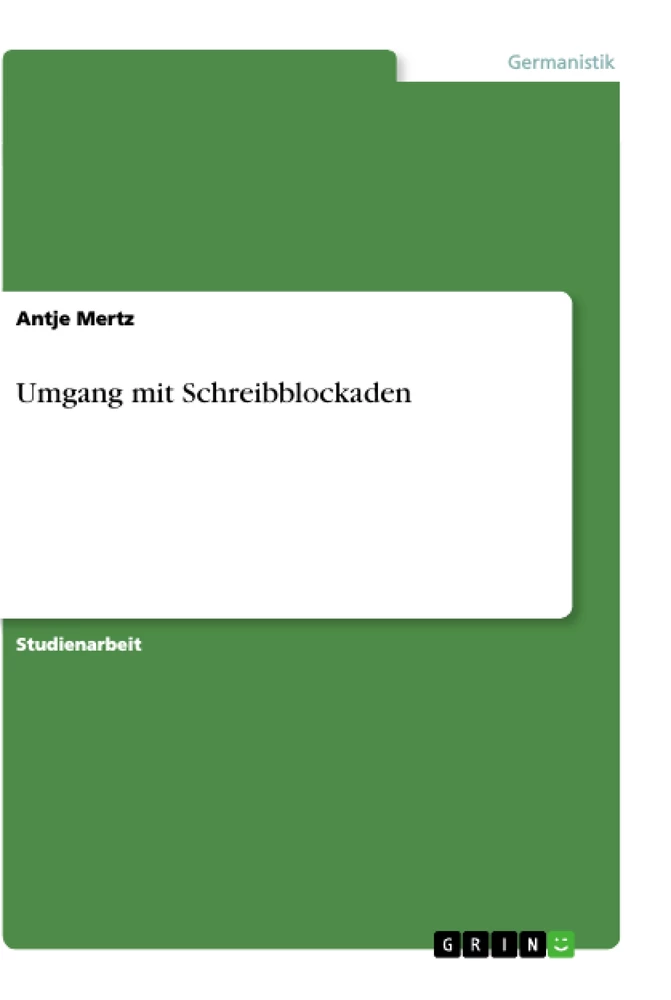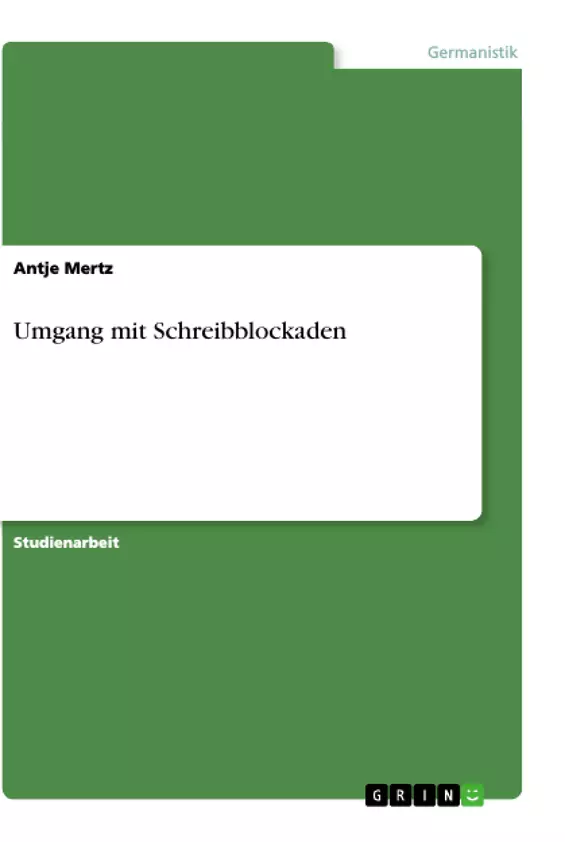Aus der griechischen Mythologie sind uns neun Musen bekannt. Sie gelten als die „Schutzheiligen aller Künste“. Mehrere von ihnen haben gemäß den Überlieferungen im weiteren Sinne mit dem Verfassen von Texten zu tun, ob in Form der Lyrik, der Tragödie, der Liebesdichtung, der epischen Dichtung oder der komischen Poesie.
Wenn nun ein Autor ein besonders gutes Werk hervorbringt, so heißt es oft, er sei von der Muse geküsst worden. Was ist nun aber, wenn der Musenkuss ausbleibt und der Autor schlimmstenfalls gar nichts zu Papier bringt. Was bei Laien nur für Frustration und Verzögerung sorgen mag, ist für Berufsautoren mit Existenzängsten verbunden, da sie ihre Tätigkeit nicht mehr erwartungsgemäß ausüben können.
Ein Grund dafür können Schreibblockaden sein. Der Autor ist blockiert und kann die Hürde nicht überwinden, die zwischen ihm und dem sprichwörtlichen weißen Blatt Papier entstanden ist. Selbst berühmten Autoren wie Franz Kafka und Mark Twain war dieser Zustand bekannt. Und doch waren sie erfolgreich. Es scheint so, als hätten sie gelernt mit den Produktionsengpässen umzugehen. Diese Fähigkeit, Schreibblockaden zu bewältigen, sollte zum Handwerkszeug aller gehören, die sich mit dem geschriebenen Wort beschäftigen.
Der Schreibblockade und dem zielführenden Umgang mit dieser möchte ich mich deshalb mit der vorliegenden Ausarbeitung widmen. Das Ziel ist es, den Facettenreichtum von Schreibblockaden aufzuzeigen und darauf basierend Möglichkeiten zum Umgang mit diesen zu benennen. Dazu werden zunächst Informationen aus der Literatur zusammentragen, die helfen sollen, Schreibblockaden zu erkennen und einzuordnen. Sie umfassen erste Begriffsdefinitionen ebenso wie eine umfangreiche Aufzählung von Erscheinungsformen und Ursachen. Anschließend werden darauf basierend verschiedene Ansätze zum Umgang und zur Behandlung von Schreibblockaden aufgeführt. Den Schluss der Arbeit stellt ein Fazit dar, in welchem die hier dargebotenen Inhalte zusammengefasst und bewertet werden.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Relevanz & Problemstellung
1.2 Zielsetzung & Aufbau der Arbeit
2 Definition grundlegender Begrifflichkeiten
2.1 Definition des Schreibprozesses
2.2 Definition der Schreibblockade
3 Erscheinungsformen und Ursachen von Schreibblockaden
3.1 Planungs- und formulierungsbezogene Störungen nach Keseling
3.2 Die Schreibblockade als Geistes- sowie Gehirnzustand nach Flaherty
4 Umgang mit und Behandlung von Schreibblockaden
4.1 Handlungsempfehlung nach Keseling
4.2 Handlungsempfehlungen nach Flaherty
5 Zusammenfassung & Ergebnisdiskussion
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Schreibblockade?
Eine Schreibblockade ist ein Zustand, in dem ein Autor unfähig ist, einen Text zu beginnen oder fortzusetzen, oft trotz des Wunsches oder der Notwendigkeit zu schreiben.
Welche Ursachen können Schreibblockaden haben?
Ursachen können Perfektionismus, Angst vor Kritik, mangelnde Planung oder neurologische Zustände des Gehirns sein.
Wie unterscheiden sich planungs- und formulierungsbezogene Störungen?
Planungsstörungen betreffen die Struktur des Textes, während formulierungsbezogene Störungen das Finden der passenden Worte erschweren.
Welche Tipps gibt es zum Umgang mit Schreibblockaden?
Empfohlen werden Methoden wie Freewriting, das Aufteilen in kleine Etappen oder die Veränderung der Schreibumgebung nach Keseling und Flaherty.
Hatten auch berühmte Autoren Schreibblockaden?
Ja, selbst erfolgreiche Schriftsteller wie Franz Kafka und Mark Twain litten unter Produktionsengpässen und mussten Wege finden, damit umzugehen.
- Arbeit zitieren
- Antje Mertz (Autor:in), 2019, Umgang mit Schreibblockaden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491485