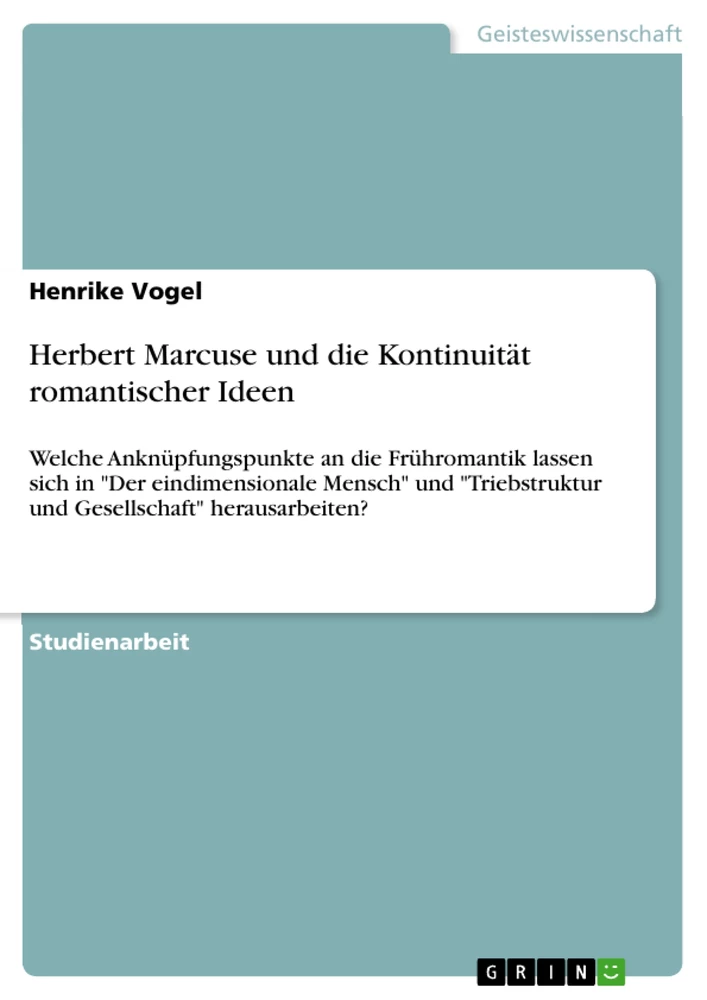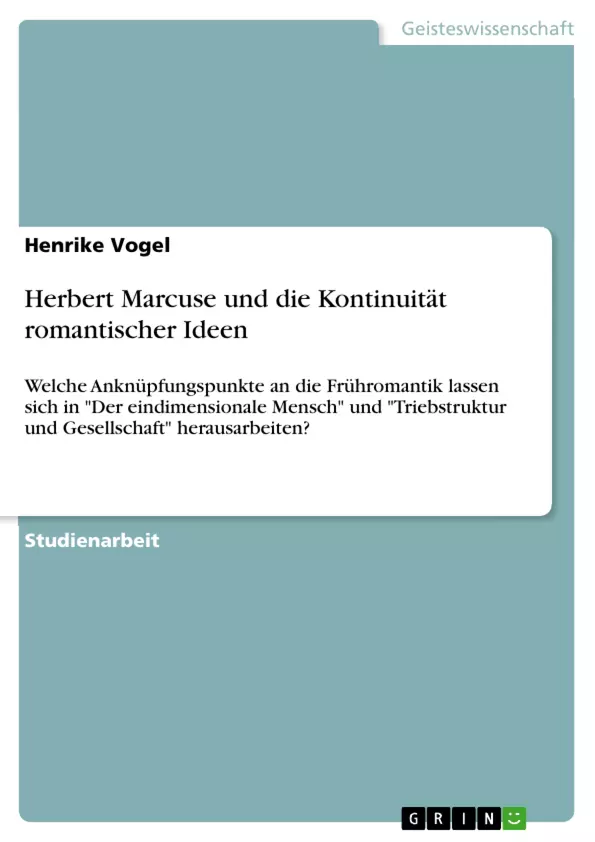Die vorliegende Hausarbeit stellt den Versuch dar, die progressive Frühromantik nicht nur zu rehabilitieren, sondern zugleich exemplarische Anknüpfungspunkte an Herbert Marcuses Werke "Der eindimensionale Mensch" (1967) sowie "Triebstruktur und Gesellschaft" (1957) herauszuarbeiten.
Die deutsche Romantik gilt vielen als idealistische Epoche des Kitschs, der Träumerei, der antimodernen Schwärmerei für eine ländliche Vergangenheit, sie gilt als Gegenentwurf zur gepriesenen Aufklärung, als irrational, phantastisch, esoterisch, religiös. Die Aufzählung ihrer Mängel könnte sich über diese Seite fortsetzen, jedoch breche ich sie an dieser Stelle ab, um ein gänzlich anderes Gesicht der Romantik zu zeichnen. Die von Kawerin hergeleitete ursprüngliche Bedeutung des Wortes Romantik als Mauerbrecher scheint auf eine andere Romantik zu deuten, auf einen utopischen Versuch das Leben zu revolutionieren, die Zwänge und Grenzen der Gesellschaft aufzubrechen.
So muss differenziert werden zwischen der Frühromantik, die sich als Aufklärung der Aufklärung versteht und moderne Tendenzen der Entfremdung in die Kritik nahm, emanzipative Modelle des Zusammenlebens entwarf und erprobte, fundamentale Religionskritik übte und kühn ein neues goldenes Zeitalter der durch Poesie und Einbildungskraft befreiten Menschheit ausrief, und einer Spätromantik, die zurückkehrte zum dogmatischen Katholizismus, idyllischen Bildern nationaler Heimatliebe und einer sich versenkten Innerlichkeit verfiel, die reaktionären Unternehmen einen nahtlosen Anschluss lieferten.
Die Frühromantik als Versuch einer Aufklärung der Aufklärung gab späteren progressiven Bewegungen zahlreiche Impulse, ohne dass der Ursprung dieser Ideen dezidiert reflektiert und gewürdigt wurde. Im Gegenteil wurde der Romantik insgesamt reaktionäre Tendenzen unterstellt, die geradewegs in den Faschismus mündeten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Frühromantik & die Dialektik der Aufklärung
- 2. Marcuse und die Kontinuität romantischer Ideen
- 2.1 Die Phantasie an die Macht
- 2.2 Narziss & Orpheus
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die progressive Frühromantik und ihre Verbindungen zu den Werken von Herbert Marcuse, insbesondere „Der eindimensionale Mensch“ und „Triebstruktur und Gesellschaft“. Der Fokus liegt auf der ideengeschichtlichen Analyse und der Frage, inwieweit Marcuses Werk Kontinuitäten zu frühromantischen Ideen aufweist. Ziel ist es, die progressiven Elemente der Frühromantik herauszuarbeiten und deren Aufnahme in Marcuses Werk zu beleuchten.
- Rehabilitation der progressiven Frühromantik
- Aufzeigen von Anknüpfungspunkten zu Herbert Marcuses Werken
- Analyse der Kontinuität (früh-)romantischer Ideen in Marcuses Werk
- Herausarbeitung der progressiven Anteile der Frühromantik und ihrer Aufnahme
- Identifizierung und Analyse von progressiven und reaktionären Elementen in Marcuses Konzeptionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Abriss über die Frühromantik als Aufklärung der Aufklärung, unterstreicht ihr utopisches Potenzial und stellt die Kritik an einer totalitären Rationalität und einem instrumentell verkürzten Verstand heraus. Das zweite Kapitel analysiert exemplarische Textstellen aus „Der eindimensionale Mensch“ und „Triebstruktur und Gesellschaft“, wobei die Phantasie/Einbildungskraft und der Mythos von Narziss und Orpheus im Fokus stehen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der frühromantischen Ideenwelt dienen als Grundlage für einen Deutungsversuch von Marcuses Theorie.
Schlüsselwörter
Frühromantik, Aufklärung, Herbert Marcuse, „Der eindimensionale Mensch“, „Triebstruktur und Gesellschaft“, Phantasie, Einbildungskraft, Narziss, Orpheus, progressive Elemente, reaktionäre Elemente, utopisches Potenzial, Kontinuität romantischer Ideen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Herbert Marcuses Kritik am "eindimensionalen Menschen"?
Marcuse kritisiert die moderne Industriegesellschaft, die durch Konsum und technologische Rationalität jegliche Opposition absorbiert und den Menschen in seiner Denkweise "eindimensional" macht.
Welche Verbindung besteht zwischen der Frühromantik und Marcuse?
Marcuse knüpft an das utopische Potenzial der Frühromantik an, insbesondere an die Idee der Phantasie als befreiende Kraft gegen eine rein instrumentelle Vernunft.
Warum unterscheidet man zwischen Früh- und Spätromantik?
Die Frühromantik gilt als progressiv und "Aufklärung der Aufklärung", während die Spätromantik oft als reaktionär, nationalbetont und religiös-dogmatisch wahrgenommen wird.
Welche Rolle spielen Narziss und Orpheus in Marcuses Werk?
In "Triebstruktur und Gesellschaft" nutzt Marcuse diese Mythen als Symbole für eine nicht-repressive Existenz und eine neue Sensibilität, die im Gegensatz zum herrschenden Leistungsprinzip steht.
Was bedeutet "Phantasie an die Macht" in diesem Kontext?
Es ist der Aufruf, die kreative Einbildungskraft als politisches Instrument zu nutzen, um gesellschaftliche Zwänge aufzubrechen und emanzipative Lebensmodelle zu entwerfen.
- Citar trabajo
- Henrike Vogel (Autor), 2018, Herbert Marcuse und die Kontinuität romantischer Ideen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491582