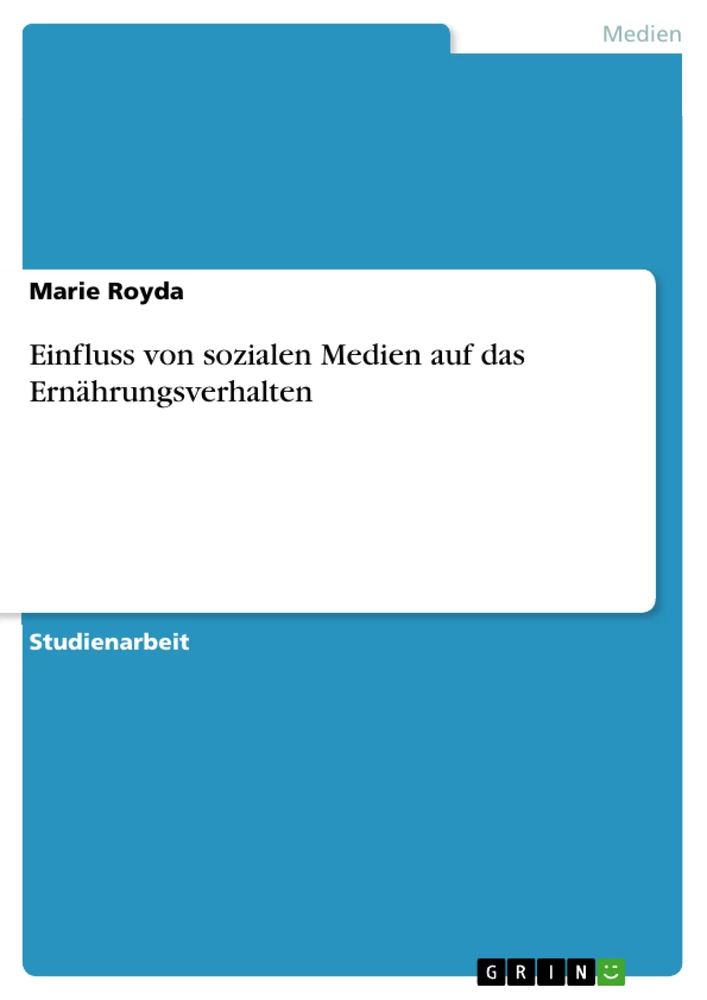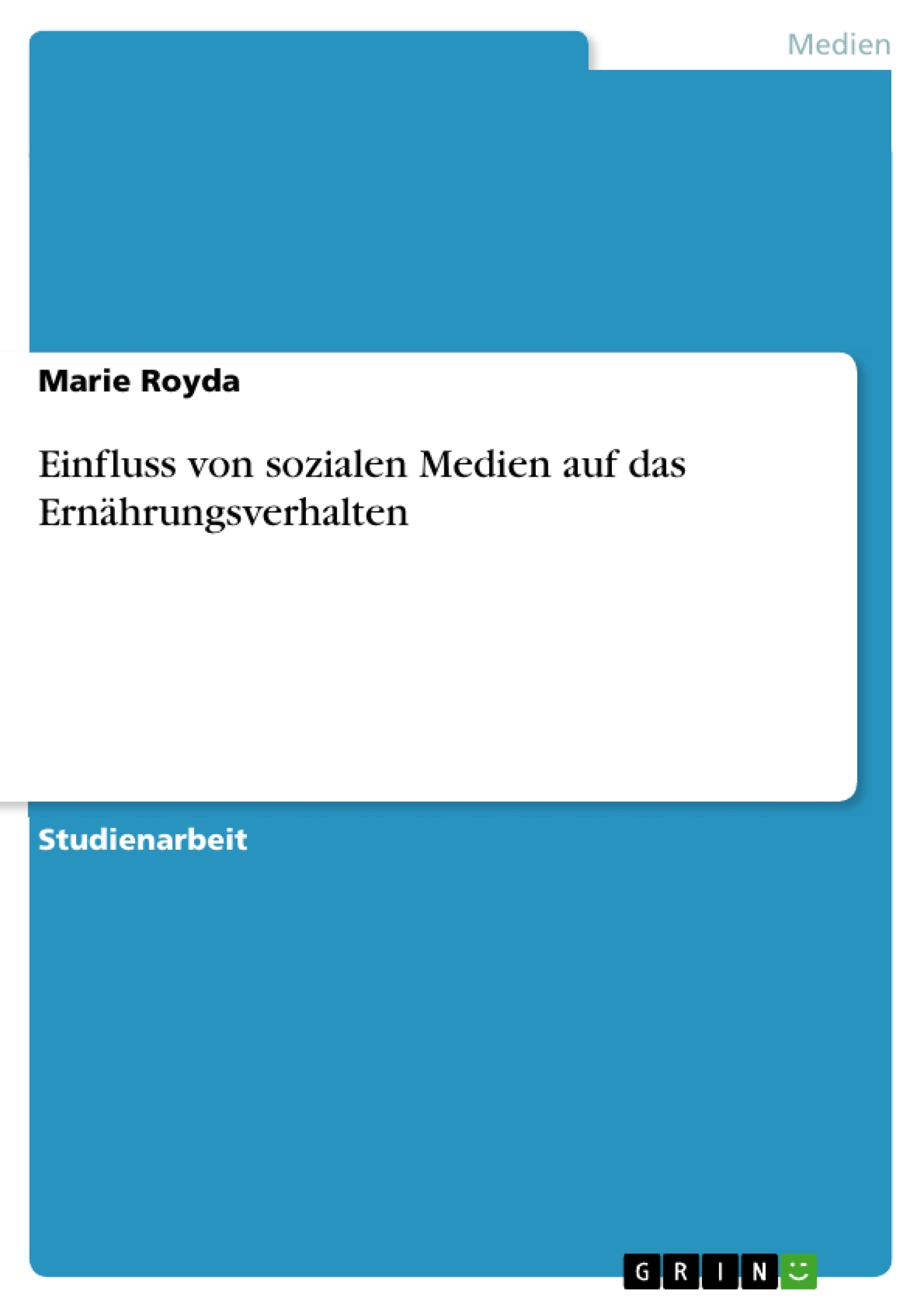Diese Arbeit handelt von dem Einfluss der sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten. Seitdem die sozialen Medien populär und immer und überall abrufbar geworden sind, haben sie zunehmend an Wertigkeit und Einfluss gewonnen. Dies prägt vor allem das Konsumverhalten der jungen Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren, da diese Altersgruppe mit dem Umgang sozialer Medien und Kommunikationsformen aufgewachsen ist und diese von klein auf kennen. Durch das Posten und Teilen von Essensfotos und -Videos und auch das Kommentieren von neuen „Food-Hashtags“ der sogenannten Food-Community erhält das Thema „Digital Food“ zunehmenden Einzug in die sozialen Netzwerke. Aufgrund dieses rasanten Wertewandels nehmen die sozialen Medien einen entscheidenden Platz bei der Identitätsbildung der besagten Generation ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition soziale Medien
- 2.2 Definition Ernährungsverhalten
- 3 Ernährungskommunikation in sozialen Medien
- 3.1 Emotional geprägte Ernährung
- 3.1.1 Mahlzeiten als soziales Erlebnis
- 3.1.2 Essstörungen
- 3.2 Ernährungstrends in sozialen Medien
- 3.2.1 Selbstdarstellung durch Essensfotos posten
- 3.2.2 Influencer als Trendsetter hinsichtlich des Ernährungsverhaltens
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten und untersucht, wie die Digitalisierung das Essverhalten von Menschen prägt. Der Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und YouTube für die Veröffentlichung von Essensfotos und -videos, die sogenannten "Food-Hashtags".
- Definition von sozialen Medien und Ernährungsverhalten
- Einfluss emotionaler Faktoren auf Ernährung im Kontext sozialer Medien
- Analyse von Ernährungstrends und Influencer-Marketing
- Selbstdarstellung und Social-Media-Nutzung im Zusammenhang mit Essensfotos
- Die Rolle von Digital Food in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Thema der Hausarbeit eingeführt und die Bedeutung der sozialen Medien für das Ernährungsverhalten im Kontext der heutigen Zeit erläutert. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen und definiert die Begriffe "soziale Medien" und "Ernährungsverhalten". Dabei werden verschiedene Autoren und ihre Definitionen von sozialen Medien vorgestellt. Im dritten Kapitel wird die Ernährungskommunikation in sozialen Medien analysiert. Es werden die unterschiedlichen Formen emotionaler Ernährung, wie Mahlzeiten als soziales Erlebnis und Essstörungen, sowie die Rolle von Ernährungstrends und Influencern im digitalen Raum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Ernährungsverhalten, Digital Food, Ernährungskommunikation, Food-Hashtags, Selbstdarstellung, Influencer, Essstörungen, Trends, Social Media Marketing
- Quote paper
- Marie Royda (Author), 2019, Einfluss von sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491620