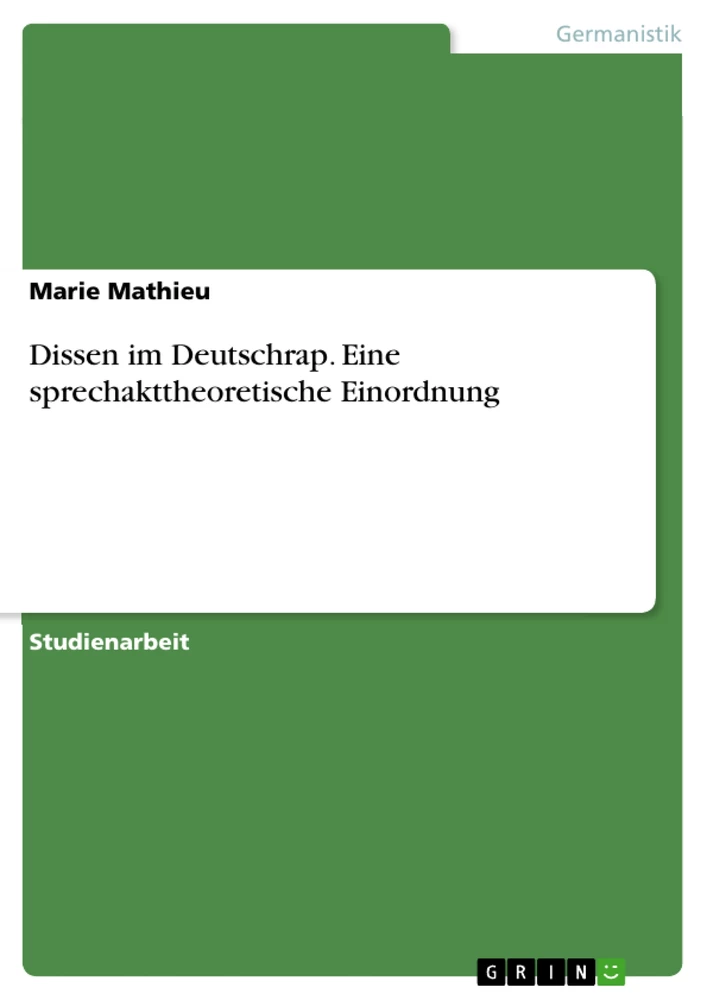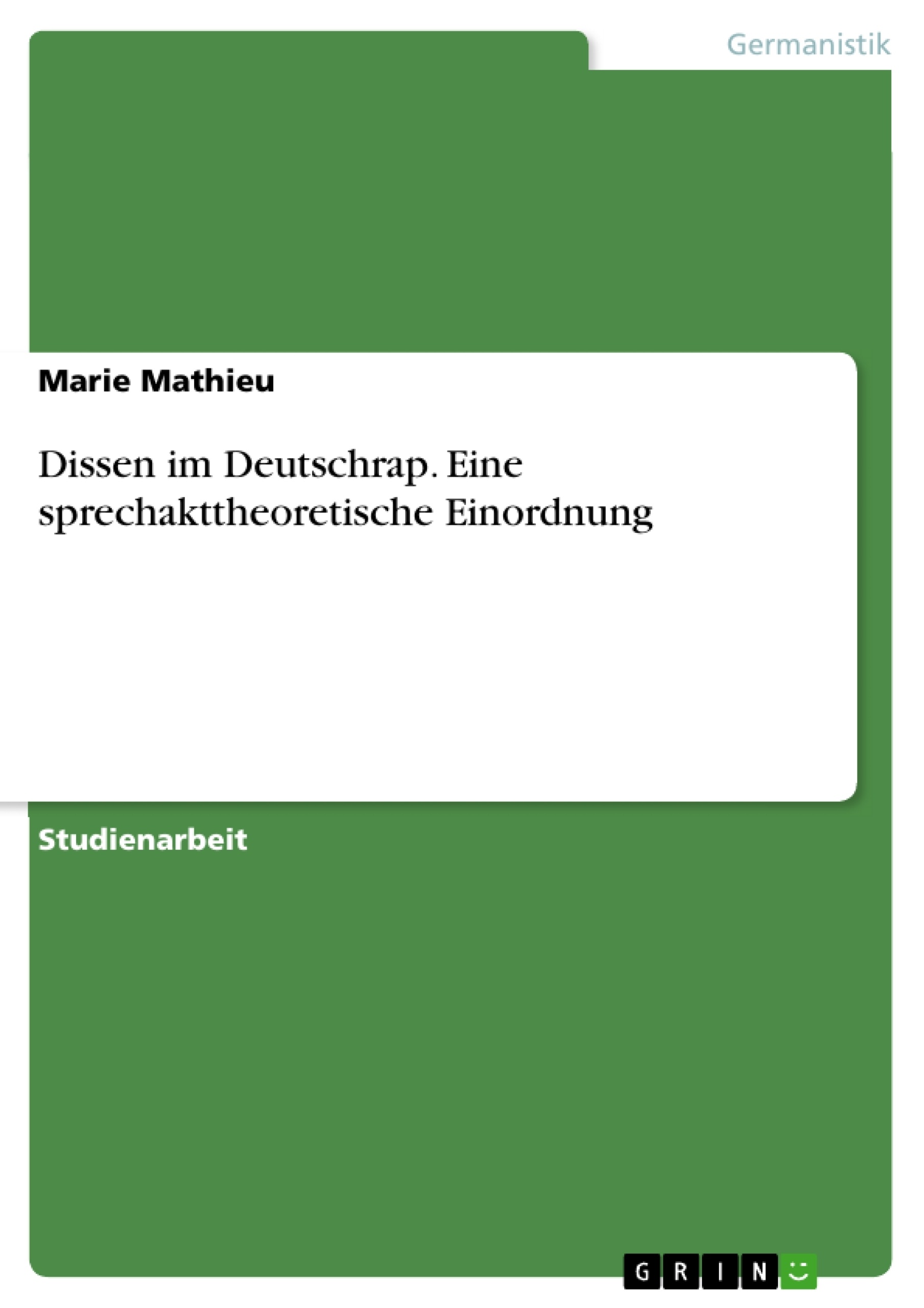Diese Hausarbeit macht sich somit zur Aufgabe verschiedene Arten des Dissens, Sprecherabsichten und -tendenzen zu untersuchen, Diskursstränge dessen herauszuarbeiten und anhand wiederkommender Merkmale diese Sprachform sprechakttheoretisch einzuordnen. Mediale Performanzrahmen, die ebenfalls zur Konstutierung des eigenen „Images“ dienen können, sollen nicht besprochen werden. Das sogenannte Boasten (engl. to boast, übersetzt „prahlen“), soll ebenfalls in Augenschein genommen werden, ausgehend von der Annahme, dass Dissen und Boasten sich nicht nur im Deutschrap abwechseln, sondern gegenseitig unterstützen, um ein extremes Selbstbild zu konstruieren und im Vergleich dazu einen ganz bestimmten Augenschein auf das (suggerierte) Gegenüber zu werfen.
Die Arbeit wird somit zunächst mit einer groben theoretischen Einführung anhand von John L. Austins und John R. Searles Ideen in die Sprechakttheorie beginnen. Hintergründe der deutschen HipHop-Kultur sollen dargelegt werden, bevor dann die Diskursstränge Boasten und Dissen anhand wiederkommender inhaltlicher Themen genauer untersucht werden sollen. Dabei wird im Kontext des Boasten auf Kategorien wie Hautfarbe, Kriminalität und Rapstil eingegangen, im Vordergrund sollen allerdings die Handlungsstränge des Dissens in Bezug auf Gruppen, Geschlechter und Sexualität stehen. Die Relation von den Aussagen und ihren Benutzern soll anschließend sprechakttheoretisch eingeordnet werden. Es soll hinterfragt werden, ob Dissen als eigenständiger Sprechakt verstanden werden kann und inwiefern sich ein Diss von einer Beleidigung abgrenzt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EINFÜHRUNG IN DIE SPRECHAKTTHEORIE
- EINFÜHRUNG IN DIE (DEUTSCHE) RAPKULTUR
- Gruppen
- Boasten mit dem eigenem Rap
- Boasten über die Hautfarbe
- Boasten über Kriminalität
- DEFINITION VON „DISSEN“
- METHODIK DER DISKURSANALYSE
- BOASTEN
- Boasten mit dem eigenem Rap
- Boasten über die Hautfarbe
- Boasten über Kriminalität
- DISSEN
- X fickt X...
- Dissen über Geschlecht und Sexualität
- SPRECHAKTTHEORETISCHE EINORDNUNG
- Glückungsbedingungen
- Zweistufige Einteilung des perlokutionären Aktes
- Implizite und explizite Performativität
- Grenzen und Diskussion
- FAZIT
- LISTE UNTERSUCHTER KÜNSTLER UND LIEDER
- APPENDIX: TRANSKRIPTIONEN UND VORLAGEN DER DISKURSANALYSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der sprechakttheoretischen Einordnung von Dissen im Deutschrap. Ziel ist es, verschiedene Arten des Dissens, Sprecherabsichten und -tendenzen zu untersuchen, Diskursstränge herauszuarbeiten und anhand wiederkommender Merkmale diese Sprachform sprechakttheoretisch einzuordnen.
- Analyse von Dissen und Boasten als sprachliche Mittel im Deutschrap
- Untersuchung von Diskurssträngen und inhaltlichen Themen im Kontext von Dissen
- Einordnung von Dissen in die Sprechakttheorie und Abgrenzung zu Beleidigungen
- Erarbeitung des Verhältnisses von Sprechakten und ihrem Benutzer im Deutschrap
- Exploration der sprachlichen Brutalität im Deutschrap und ihrer Entstehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Dissens im Deutschrap ein und beleuchtet die besondere Bedeutung sprachlichen Ausdrucks in dieser Kultur. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die verschiedenen Arten des Dissens zu untersuchen und sie sprechakttheoretisch einzuordnen.
Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in die Sprechakttheorie, ausgehend von John L. Austins Werk "How to do things with words". Hier werden die drei Arten von Sprechakten - der lokutionäre, der illokutionäre und der perlokutionäre Akt - erläutert und Searles Erweiterung der Theorie vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der deutschen HipHop-Kultur und ihren Hintergründen. Im vierten Kapitel werden die Diskursstränge von Boasten und Dissen anhand wiederkehrender inhaltlicher Themen untersucht. Der Fokus liegt dabei auf Kategorien wie Hautfarbe, Kriminalität und Rapstil beim Boasten, während beim Dissen die Handlungsstränge in Bezug auf Gruppen, Geschlechter und Sexualität im Vordergrund stehen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der sprechakttheoretischen Einordnung der Aussagen und ihrer Benutzer. Es wird hinterfragt, ob Dissen als eigenständiger Sprechakt verstanden werden kann und inwiefern sich ein Diss von einer Beleidigung abgrenzt.
Schlüsselwörter
Deutschrap, Dissen, Boasten, Sprechakttheorie, Performativität, illokutionärer Akt, perlokutionärer Akt, Sprachhandlung, Diskursanalyse, Gruppen, Geschlecht, Sexualität, Sprache, Kultur, Brutalität, Gewalt, HipHop-Kultur.
- Citation du texte
- Marie Mathieu (Auteur), 2018, Dissen im Deutschrap. Eine sprechakttheoretische Einordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491854