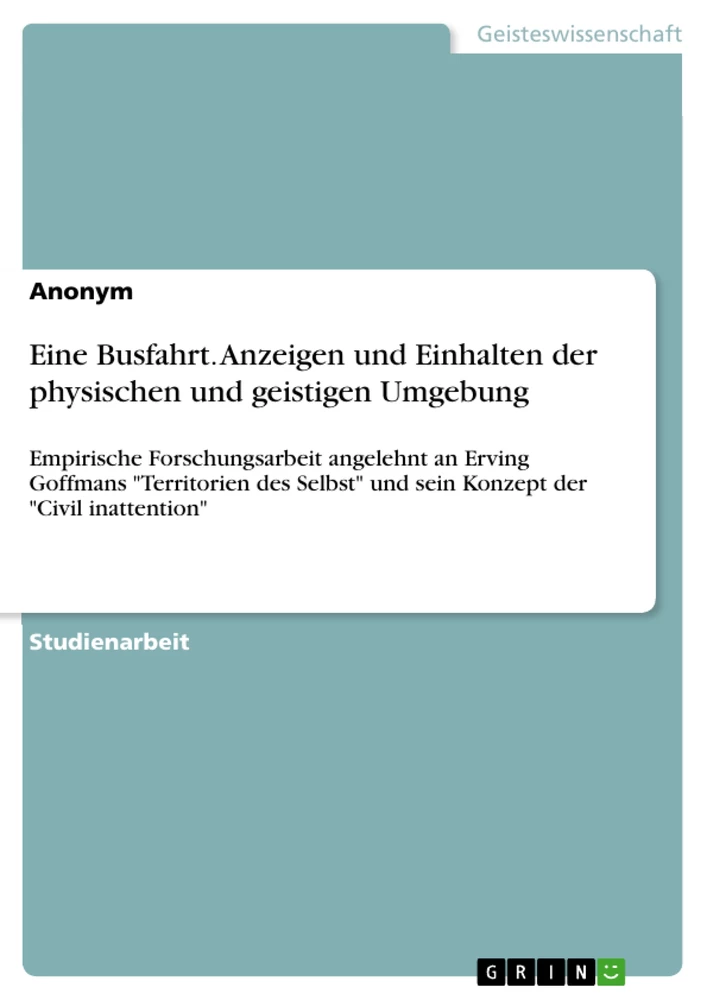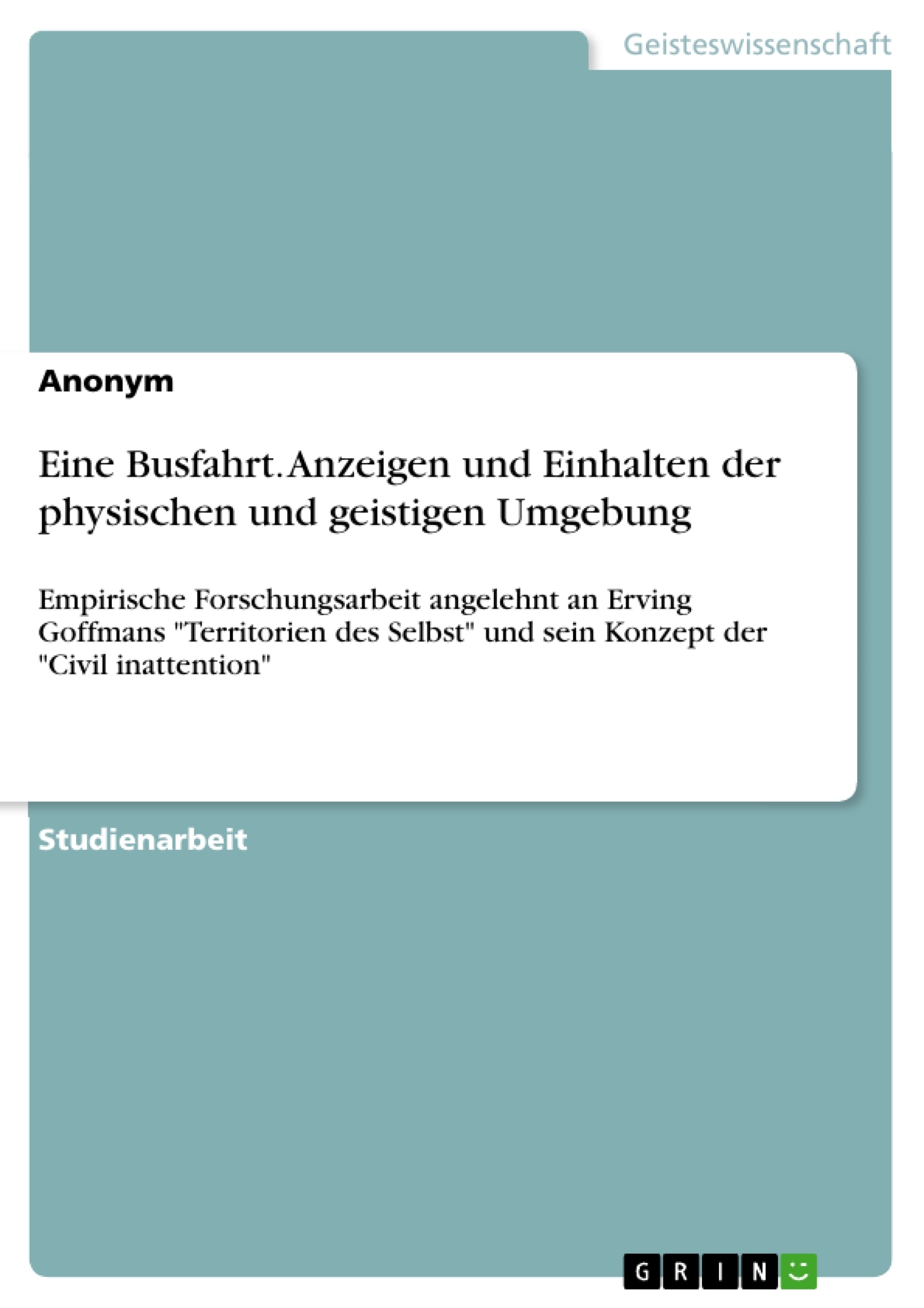Bei Beobachtung alltäglicher Begegnungen von Fremden trifft man vor allem im städtischen Leben auf eine zunehmende Anonymität. An öffentlichen Orten, wie Cafés, Einkaufszentren oder Parks wird soziale Interaktion für gewöhnlich vermieden, stattdessen üben die Menschen ihre Aktivitäten allein aus und bleiben für sich. Zum Aufrechterhalten dieser Anonymität gehört jedoch mehr, als das passive Ausweichen und Meiden anderer, es erfordert aktive Anstrengungen der Einzelpersonen. Dabei scheint ein stillschweigender Konsens über unausgesprochene Verhaltensregeln und Situationsnormen zu herrschen, welche es den Menschen erlauben, ihre Identitäten zu schützen und soziale Ordnung herzustellen.
Ein alltäglicher dieser öffentlichen Räume, in denen Menschen dazu neigen, sich von anderen zu isolieren, ist der des Busfahrens. Im Rahmen meines Studiums, sowie zu Freizeitzwecken bin ich diesem Raum nahezu täglich ausgesetzt. Dabei fiel auf, dass in Bussen ganz eigene Routinen und Verhaltensregeln herrschen, die von jedem Fahrgast verstanden und eingehalten werden. In jedem Fall gilt es in erster Linie, den persönlichen Freiraum der anderen zu respektieren – Fahrgäste tun so, als seien sie unsichtbar und als seien andere für sie unsichtbar (Kim, 2012). Um diese Unbekanntheit aufrechterhalten zu können, scheint es, als bilden Nutzende des öffentlichen Stadtverkehrs eine Barriere um ihre unmittelbare Umgebung, die durch Verhaltensweisen oder Gegenstände angezeigt werden können und dessen Missachtung Folgen nach sich ziehen kann.
Aus diesem Grund wird in der folgenden Arbeit angelehnt an Erving Goffmans „Territorien des Selbst“ (1974, S. 54) der These nachgegangen, dass Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel bestimmte Methoden anwenden, um die jeweils eigene physische sowie geistige Umgebung vor Beeinträchtigung durch Mitfahrende zu schützen. Als eine Methode wird dabei das ebenfalls von Goffman entworfene Konzept der „höflichen Gleichgültigkeit“ („civil inattention“, 1971. S. 83) vorgeschlagen. Dazu werden anfänglich theoretische Grundlagen, sowie die Forschungsmethodik dargelegt. Im Anschluss folgt die Interpretation des Datenmaterials, die sich an der Chronologie einer Busfahrt orientiert, sodass zuletzt ein Fazit gezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Territorien des Selbst
- 2.2 „Civil Inattention“
- 3. Methodisches Vorgehen
- 4. Analyse
- 4.1 Warten und Einstieg
- 4.2 Platzwahl und Stehordnung
- 4.3 Blickkontakt
- 4.4 Gespräche und Lautstärke
- 4.5 Ausstieg
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln ihre physische und geistige Umgebung schützen. Sie analysiert, wie die Konzepte von Erving Goffman, insbesondere „Territorien des Selbst“ und „Civil Inattention“, im Kontext einer Busfahrt Anwendung finden.
- Schutz des persönlichen Raums im öffentlichen Raum
- Anwendung von Goffmans „Territorien des Selbst“ im Kontext einer Busfahrt
- Bedeutung von „Civil Inattention“ für soziale Interaktion im öffentlichen Nahverkehr
- Beobachtung und Analyse von Verhaltensmustern im öffentlichen Busverkehr
- Die Rolle unbewusster Regeln und Normen im Umgang mit Mitfahrern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Interaktion und Anonymität im öffentlichen Raum ein, insbesondere im Kontext des Busfahrens. Der Autor beschreibt seine alltägliche Begegnung mit diesem Raum und die auffälligen Routinen und Verhaltensregeln der Fahrgäste, die darauf abzielen, den persönlichen Freiraum anderer zu respektieren. Die Arbeit untersucht die These, dass Fahrgäste Methoden anwenden, um ihre physische und geistige Umgebung vor Beeinträchtigung zu schützen, wobei Goffmans Konzepte der „Territorien des Selbst“ und „Civil Inattention“ als theoretische Grundlage dienen. Die Methode der teilnehmenden Beobachtung wird angekündigt.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel stellt Goffmans Konzept der „Territorien des Selbst“ vor, das verschiedene Formen von Territorien beschreibt, wie den persönlichen Raum, die Box, die Reihenposition, Besitzterritorien, Informationsreservate und das Gesprächsreservat. Es erklärt, wie diese Territorien markiert und durch verschiedene Handlungen verletzt werden können. Weiterhin wird Goffmans Konzept der „Civil Inattention“ erläutert, welches das Verhalten von Fremden in der Öffentlichkeit beschreibt, die sich gegenseitig wahrnehmen, aber gleichzeitig ihre Interaktion minimieren. Der Fokus liegt auf der Relevanz dieser Konzepte für die Analyse des Verhaltens von Busfahrgästen.
3. Methodisches Vorgehen: Hier wird die empirische Methodik beschrieben. Es werden teilnehmende Beobachtungen in öffentlichen Bussen in Tübingen erläutert. Die Rolle des Beobachters als gewöhnlicher Fahrgast und sein Bestreben, sich situationsgerecht zu verhalten, wird hervorgehoben. Die angewandte Methode der teilnehmenden Beobachtung wird detaillierter beschrieben, jedoch ohne konkrete Angaben zu den Beobachtungsprotokollen.
4. Analyse: Die Analyse basiert auf der Chronologie einer Busfahrt und untersucht verschiedene Aspekte des Verhaltens von Fahrgästen. Sie umfasst die Phasen Warten und Einstieg, Platzwahl und Stehordnung, Blickkontakt, Gespräche und Lautstärke sowie den Ausstieg. Diese Analyse zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie Fahrgäste Goffmans Konzepte in der Praxis umsetzen um ihre "Territorien" zu schützen.
Schlüsselwörter
Öffentlicher Raum, Anonymität, soziale Interaktion, Erving Goffman, Territorien des Selbst, Civil Inattention, Busfahrt, teilnehmende Beobachtung, Verhaltensregeln, physischer Raum, geistiger Raum, persönlicher Freiraum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Fahrgastverhalten im öffentlichen Nahverkehr
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln (konkret: Bussen) ihre physische und geistige Umgebung schützen. Sie analysiert dabei die Anwendung von Erving Goffmans Konzepten „Territorien des Selbst“ und „Civil Inattention“ im Kontext einer Busfahrt.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Erving Goffmans Theorien der „Territorien des Selbst“ (persönlicher Raum, Box, Reihenposition, Besitzterritorien, Informationsreservate, Gesprächsreservat) und der „Civil Inattention“ (minimale Interaktion zwischen Fremden im öffentlichen Raum). Diese Konzepte werden genutzt, um das Verhalten der Fahrgäste zu erklären und zu interpretieren.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde die teilnehmende Beobachtung in öffentlichen Bussen in Tübingen eingesetzt. Der Autor agierte als gewöhnlicher Fahrgast und beobachtete das Verhalten der Mitreisenden. Details zu den Beobachtungsprotokollen werden jedoch nicht explizit genannt.
Welche Aspekte des Fahrgastverhaltens werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene Phasen einer Busfahrt: Warten und Einstieg, Platzwahl und Stehordnung, Blickkontakt, Gespräche und Lautstärke sowie Ausstieg. Der Fokus liegt darauf, wie Fahrgäste ihre „Territorien“ (im Sinne Goffmans) schützen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Goffman), ein Kapitel zur Methodik, die Analyse des Fahrgastverhaltens und einen Schluss. Das Inhaltsverzeichnis beinhaltet detaillierte Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Öffentlicher Raum, Anonymität, soziale Interaktion, Erving Goffman, Territorien des Selbst, Civil Inattention, Busfahrt, teilnehmende Beobachtung, Verhaltensregeln, physischer Raum, geistiger Raum, persönlicher Freiraum.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu zeigen, wie Fahrgäste unbewusst Regeln und Normen anwenden, um ihren persönlichen Raum und ihre geistige Privatsphäre im öffentlichen Nahverkehr zu schützen. Sie untersucht, wie Goffmans Konzepte im Alltag praktisch umgesetzt werden.
Wie wird die Zusammenfassung der Kapitel präsentiert?
Die Arbeit bietet eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die den Inhalt und die Argumentation prägnant beschreibt. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über die einzelnen Abschnitte und ihre Beiträge zur Gesamtthematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Eine Busfahrt. Anzeigen und Einhalten der physischen und geistigen Umgebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491908