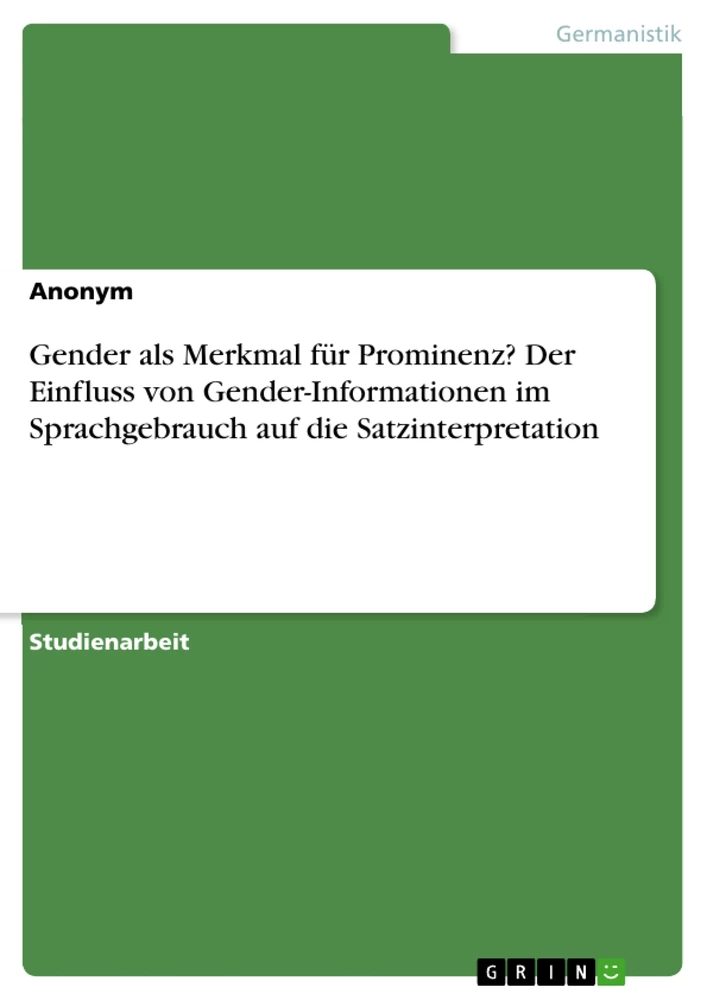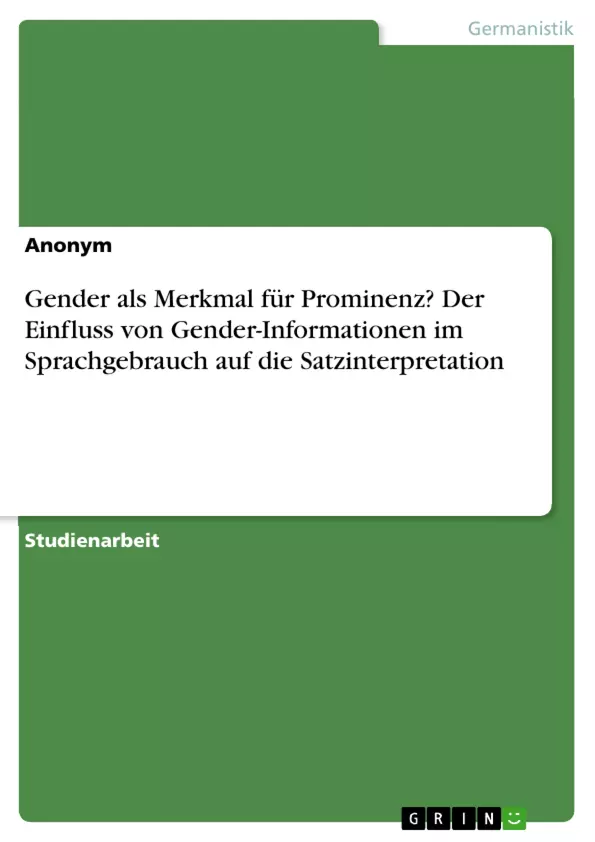‚Weiblich sein‘ oder ‚männlich sein‘ – das Geschlecht nimmt bis heute eine zentrale Rolle in unserem gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Leben ein. Frauen und Mädchen befinden sich dabei noch immer in einer schlechteren Position als Männer und Jungen. Die feministische Sprachwissenschaft befasst sich unter anderem mit der Frage, inwiefern sich soziale und psychologische Begebenheiten in der Sprache und dem Sprachgebrauch widerspiegeln. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss von geschlechtsspezifischen Informationen auf die online-Satzverarbeitung zu untersuchen und mit dem Konzept linguistischer Prominenz zu verbinden. Anhand dessen soll diskutiert werden, inwiefern die Ergebnisse für eine Bewertung der generischen Verwendung maskuliner Formen im aktuellen Sprachgebrauch fruchtbar sein können.
Die Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft liegen in den 1970er Jahren und sie umfasst verschiedene Forschungsschwerpunkte des Bereichs ‚Sprache und Geschlecht‘ (Samel 2000: 10). Die Untersuchung der Verwendung des generischen Maskulinums gliedert sich hierbei an den inhaltlichen Schwerpunkt der feministischen Kritik an Sprachsystem und Sprachgebrauch an. Empirische Forschung trägt dazu bei, Aufschluss über die semantische Besetzung generisch maskuliner Formen zu erlangen. Auf Grundlage empirisch ermittelter Ergebnisse und der anschließenden Einordnung dieser in die linguistische Theorie können Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie eine angemessene feministische Sprachkritik aussehen muss. Einen Beitrag zur feministischen Sprachwissenschaft leisten aktuelle Ergebnisse im Bereich der empirischen Untersuchung der online-Satzverarbeitung. Der bereits vielfach nachgewiesene gender-mismatch-Effekt zeigt, dass sich stereotypische mentale Repräsentationen hinsichtlich der geschlechtlichen Besetzung bestimmter Nomina im Sprachgebrauch und im Sprachverstehen widerspiegeln.
Ein aktueller Ansatz untersucht, inwiefern Gender als Merkmal für linguistische Prominenz angenommen werden kann. Dafür sprechen aktuelle Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass geschlechtsspezifische Informationen im Sprachgebrauch einen Einfluss auf die Zuweisung von thematischen Rollen ausüben. Die Annahme von Gender als Merkmal für Prominenz könnte aufzeigen, dass sich geschlechtsspezifische Vorurteile im Sprachgebrauch verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND
- 2.1 Das generische Maskulinum
- 2.2 gender-mismatch - Effekt
- 2.3 Prominenz
- 3. DIE INTERAKTION VON GENDER UND THEMATISCHEN ROLLEN
- 4. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN: GENDER ALS MERKMAL FÜR PROMINENZ
- 5. DISKUSSION
- 5.1 Allgemeine Diskussion
- 5.2 Kritik am generischen Maskulinum
- 6. FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss geschlechtsspezifischer Informationen auf die Satzinterpretation im Kontext der linguistischen Prominenz. Es wird untersucht, ob Gender als Merkmal für Prominenz angenommen werden kann und wie diese Annahme für eine Bewertung des generischen Maskulinums fruchtbar sein könnte.
- Die Auswirkungen von Gender-Informationen auf die Zuweisung von thematischen Rollen
- Die Annahme von Gender als Prominenzmerkmal
- Die Kritik am generischen Maskulinum im Lichte der Ergebnisse
- Die Einbettung der Ergebnisse in sozialpsychologische und gesellschaftliche Kontexte
- Die Relevanz der Ergebnisse für die feministische Sprachwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfragen der Arbeit vor.
- Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen und empirischen Hintergrund der Forschung zum generischen Maskulinum, dem gender-mismatch-Effekt und dem Konzept der linguistischen Prominenz.
- Kapitel 3 untersucht die Interaktion von Gender und thematischen Rollen anhand aktueller Forschungsergebnisse.
- Kapitel 4 diskutiert theoretische Überlegungen, ob Gender als Merkmal für Prominenz angenommen werden kann, basierend auf den Ergebnissen aus Kapitel 3.
- Kapitel 5.1 setzt sich mit den Ergebnissen im linguistischen Kontext auseinander.
- Kapitel 5.2 befasst sich mit der Relevanz der Ergebnisse für eine feministische Kritik am Sprachgebrauch.
Schlüsselwörter
Generisches Maskulinum, gender-mismatch-Effekt, Prominenz, thematische Rollen, Sprachverarbeitung, feministische Sprachwissenschaft, Sprachkritik, Gender Studies.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „gender-mismatch-Effekt“?
Dieser Effekt beschreibt die Verzögerung in der Sprachverarbeitung, wenn stereotype mentale Repräsentationen des Geschlechts nicht mit dem tatsächlichen Textinhalt übereinstimmen.
Kann Gender als Merkmal für linguistische Prominenz gelten?
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass geschlechtsspezifische Informationen die Zuweisung thematischer Rollen beeinflussen, was Gender zu einem potenziellen Prominenzmerkmal macht.
Warum wird das generische Maskulinum kritisiert?
Kritiker argumentieren, dass die maskuline Form keine neutrale Vorstellung erzeugt, sondern Männer mental stärker präsent macht und Frauen sprachlich unsichtbar lässt.
Was untersucht die feministische Sprachwissenschaft?
Sie untersucht, wie sich soziale und psychologische Geschlechterrollen im Sprachsystem und Sprachgebrauch widerspiegeln und welche Auswirkungen dies auf die gesellschaftliche Gleichstellung hat.
Wie hängen thematische Rollen und Gender zusammen?
Geschlechtsinformationen können die Erwartungshaltung steuern, wer in einem Satz als Agens (Handelnder) oder Patiens (Betroffener) auftritt, was die Satzinterpretation beeinflusst.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Gender als Merkmal für Prominenz? Der Einfluss von Gender-Informationen im Sprachgebrauch auf die Satzinterpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492594