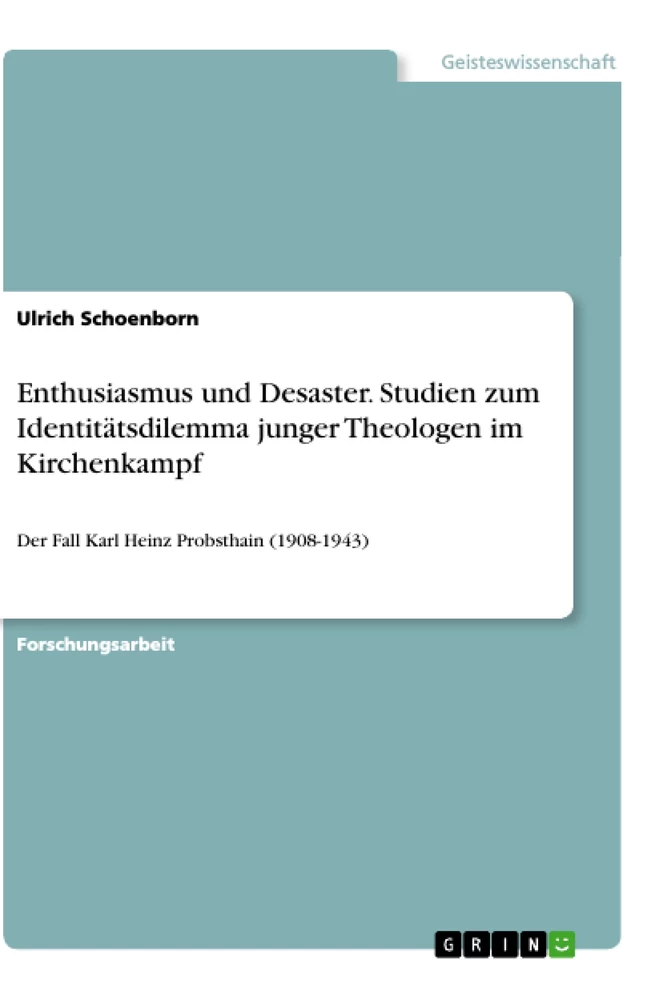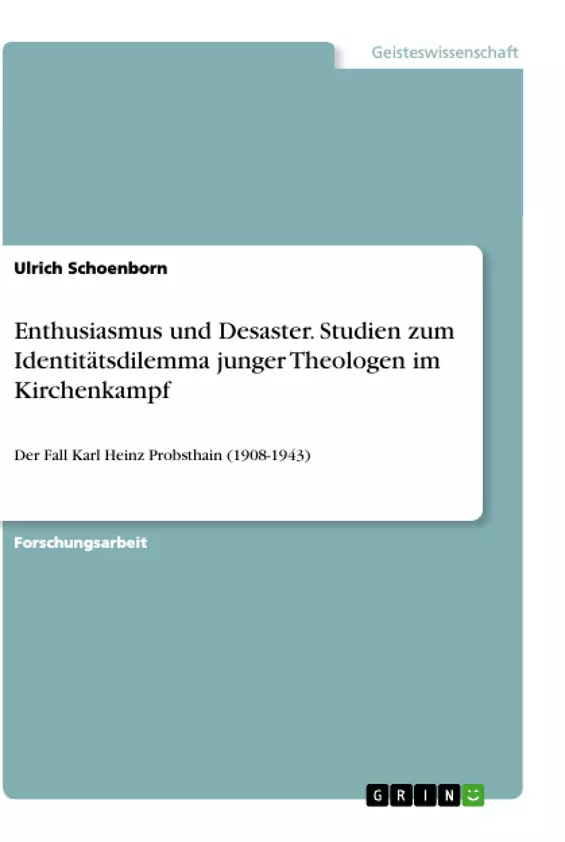In dieser historisch-theolgischen Studie wird die Situation der "Jungen Theologen" der Bekennenden Kirche zwischen politischer Ersatzreligion, kirchlicher Ambivalenz und aggressiver Glaubenszuversicht thematisiert. Exemplarischer Ausgangspunkt ist der Weg eines "renitenten" Vikars, der 1943 von einem NS-Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist.
Der weitgehend vergessene Theologe und Liederdichter Karl Heinz Probsthain gehörte unter anderem 1939/40 zu den Kandidaten im illegalen Predigerseminar Dietrich Bonhoeffers in Hinterpommern (Sigurdshof). Es war der letzte Kurs, in dem Bonhoeffer sein Verständnis von theologischer Existenz (Nachfolge-Paradigma) entfaltet hat, bevor die Gestapo eingriff. Wichtige Abschnitte aus Probsthains Leben konnten mit Hilfe von neuem Archiv-Material rekonstruiert werden. Ein Anhang mit exemplarischen Texten, Abbildungen und Zeitzeugnissen ermöglicht die kritische Begleitung der dargestellten Probleme und Vorgänge.
Hermeneutischer Angelpunkt der Studie sind Korrelation und Interaktion von individuellen Aspekten (Streben nach Identität und Anerkennung), sozio-kulturellen Faktoren (unter anderem jugendbewegte Aufbruchsdynamik; Ruf nach Entschiedenheit; Proklamation des Kairos; ideologisches Zwielicht der metaphorischen Sprache) und die Ambivalenzen in der protestantischen Widersetzlichkeit während des sogenannten Kirchenkampfes. Die Unvereinbarkeit von politischer Realität und existentieller Disposition führt zu tragischem Scheitern: Aufbruch ohne Ankunft.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Bekennende Kirche, Lehrende und Lernende auf dem „Weg“, theologische Existenz, der Ruf zum „Kampf“ und das Dilemma der Identitätskonstitution (13-51)
- 1. Kirchenkampf – Bekennende Kirche
- 2. Wer hat die Ausbildungshoheit?
- 3. Lehrende und Lernende auf dem „Weg“
- 3.1 Theologische Existenz heute!
- 3.2 Die Aufgabe der Theologie in der gegenwärtigen Situation
- 3.3 Die kirchliche Verantwortung des Theologiestudenten
- 3.4 Was soll der Student der Theologie heute tun?
- 4. Theologische Existenz
- 5. Der Ruf zum Kampf
- 6. Das Identitätsdilemma der „Jungen Theologen“
- 7. Der eschatologische Vorbehalt als Korrektiv
- 8. Anmerkung zu Quellenlage und Form der Darstellung
- I. Der unbekannte Karl Heinz Probsthain (53-58)
- II. Von Ostpreußen nach Westfalen (59-157)
- 1. Der familiäre Hintergrund in Goldap
- 2. Anfänge in Königsberg
- 3. Durchbruch in Kiel
- 4. Die Theologische Schule Bethel – Geistliches Zentrum der Kirchenprovinz Westfalen in der APU
- 4.1 Revolutionärer Aufbruch in Deutschland und die „Deutschen Christen“ in Westfalen
- 4.2 Offener Konflikt mit den „Deutschen Christen“
- 4.3 Der westfälische Sonderweg
- 4.4 Die Theologische Schule Bethel im „Dritten Reich“
- 5. Zwischen Dekret und Kompromiss – K.H.Probsthain und das Theologische Examen
- 6. Vikariat in Levern (1.9.1938 bis 4.11.1939)
- III. „Sigurdshof A“ – Das illegale Sammelvikariat in Hinterpommern 1939/ 1940 (159-204)
- 1. Vorbemerkung
- 2. Illegalität in Hinterpommern
- 3. Das Finkenwalder Modell
- 4. Die Amerika-Reise Bonhoeffers im Sommer 1939
- 4.1 Kirchenkampf auf dem Tiefpunkt
- 4.2 Krise und Entscheidung
- 4.3 „Protestantismus ohne Reformation“ – Geschichte und Gegenwartsdeutung im Amerika-Aufsatz
- IV. „Sigurdshof B“ – Schriftauslegung als Exercitium des Gehorsams gegen Gottes Wort (205-225)
- 1. Homiletische Grundlagen
- 2. Theologische Auslegung von Psalm 119
- 3. Der gute Hirte und die Seinen
- 3.1 Noch einmal: Kontroversen um die Legalisierung
- 3.2 Predigthilfe zu Johannes 10, 11-16
- V. „Sigurdshof C“ – Conformitas Christi (227-248)
- 1. Vorbemerkung
- 2. Briefe an die Brüder zu Hause und im Feld
- 3. Das Bild Jesu Christi
- 4. Die Wahrheit tun
- VI. Zwischen Kairos und Krisis - Protestantische Gestimmtheit (249-407)
- 1. Hermeneutische Rahmenbedingungen
- 1.1 Vorbemerkung
- 1.2 Der sozio-kulturelle Kontext: Jugendbewegung
- 1.3 Die „Singbewegung“ in der Evangelischen Kirche – Alfred Stier
- 2. Metaphysische Mobilmachung
- 2.1 „Deutscher Schwur“ – Rudolf Alexander Schröder
- 2.2 Absage an die religiös-kulturelle Welt (Friedrich Gogarten) – Wendung zum Völkischen (Paul Althaus)
- 2.3 Politischer Messianismus und nationale Verzauberung
- 2.4 Mahnende Stimmen
- 3. „Militia Christi“: das neue Lied in dunkler Zeit
- 3.1 In statu confessionis
- 3.2 Reformatorische Sachlichkeit – nicht Selbstinszenierung
- 3.3 „O König Jesu Christe“ – Verortung in Tradition und Frömmigkeit
- 4. „Weißt du, warum du mit uns gehst?“ – Bekenntnis- und Kampflieder der evangelischen Jugend
- 4.1 Vorbemerkung
- 4.2 „Sturmschritt der neuen Tage“ – Lieder von Horst Wesenberg
- 4.3 Zwischen Resonanz und Performativität
- 4.4 Motive und Metaphern im ideologischen Zwielicht
- 4.5 Die christologische Differenz
- 5. „Ecclesia militans“ – Lieder der „Bekennenden Kirche“
- 5.1 „Hier ist Geduld und Glaube“ – Otto Dibelius
- 5.2 „Wir sind die Bruderschaft der Not“ – Heinrich Vogel
- 5.3 „Der Herr ist unser Richter“ – Otto Riethmüller
- 5.4 „Es mag sein, dass alles fällt“ – Rudolf Alexander Schröder
- VII. Karl Heinz Probsthain – Trutzlieder (408-427)
- 1. Ein Bekenntnislied aus der Nordmark
- 2. Herold im Glaubenskrieg – Ausgewählte Beispiele
- 3. Erlösung durch „Entweltlichung“?
- VIII. Von der Einberufung bis zur Hinrichtung (1940-1943) (428-457)
- 1. Das erste Gerichtsverfahren
- 2. Das zweite Gerichtsverfahren
- 3. Identitätsdiffusion – Offene Fragen
- IX. Epilog: Aufbruch ohne Ankunft? (458-475)
- X. Anhang (476-595)
- I.: Biographische Daten – K.H.Probsthain
- II.: Resonanzsphären und Resonanzverhältnisse: Programmatische Ideen, Ereignisse, Persönlichkeiten auf dem Weg von K. H. Probsthain
- III.: Lieder von K. H. Probsthain: „Sola tui cordis spes sit crucifixus Christus“
- IV.: Abbildungen, Dokumente, Lieder, Texte
- V.: Abbildungen-Nachweis
- XI. Literatur (597-640)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Studie beleuchtet den Lebensweg des Theologen Karl Heinz Probsthain, der 1943 von der NS-Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Sie zeichnet seinen Weg von der ostpreußischen Kleinstadt Goldap über Königsberg und Kiel nach Bethel und Levern nach. Zentral steht dabei die Frage nach seiner theologischen Existenz in Zeiten des Kirchenkampfes und der nationalsozialistischen Diktatur. P.’s Entscheidung, sich der „Bekennenden Kirche“ anzuschließen und das Wagnis der „Renitenz“ auf sich zu nehmen, zeigt die komplexe Situation seiner Generation, die zwischen den Polen von Staat und Kirche, Glaube und Welt, Tradition und Moderne stand.
- Die Rolle der "Bekennenden Kirche" im Kirchenkampf und ihr Verhältnis zur NS-Ideologie
- Die Herausforderungen der Theologenausbildung im "Dritten Reich" und die Suche nach einem Weg der "theologischen Existenz"
- Die Ambivalenz von Glaube und Politik im Leben von Karl Heinz Probsthain
- Das Leitmotiv des "Kampfes" in der evangelischen Jugendbewegung und das Zusammenspiel von christlicher Tradition und nationalsozialistischer Ideologie
- Die Bedeutung von Liedern als Ausdruck von Bekenntnis und Widerstand in der "Bekennenden Kirche" und der evangelischen Jugendbewegung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel widmet sich der Person Karl Heinz Probsthain und stellt fest, dass er im Kontext der Bonhoeffer-Literatur bisher unbekannt war. Die spärlichen Informationen über sein Leben werden zusammengefasst und Fragen zu seiner Biographie aufgeworfen.
Kapitel II. zeichnet Probsthains Werdegang von Goldap über Königsberg, Kiel nach Bethel nach. Es werden die sozio-kulturellen und politischen Bedingungen seiner Jugendzeit in Ostpreußen und der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. Außerdem wird ein Einblick in die universitären und kirchenpolitischen Diskurse in Königsberg und Kiel gegeben. Die Theologische Schule Bethel wird als ein Zentrum des Widerstandes gegen die Deutschen Christen vorgestellt.
Kapitel III. widmet sich dem illegalen Sammelvikariat Sigurdshof, in dem sich Karl Heinz Probsthain zwischen 1939 und 1940 unter der Leitung Dietrich Bonhoeffers auf seinen Pfarrdienst vorbereitete. Bonhoeffers Amerika-Reise wird im Kontext der aktuellen Kirchenkampf-Situation und dem beginnenden Zweiten Weltkriegs besprochen.
Kapitel IV. erläutert, wie Bonhoeffer in den Jahren 1935-1940 das Predigerseminar Finkenwalde und später die Sammelvikariate leitete. Es werden die homiletischen und exegetischen Grundlagen seiner Arbeit und die Rolle der Bibel im Lebensvollzug seiner Schüler aufgezeigt. Die Auslegung von Psalm 119 und die Predigthilfe zu Johannes 10, 11-16 bieten einen Einblick in Bonhoeffers theologisches Denken in dieser Zeit. Außerdem wird auf die Legalisierungsdiskussion innerhalb der „Bekennenden Kirche“ eingegangen.
Kapitel V. thematisiert die „Conformitas Christi“ in Briefen, die Bonhoeffer an seine Schüler während der Kriegszeit schrieb. Die Bedeutung des Bildes Christi für die Gestaltung theologischer Existenz im „status confessionis“ wird anhand von Bonhoeffers Ausführungen erläutert. Es wird gezeigt, wie die „Bekennende Kirche“ sich im ideologischen Kampf gegen den Nationalsozialismus positionierte. Der Amerika-Aufsatz von Bonhoeffer wird als Beleg für seine christozentrische Grundüberzeugung und seine Kritik am amerikanischen Protestantismus im Kontext der Zeit herangezogen.
Kapitel VI. geht der Frage nach, wie die evangelische Jugendbewegung und das „neue Lied“ im Kontext von „Militia Christi“ auf die Herausforderungen der Epoche reagierten. Die „Singbewegung“, der Wandervogel, die „Neupfadfinder“ und die Christliche Pfadfinderschaft werden als wichtige Akteure in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vorgestellt. Die Liedtexte von Horst Wesenberg werden exemplarisch für das Selbstverständnis der evangelischen Jugendbewegung analysiert. Es folgt eine Darstellung von Liedern aus der „Bekennenden Kirche“, die den Protest gegen die nationalsozialistische Ideologie in den Vordergrund stellen. Es werden u.a. Lieder von Otto Dibelius, Heinrich Vogel, Otto Riethmüller und Rudolf Alexander Schröder besprochen.
Kapitel VII. beleuchtet die Liedtexte von Karl Heinz Probsthain. Es wird deutlich, wie seine Texte von der „Bekennenden Kirche“ und der „Militia Christi“-Tradition geprägt sind. Probsthains „Trutzlieder“ werden exemplarisch für die singende Opposition innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland interpretiert.
Kapitel VIII. schildert den Lebensweg Karl Heinz Probsthains nach seiner Einberufung zur Kriegsmarine und die Gerichtsverfahren, die zu seiner Verurteilung und Hinrichtung führten. Es wird deutlich, wie stark er in den Mechanismen der NS-Militärjustiz gefangen war. Der „Fall Probsthain“ steht exemplarisch für die Erfahrungen von Menschen, die in der nationalsozialistischen Diktatur gefangen waren.
Kapitel IX. ist dem Thema „Aufbruch ohne Ankunft“ gewidmet. Die Parabel „Der Aufbruch“ von Franz Kafka wird als metaphorischer Reflex der generationellen Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg interpretiert. Der Epilog stellt die Herausforderungen des „Dritten Reiches“ und der „Bekennenden Kirche“ in den Kontext der „Ambivalenz“ und zeigt die schwierige Suche nach Selbstbestimmung und Orientierung in dieser Zeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der komplexen Geschichte der „Bekennenden Kirche“ im „Dritten Reich“. Sie beleuchtet den Weg eines „Jungen Theologen“ und seine Suche nach „theologischer Existenz“ im Spannungsfeld von „Christentum“ und „Nationalsozialismus“. Zentrale Themen sind „Widerstand“, „Bekenntnis“, „Kirche“, „Lied“, „Jugendbewegung“, „Männerbund“, „‚militia Christi‘“, „eschatologischer Vorbehalt“, „Erlösung“, „Entweltlichung“ und „Ambivalenz“.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Karl Heinz Probsthain?
Ein weitgehend vergessener Theologe und Liederdichter der Bekennenden Kirche, der 1943 von einem NS-Militärgericht hingerichtet wurde.
Welche Verbindung bestand zwischen Probsthain und Dietrich Bonhoeffer?
Probsthain war 1939/40 Kandidat im illegalen Predigerseminar von Dietrich Bonhoeffer im hinterpommerschen Sigurdshof.
Was thematisiert die Studie zum "Identitätsdilemma"?
Sie untersucht die Situation junger Theologen zwischen politischer Ersatzreligion, kirchlicher Ambivalenz und aggressivem Glaubensgehorsam während des Kirchenkampfes.
Welche Rolle spielten Lieder in der Bekennenden Kirche?
Lieder dienten als Ausdruck von Bekenntnis, Widerstand und "singender Opposition" gegen die nationalsozialistische Ideologie.
Was war die "Theologische Schule Bethel"?
Ein geistliches Zentrum, das als Ort des Widerstandes gegen die "Deutschen Christen" fungierte und in Probsthains Werdegang eine wichtige Rolle spielte.
Warum wird der Lebensweg als "Aufbruch ohne Ankunft" bezeichnet?
Weil die Unvereinbarkeit von politischer Realität und existentieller Disposition für viele junge Theologen zum tragischen Scheitern führte.
- Quote paper
- Prof. Dr. Ulrich Schoenborn (Author), 2019, Enthusiasmus und Desaster. Studien zum Identitätsdilemma junger Theologen im Kirchenkampf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492647