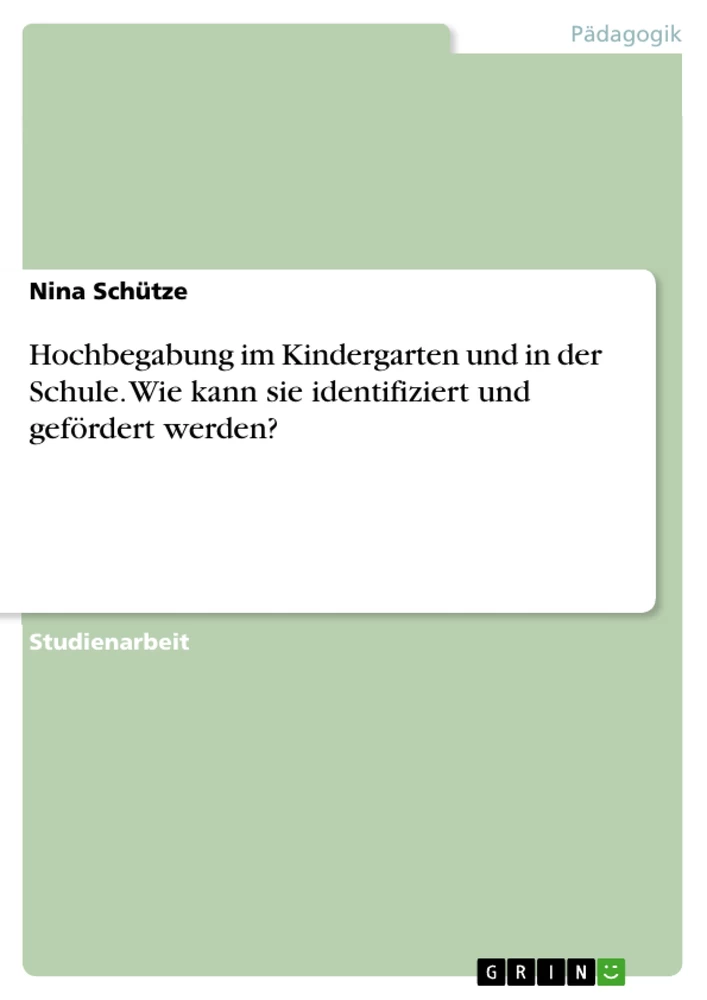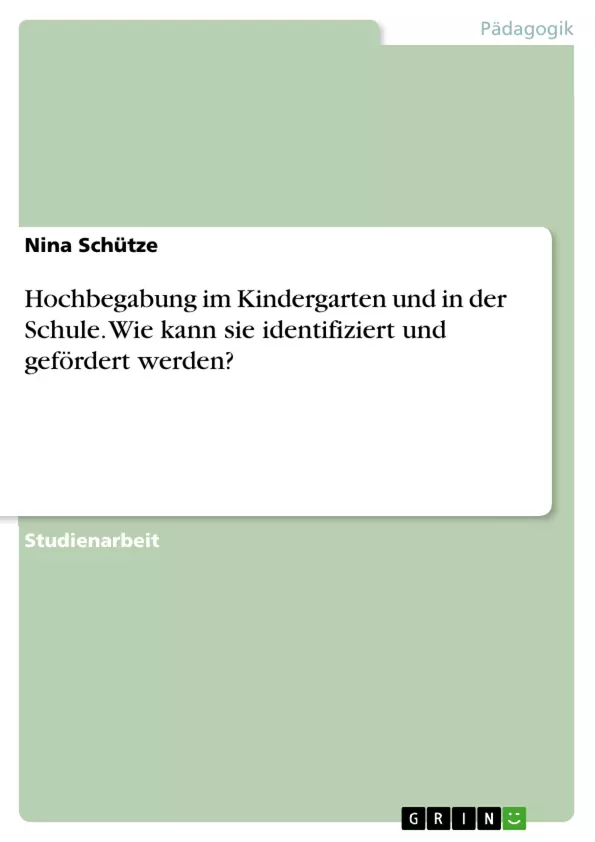Um zu einer optimalen Förderung für hochbegabte Kinder zu gelangen, müssen zunächst einige Fragen geklärt werden. Es muss definiert werden, was der Begriff Hochbegabung meint, da dies die Grundlage für diagnostische Prozesse bildet. Außerdem muss geklärt werden, welche Möglichkeiten der Diagnostik und Identifizierung von Hochbegabung vorhanden sind, um hochbegabte Kinder bestimmen zu können. Schließlich ist es wichtig, verschiedene Möglichkeiten der Förderung von hochbegabten Kindern zu kennen, damit eine individuell auf das Kind ausgerichtete Förderung möglich wird. Diesen Fragen soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden.
Heterogenität ist ein Thema, das in Schule und Kindergarten zum Alltag gehört. Kinder sind unterschiedlich in ihrer Herkunft, ihrer Reife, ihren Interessen – und auch in ihren Begabungen. Hochbegabung ist ein Extrem, das auftreten kann. Etwa 2% aller Kinder können als kognitiv hochbegabt angenommen werden. Damit wird jede Lehrkraft und jeder Erzieher in seiner Berufslaufbahn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Thema konfrontiert werden. Trotzdem wird Hochbegabung im Rahmen der Ausbildung höchstens am Rande thematisiert.
Im ersten Abschnitt soll zunächst geklärt werden, wie Hochbegabung definiert wird und welche Formen der Hochbegabung es gibt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich dann mit der Identifizierung von hochbegabten Kindern in der Schule und im Kindergarten. Dazu werden zuerst einige beobachtbare Hinweise auf eine Hochbegabung benannt und dann wird das Thema Underachievement näher beleuchtet, da es hier besonders schwierig ist, eine Hochbegabung festzustellen. Außerdem wird auf die Diagnostik bei Hochbegabung eingegangen. Das nächste Kapitel erläutert dann Fördermöglichkeiten bei Hochbegabung im Allgemeinen und bei Underachievement im Speziellen. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, indem noch einmal auf Schwierigkeiten und Besonderheiten bei der Identifizierung und Förderung von Hochbegabten eingegangen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Hochbegabung
- 3. Erkennen von Hochbegabten
- 3.1 Identifikation von Hochbegabten
- 3.2 Underachievement
- 3.3 Diagnostik bei einer vermuteten Hochbegabung
- 4. Fördermöglichkeiten bei Hochbegabung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Identifizierung und Förderung von Hochbegabung im Kindergarten und in der Schule. Sie zielt darauf ab, die Definition von Hochbegabung zu klären, Methoden zur Identifizierung hochbegabter Kinder zu beschreiben und verschiedene Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Phänomen des Underachievement.
- Definition von Hochbegabung und ihre verschiedenen Ausprägungen
- Identifizierung von Hochbegabung, inklusive der Herausforderungen durch Underachievement
- Diagnostische Verfahren zur Feststellung von Hochbegabung
- Geeignete Fördermaßnahmen für hochbegabte Kinder
- Die Bedeutung individueller Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Hochbegabung ein und betont die Heterogenität in Kindergärten und Schulen. Sie hebt die Relevanz des Themas für Erzieher und Lehrkräfte hervor und verweist auf das Problem des Underachievement, bei dem Leistungen und Potenzial deutlich voneinander abweichen. Die Arbeit benennt zentrale Forschungsfragen: Definition von Hochbegabung, Identifizierungsmöglichkeiten und geeignete Förderansätze.
2. Definition von Hochbegabung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Hochbegabung. Es diskutiert die Zusammenhänge zwischen Veranlagung, Umweltfaktoren und der Ausprägung kognitiver Fähigkeiten. Der Intelligenzquotient (IQ) als Messinstrument wird erläutert, jedoch wird auch kritisch auf die eingeschränkte Perspektive einer rein kognitiven Betrachtungsweise hingewiesen. Verschiedene Modelle der Hochbegabung, einschließlich nicht-kognitiver Aspekte, werden angesprochen, um ein umfassenderes Verständnis zu fördern. Der Fokus liegt jedoch auf der kognitiven Hochbegabung im Rahmen dieser Arbeit.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Identifizierung, Förderung, Underachievement, Diagnostik, Intelligenz, kognitiv, nicht-kognitiv, individuelle Förderung, Kindergarten, Schule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Identifizierung und Förderung von Hochbegabung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Identifizierung und Förderung von Hochbegabung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Identifizierung hochbegabter Kinder im Kindergarten und in der Schule, mit besonderem Augenmerk auf das Phänomen des Underachievement (Unterschleidung).
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Einleitung, Definition von Hochbegabung, Erkennen von Hochbegabten (inkl. Identifikation, Underachievement und Diagnostik), Fördermöglichkeiten bei Hochbegabung und Fazit. Jeder Abschnitt wird kurz zusammengefasst.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Definition von Hochbegabung (inkl. Diskussion des IQ und nicht-kognitiver Aspekte), die Identifizierung hochbegabter Kinder (inkl. Herausforderungen durch Underachievement), die Diagnostik von Hochbegabung und geeignete Fördermaßnahmen. Die Bedeutung individueller Förderung wird ebenfalls hervorgehoben.
Was ist Underachievement?
Underachievement beschreibt die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Leistungsniveau eines hochbegabten Kindes und seinem Potenzial. Das Dokument betont die Bedeutung der Erkennung und Bewältigung dieses Problems.
Wie wird Hochbegabung definiert?
Das Dokument diskutiert verschiedene Definitionen von Hochbegabung, betont die Rolle von Veranlagung und Umweltfaktoren und erläutert den Intelligenzquotienten (IQ) als Messinstrument. Es weist aber auch auf die Grenzen einer rein kognitiven Betrachtungsweise hin und berücksichtigt nicht-kognitive Aspekte.
Welche Methoden zur Identifizierung von Hochbegabten werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt Methoden zur Identifizierung von Hochbegabung, ohne jedoch konkrete Verfahren im Detail zu benennen. Es wird aber auf die Herausforderungen durch Underachievement hingewiesen und die Notwendigkeit einer gründlichen Diagnostik betont.
Welche Fördermöglichkeiten werden vorgestellt?
Das Dokument benennt verschiedene Fördermöglichkeiten für hochbegabte Kinder, ohne diese im Detail zu erläutern. Die Bedeutung individueller Förderung wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Hochbegabung, Identifizierung, Förderung, Underachievement, Diagnostik, Intelligenz, kognitiv, nicht-kognitiv, individuelle Förderung, Kindergarten, Schule.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Erzieher, Lehrer, Eltern und alle, die sich mit der Identifizierung und Förderung von Hochbegabung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Nina Schütze (Author), 2017, Hochbegabung im Kindergarten und in der Schule. Wie kann sie identifiziert und gefördert werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492672