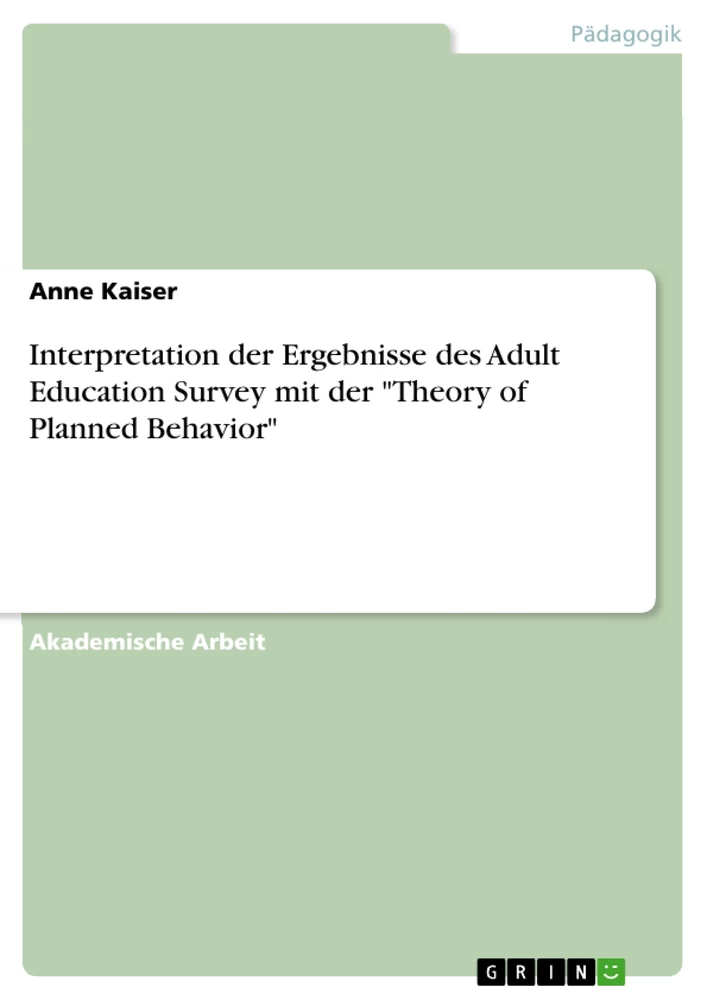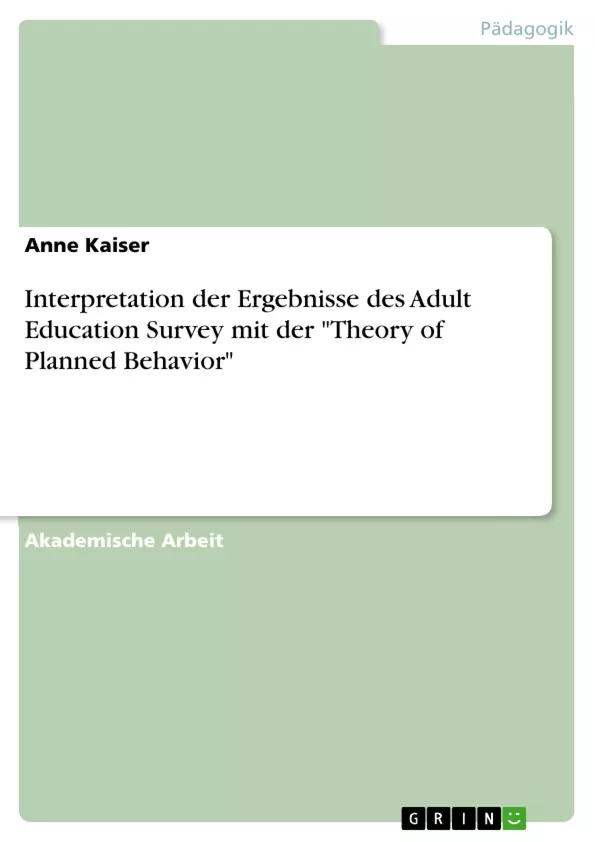Die Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener ist durch den Adult Education Survey (AES) bereits sehr gut dokumentiert. Demnach haben aktuell 50% der Erwachsene (zwischen 18 und 64 Jahren) an Weiterbildung teilgenommen (vgl. Bilger et al. 2017). Neben der tatsächlichen Teilnahme fragt die Erhebung auch nach Weiterbildungsbarrieren und Motiven nicht an einer Weiterbildung teilzunehmen. Untersuchungen über das Zustandekommen eines solchen Verhaltens aus Sicht der Erwachsenenbildung, speziell aus der Weiterbildung gibt es dabei wenige. Eine der wenigen Studien ist von Reich-Claassen, sie ergründet in einer qualitativ-explorativen Untersuchung das Zustandekommen von erwartungswidrigen Weiterbildungsverhalten (vgl. Reich-Claassen 2010). Sie überträgt dabei mehrere Theorien der Partizipationsforschung auf die Erwachsenen-/Weiterbildungsforschung. Darunter auch die „Theory of Reasoned Action“ (TRA) bzw ihre Erweiterung „Theory of Planned Behavior“ (TPB). Diese Hausarbeit möchte daran anknüpfen und die Theorie als Grundlage für die Interpretation von Befragungsergebnissen des AES aus dem Jahr 2012 nutzen. Die Befragung handelt um Nicht-Teilnahme an Weiterbildung von Teilnahmeinteressierten. Konkret wird sich die Hausarbeit der Frage widmen, wie sich diese Befragungsergebnisse des Adult Education Survey mit der „Theory of Planned Behavior“ interpretieren lassen und wie die Ergebnisse für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung genutzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Adressaten- Teilnehmer- und Zielgruppenforschung
- Theorien zur Erklärung des Weiterbildungsverhaltens
- ausgewählte Modelle aus der Partizipationsforschung
- Theory of Reasoned Action/ Theory of Planned Behavior
- Interpretation der AES-Ergebnisse mit der Theory of Planned Behavior
- Weiterbildungsbeteiligung im Adult Education Survey
- Befragungsergebnisse des AES und ihre Interpretation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener anhand von Daten des Adult Education Survey (AES) und interpretiert diese Ergebnisse mit der Theory of Planned Behavior (TPB). Ziel ist es, die Nicht-Teilnahme an Weiterbildung bei interessierten Personen zu verstehen und die Ergebnisse für die Praxis der Erwachsenenbildung nutzbar zu machen. Die besondere Rolle der "wahrgenommenen Verhaltenskontrolle" innerhalb der TPB steht dabei im Fokus.
- Analyse der Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener in Deutschland
- Anwendung der Theory of Planned Behavior auf die Interpretation von AES-Daten
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Weiterbildungsentscheidung
- Bedeutung der "wahrgenommenen Verhaltenskontrolle" für die Weiterbildungsbeteiligung
- Praktische Implikationen für die Erwachsenenbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener ein und stellt den Adult Education Survey (AES) als wichtige Datenquelle vor. Sie begründet die Wahl der Theory of Planned Behavior (TPB) als theoretisches Rahmenmodell zur Interpretation der AES-Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Nicht-Teilnahme von Weiterbildungsinteressierten. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Verhaltens anhand der TPB und deren Anwendung auf die empirischen Daten des AES. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
Adressaten- Teilnehmer- und Zielgruppenforschung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Forschungsbereiche der Erwachsenen- und Weiterbildung, mit besonderem Fokus auf die Adressaten-, Teilnehmer- und Zielgruppenforschung. Es differenziert die Begriffe Adressaten, Zielgruppen und Teilnehmende und erläutert ihre Bedeutung für die makrodidaktische und mikrodidaktische Planung. Der Bezug zu historischen Studien wie den „Hildesheimer“, „Göttinger“ und „Oldenburger Studien“ wird hergestellt, um die Entwicklung des Forschungsinteresses an der (Nicht-)Teilnahme an Weiterbildung zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf der Adressatenforschung als Grundlage für die Anwendung der TPB.
Theorien zur Erklärung des Weiterbildungsverhaltens: Dieses Kapitel diskutiert die verschiedenen Theorien, die zur Erklärung des Weiterbildungsverhaltens herangezogen werden, mit besonderem Fokus auf Theorien aus der Motivationspsychologie und Soziologie. Es wird hervorgehoben, dass es keine eigenständige erwachsenenpädagogische Theorie gibt, sondern dass Theorien aus dem angloamerikanischen Raum, insbesondere aus der Partizipationsforschung, adaptiert werden. Die "Theory of Reasoned Action" (TRA) und ihre Erweiterung, die "Theory of Planned Behavior" (TPB), werden als besonders relevante Modelle vorgestellt.
Schlüsselwörter
Adult Education Survey (AES), Theory of Planned Behavior (TPB), Weiterbildungsbeteiligung, Erwachsenenbildung, Weiterbildungsmotivation, Verhaltensabsicht, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Adressatenforschung, Teilnehmendenforschung, Zielgruppenforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener im Lichte des Adult Education Survey (AES) und der Theory of Planned Behavior (TPB)
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener in Deutschland. Sie analysiert Daten des Adult Education Survey (AES) und interpretiert diese mithilfe der Theory of Planned Behavior (TPB). Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verständnis der Nicht-Teilnahme an Weiterbildung bei interessierten Personen und der Ableitung praktischer Implikationen für die Erwachsenenbildung.
Welche Daten werden verwendet?
Die Grundlage der Arbeit bilden Daten des Adult Education Survey (AES), einer wichtigen Datenquelle zur Weiterbildungsbeteiligung Erwachsener.
Welches theoretische Modell wird angewendet?
Die Theory of Planned Behavior (TPB) dient als theoretisches Rahmenmodell zur Interpretation der AES-Daten. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der "wahrgenommenen Verhaltenskontrolle" als Einflussfaktor.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Einflussfaktoren auf die Weiterbildungsentscheidung Erwachsener, die Bedeutung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle für die Teilnahme und leitet daraus praktische Implikationen für die Erwachsenenbildung ab.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Adressaten-, Teilnehmer- und Zielgruppenforschung, Kapitel zu Theorien zur Erklärung des Weiterbildungsverhaltens (mit Fokus auf TPB und TRA), ein Kapitel zur Interpretation der AES-Ergebnisse im Lichte der TPB und einen Schluss.
Welche Theorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zur Erklärung des Weiterbildungsverhaltens, insbesondere Modelle aus der Partizipationsforschung, die Theory of Reasoned Action (TRA) und die Theory of Planned Behavior (TPB).
Welche Bedeutung hat die "wahrgenommene Verhaltenskontrolle"?
Die "wahrgenommene Verhaltenskontrolle" spielt innerhalb der TPB eine zentrale Rolle und wird in der Hausarbeit im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Weiterbildungsbeteiligung untersucht.
Welche praktischen Implikationen werden abgeleitet?
Die Arbeit leitet aus den Ergebnissen praktische Implikationen für die Gestaltung und Planung von Weiterbildungsmaßnahmen in der Erwachsenenbildung ab.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Relevante Schlüsselbegriffe sind: Adult Education Survey (AES), Theory of Planned Behavior (TPB), Weiterbildungsbeteiligung, Erwachsenenbildung, Weiterbildungsmotivation, Verhaltensabsicht, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Adressatenforschung, Teilnehmendenforschung, Zielgruppenforschung.
- Quote paper
- Anne Kaiser (Author), 2018, Interpretation der Ergebnisse des Adult Education Survey mit der "Theory of Planned Behavior", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493060