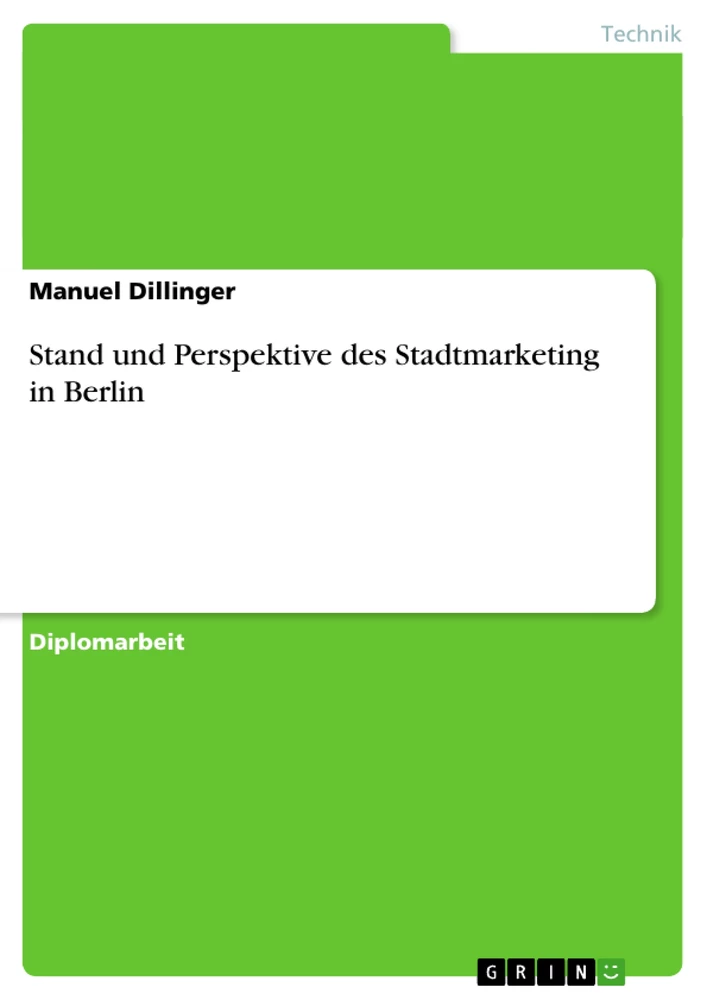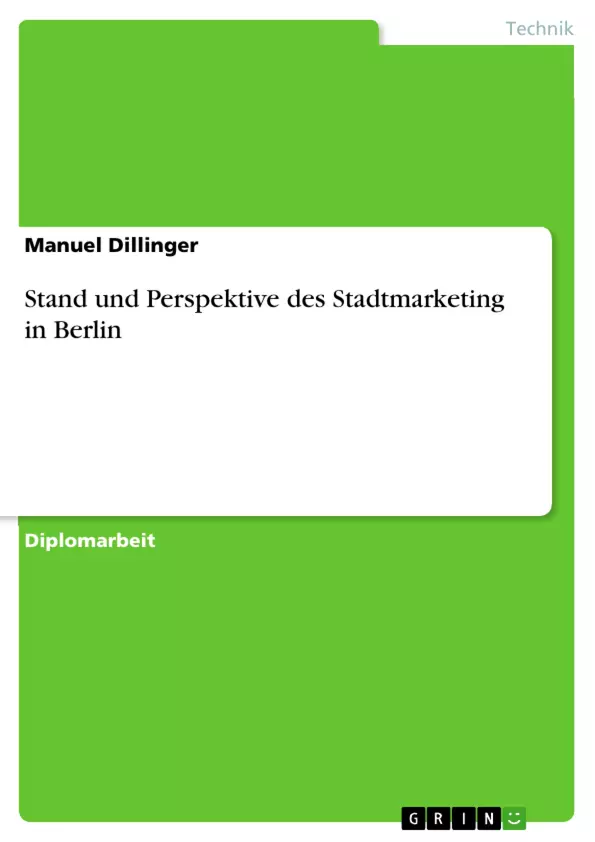VORWORT
Die wirtschaftliche Situation Berlins hat sich nach der deutschen Wiedervereinigung 1989 grundlegend verändert. Während in der Vergangenheit fehlende Steuereinnahmen durch Bundeshilfe im Rahmen der Berlin-Förderung kompensiert wurden, zeigten sich schon wenige Jahre nach der deutschen Einheit die strukturellen Probleme der Berliner Wirtschaft.
Die geringe Wirtschafts- und Steuerkraft und in Folge eine hohe Arbeitslosigkeit und Verschuldung sind heute kennzeichnend für den Standort Berlin. Die Ursache dafür ist in der Strukturschwäche der Berliner Wirtschaft, als Erbe aus der 40-jährigen Teilung der Stadt zu finden. Das Image Berlins als Wirtschaftsstandort ist unbefriedigend, die Unternehmensansiedlungen zu gering und die Zahl der Einwohner sogar sinkend.
Die dringend notwendige Verbesserung der Wirtschafts- und Steuerkraft Berlins ist neben der Bestandswahrung und -pflege jedoch nur durch die Akquisition neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland zu realisieren. Dies erfordert umfassende Maßnahmen, die zum Ziel haben müssen, die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern, und im zunehmenden Standortwettbewerb um mobile und finanzstarke Einwohner und Unternehmen, die Attraktivität Berlins gegenüber vergleichbaren Städten und Regionen zu steigern. „Klassische“ kommunale Maßnahmen zur Verbesserung der Standortqualitäten stoßen hier an ihre Wirkungsgrenzen.
Im Verlauf der vorliegenden Arbeit soll Stadtmarketing als ergänzendes Instrument einer umfassenden Standortaufwertung untersucht werden. Ziel der Arbeit ist es, das Prinzip eines erfolgreichen Stadtmarketingprozesses zu verdeutlichen, in dessen Verlauf die endogenen Potentiale Berlins aktiviert und in einem Leitbild gebündelt werden, mit der Absicht, die Herausbildung einer starken Identität der Stadt zu fördern.
Berlin braucht ein Image, ein Markenzeichen, das Menschen und Unternehmen anspricht und das Interesse für die Hauptstadt weckt. Auf diese Weise kann eine neue wirtschaftliche Basis in der Stadt entstehen und den notwendigen Spielraum für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung schaffen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- KAPITEL I - Gang der Arbeit
- 1.1 Gliederung
- 1.2 Roter Faden
- 1.3 Fokus
- 1.4 Bibliographische Erläuterungen
- KAPITEL II - Die Stadtentwicklung Berlins
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Die wirtschaftliche Entwicklung Berlins
- 2.2.1 Berliner Realität - Arbeitslosigkeit und Einwohnerschwund
- 2.2.2 Strukturelle Probleme der Berliner Wirtschaft
- 2.3 Die ökonomischen Rahmenbedingungen
- 2.3.1 Wirtschaftlicher Strukturwandel
- 2.3.2 Europäischer Binnenmarkt
- 2.3.3 Globalisierung
- 2.4 Die Ubiquität von Standorten
- 2.4.1 Das Ende der Stadt?
- 2.4.2 Zentrenbildung
- 2.4.2.1 Global Cities
- 2.4.2.2 Fühlungs- und Agglomerationsvorteile
- 2.5 Gesellschaftliche Veränderungen
- 2.5.1 Wertewandel
- 2.5.2 Demographische Entwicklung
- 2.6 Wandel der politischen Aufgaben
- 2.7 Public-Private Partnership
- 2.8 Fokus
- 2.9 Roter Faden
- KAPITEL III - Kommunale Handlungsmöglichkeiten
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Kommunale Maßnahmen zur Stärkung der Standortbedingungen
- 3.3 „Harte“ Standortfaktoren
- 3.3.1 Input-bezogene Standortfaktoren
- 3.3.2 Throughput-bezogene Standortfaktoren
- 3.3.3 Output-bezogene Standortfaktoren
- 3.4 „Weiche“ Standortfaktoren
- 3.5 „Harte“ und „Weiche“ Standortfaktoren
- 3.6 Fokus
- 3.7 Roter Faden
- KAPITEL IV - Stadtmarketing in Berlin
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Stadtmarketing in Berlin
- 4.2.1 Stadtmarketing - Wege aus der Krise
- 4.2.2 Das Unternehmen „Stadt“
- 4.3 Basiswissen
- 4.3.1 Basiswissen Marketing
- 4.3.2 Basiswissen Stadtmarketing
- 4.3.3 Unterschiede zwischen Marketing und Stadtmarketing
- 4.3.4 Das Stadtmarketing-Mix-Instrumentarium
- 4.3.5 Der Verlauf eines Stadtmarketingprozesses
- 4.4 Die Konzeptphase – Stärken/Schwächen-Analyse
- 4.4.1 Ergebnis der „harten“ Stärken/Schwächen-Analyse
- 4.4.2 Ergebnis der „weichen“ Stärken/Schwächen-Analyse
- 4.5 Die Konkretisierungsphase - Visionen und Ziele
- 4.5.1 Initial- und Folgefunktionen
- 4.5.1.1 Initialfunktionen in Berlin
- 4.6 Die Realisierungsphase
- 4.6.1 Die Akteure des Berliner Stadtmarketing
- 4.6.2 Struktur des Berliner Stadtmarketing - Bewertung
- 4.7 Erfolgsfaktor Stadtmarketing
- 4.8 Fokus
- 4.9 Roter Faden
- KAPITEL V - Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Das Leitbild: Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation
- 5.2.1 Vorsprung durch Technik und Wissenschaft
- 5.2.2 Standortfaktor Humankapital
- 5.3 Die Strategie: Schaffung eines Kompetenzzentrums
- 5.3.1 Technologie- und Gründerzentren
- 5.3.2 Informations- und Kommunikationstechnik
- 5.4 Berliner Innovations- und Technologiepolitik
- 5.4.1 Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin
- 5.4.2 Beitrag der Stadtmarketinggesellschaften
- 5.5 Stadt der Wissenschaften - Entwicklungsperspektiven
- 5.6 Fokus
- 5.7 Roter Knoten - Zusammenfassung
- 5.8 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Stadtmarketing als Instrument zur Standortaufwertung Berlins. Ziel ist es, das Prinzip eines erfolgreichen Stadtmarketingprozesses zu erläutern und aufzuzeigen, wie die Potentiale Berlins aktiviert und in einem Leitbild gebündelt werden können, um eine starke städtische Identität zu fördern.
- Die wirtschaftliche Situation Berlins nach der Wiedervereinigung
- Kommunale Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der Standortbedingungen
- Stadtmarketing als ergänzendes Instrument der Standortaufwertung
- Analyse des Berliner Stadtmarketingprozesses
- Berlin als Stadt der Wissenschaft und Innovation
Zusammenfassung der Kapitel
KAPITEL II - Die Stadtentwicklung Berlins: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Berlins nach der Wiedervereinigung, beleuchtet die strukturellen Probleme der Berliner Wirtschaft, wie hohe Arbeitslosigkeit und Einwohnerschwund, und untersucht die ökonomischen Rahmenbedingungen wie den europäischen Binnenmarkt und die Globalisierung. Es werden die Herausforderungen der Ubiquität von Standorten und der damit verbundenen Zentrenbildung sowie gesellschaftliche Veränderungen und der Wandel der politischen Aufgaben diskutiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Faktoren, die die Stadtentwicklung Berlins beeinflussen und die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur Standortsicherung verdeutlichen.
KAPITEL III - Kommunale Handlungsmöglichkeiten: Das Kapitel befasst sich mit kommunalen Maßnahmen zur Stärkung der Standortbedingungen Berlins. Es differenziert zwischen „harten“ Standortfaktoren (Input-, Throughput- und Output-orientiert) und „weichen“ Standortfaktoren wie Kultur und Tourismus. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Instrumente, die die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Attraktivität Berlins einsetzen kann, und verdeutlicht die Notwendigkeit einer integrierten Betrachtung von harten und weichen Faktoren für einen erfolgreichen Standortwettbewerb.
KAPITEL IV - Stadtmarketing in Berlin: Dieses Kapitel analysiert das Stadtmarketing in Berlin als Strategie zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen. Es erläutert die Grundlagen des Marketings und des Stadtmarketings und untersucht den Stadtmarketing-Mix und den Prozessverlauf. Die Analyse konzentriert sich auf die Konzeptphase (Stärken-/Schwächen-Analyse), die Konkretisierungsphase (Visionen und Ziele) und die Realisierungsphase (Akteure und deren Rolle). Das Kapitel bewertet die Struktur des Berliner Stadtmarketings und identifiziert Erfolgsfaktoren.
KAPITEL V - Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Leitbild „Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation“. Es untersucht Strategien zur Schaffung eines Kompetenzzentrums, die Rolle von Technologie- und Gründerzentren, und die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnik. Die Analyse beleuchtet die Berliner Innovations- und Technologiepolitik sowie die Beiträge der Stadtmarketinggesellschaften und skizziert Entwicklungsperspektiven für Berlin als Wissenschaftsstandort.
Schlüsselwörter
Stadtmarketing, Berlin, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Standortwettbewerb, Innovation, Wissenschaft, Kompetenzzentrum, Globalisierung, Humankapital, Leitbild, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Stadtmarketing in Berlin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Stadtmarketing als Instrument zur Standortaufwertung Berlins. Das Ziel ist es, das Prinzip eines erfolgreichen Stadtmarketingprozesses zu erläutern und aufzuzeigen, wie die Potentiale Berlins aktiviert und in einem Leitbild gebündelt werden können, um eine starke städtische Identität zu fördern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die wirtschaftliche Situation Berlins nach der Wiedervereinigung, kommunale Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der Standortbedingungen, Stadtmarketing als ergänzendes Instrument der Standortaufwertung, eine Analyse des Berliner Stadtmarketingprozesses und Berlin als Stadt der Wissenschaft und Innovation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel II analysiert die Stadtentwicklung Berlins, Kapitel III behandelt kommunale Handlungsmöglichkeiten, Kapitel IV das Stadtmarketing in Berlin, und Kapitel V Berlin als Stadt der Wissenschaft und Innovation. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung und endet mit einem Fokus/roten Faden und einer Zusammenfassung. Zusätzlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel II „Die Stadtentwicklung Berlins“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Berlins nach der Wiedervereinigung, beleuchtet strukturelle Probleme wie Arbeitslosigkeit und Einwohnerschwund, und untersucht ökonomische Rahmenbedingungen wie den europäischen Binnenmarkt und die Globalisierung. Es diskutiert Herausforderungen der Ubiquität von Standorten, Zentrenbildung, gesellschaftliche Veränderungen und den Wandel politischer Aufgaben. Der Fokus liegt auf der Analyse komplexer Faktoren, die die Stadtentwicklung beeinflussen und die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur Standortsicherung verdeutlichen.
Was wird im Kapitel III „Kommunale Handlungsmöglichkeiten“ behandelt?
Kapitel III befasst sich mit kommunalen Maßnahmen zur Stärkung der Standortbedingungen. Es unterscheidet zwischen „harten“ Standortfaktoren (Input-, Throughput- und Output-orientiert) und „weichen“ Faktoren wie Kultur und Tourismus. Die Analyse beleuchtet Instrumente zur Verbesserung der Attraktivität Berlins und verdeutlicht die Notwendigkeit einer integrierten Betrachtung beider Faktoren für erfolgreichen Standortwettbewerb.
Was wird im Kapitel IV „Stadtmarketing in Berlin“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Stadtmarketing als Strategie zur Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen. Es erläutert die Grundlagen von Marketing und Stadtmarketing, untersucht den Stadtmarketing-Mix und den Prozessverlauf. Die Analyse konzentriert sich auf die Konzeptphase (Stärken-/Schwächen-Analyse), die Konkretisierungsphase (Visionen und Ziele) und die Realisierungsphase (Akteure und deren Rolle). Das Kapitel bewertet die Struktur des Berliner Stadtmarketings und identifiziert Erfolgsfaktoren.
Was wird im Kapitel V „Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation“ behandelt?
Kapitel V fokussiert auf das Leitbild „Berlin, Stadt der Wissenschaft und Innovation“. Es untersucht Strategien zur Schaffung eines Kompetenzzentrums, die Rolle von Technologie- und Gründerzentren, und die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnik. Die Analyse beleuchtet die Berliner Innovations- und Technologiepolitik, die Beiträge der Stadtmarketinggesellschaften und skizziert Entwicklungsperspektiven für Berlin als Wissenschaftsstandort.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stadtmarketing, Berlin, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Standortwettbewerb, Innovation, Wissenschaft, Kompetenzzentrum, Globalisierung, Humankapital, Leitbild, Identität.
- Quote paper
- Manuel Dillinger (Author), 2002, Stand und Perspektive des Stadtmarketing in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4931