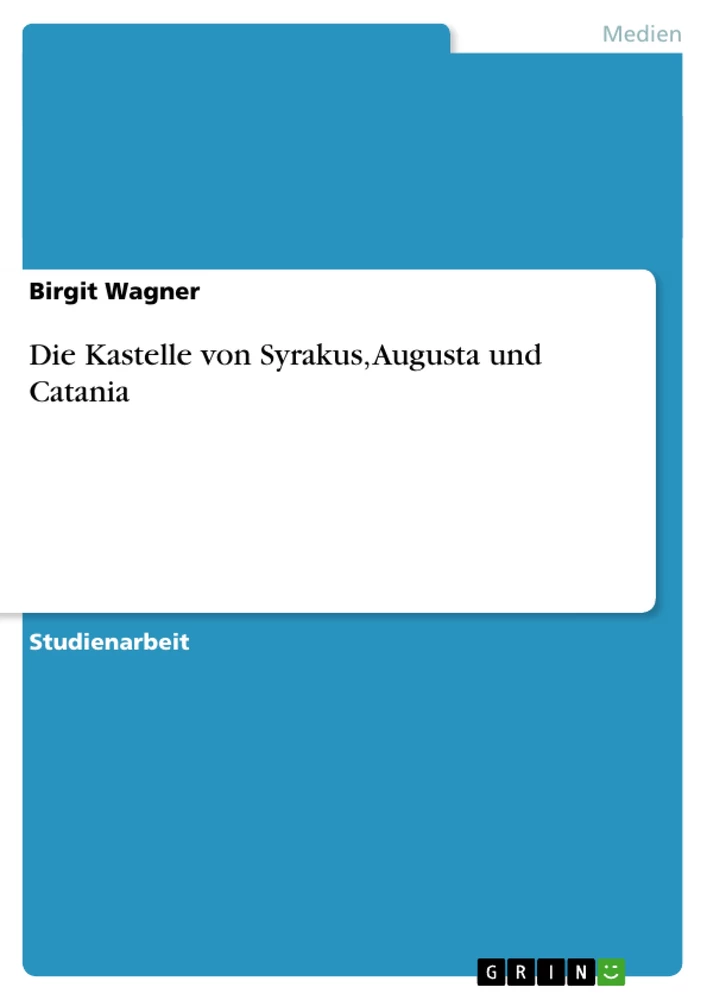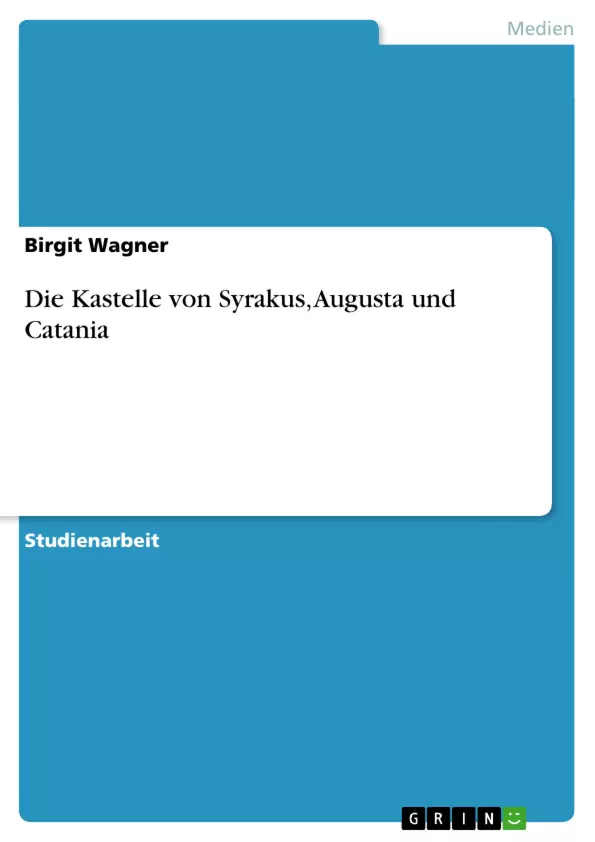1. Einleitung
Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Deutschland 1220 begann Friedrich II. damit, sein Südreich mit einem dichten Netz von Bauten zu überziehen. Es handelte sich dabei nicht nur um Wehrbauten, sondern auch um persönliche Rückzugspunkte, sogenannte loca solaciorum, sowie um Paläste in wichtigen Residenzorten wie Lucera oder Foggia.
Die Festigung seiner Herrschaft auf dem italienischen Festland und in Sizilien manifestiert sich gerade in Friedrichs Bautätigkeit besonders deutlich: Auf den Hoftagen von Capua 1220 und von Messina 1221 verkündete er die Gesetze „de novis edificiis deruendis“, die beinhalteten, dass Wehrbauten, die während der Zeit seiner Unmündigkeit und seiner Abwesenheit ohne ausdrückliche Genehmigung von Lehensträgern erbaut worden waren, entweder an ihn selbst zurückgegeben werden müssten oder ohne Nachsicht zerstört werden würden1. Bereits diese Gesetze werfen ein Licht darauf, welche Bedeutung herrschaftlichen Gebäuden zugemessen wurde.
Nachdem sich Friedrichs Bautätigkeit zunächst aufs Festland konzentriert hatte, begann er nach der Rückkehr vom Kreuzzug 1228 mit dem Ausbau einer Kastellkette an der Ostküste Siziliens. Bereits seit 1220 bemühte er sich, die uneingeschränkte Gewalt über Sizilien wiederzuerlangen, wie sie König Wilhelm II. bis 1189 innehatte2 Zu dieser Machtkonzentration kam es jedoch erst in den dreißiger Jahren, als Friedrich sich mit dem Papst zunächst ausgesöhnt hatte, nachdem dessen Truppen während seiner Abwesenheit im Heiligen Land 1228 in Sizilien eingefallen waren. In dieser Zeitspanne entstanden die drei Kastelle von Catania, Augusta und Syrakus. Sie befinden sich alle drei in exponierter Lage zum Meer hin und erheben sich über regelmäßigem, annähernd quadratischem oder zumindest rechteckigem Grundriss, was sie von den vorhergehenden Bauwerken Friedrichs II. abhebt, bei denen zwar Regelmäßigkeit angestrebt, aber nie ganz verwirklicht war. Diese Bauten weisen bereits auf das streng stereometrisch gebildete Castel del Monte hin.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Castel Maniace in Syrakus
- Das Kastell von Augusta
- Castel Ursino in Catania
- Zur Frage nach Zweck und Bedeutung der drei Kastelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den drei Kastellen von Syrakus, Augusta und Catania, die während der Herrschaft Friedrichs II. in Sizilien errichtet wurden. Ziel ist es, die Kastelle in ihrer Entstehungsgeschichte, Architektur und Funktion im Kontext der staufischen Bautätigkeit zu untersuchen.
- Die Entwicklung der staufischen Kastellarchitektur in Sizilien
- Die Funktion der Kastelle als Herrschaftsinstrumente Friedrichs II.
- Der Einfluss der Kastelle auf die politische und militärische Landschaft Siziliens
- Die architektonischen Besonderheiten der Kastelle
- Die Bedeutung der Kastelle im Kontext der Kunst und Kultur der Stauferzeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung bietet einen Überblick über Friedrichs II. Bautätigkeit in Süditalien und stellt die Bedeutung der Kastelle in diesem Kontext dar.
- Das Kapitel über Castel Maniace in Syrakus beschreibt die Lage, den Bauverlauf und die architektonischen Besonderheiten des Kastells. Es geht auch auf die Geschichte des Bauwerks ein und analysiert die Veränderungen, die es über die Jahrhunderte hinweg erfahren hat.
- Das Kapitel über das Kastell von Augusta behandelt ebenfalls die Lage, den Bau und die architektonischen Merkmale. Es beleuchtet außerdem die Funktion des Kastells als militärische Festung.
- Das Kapitel über Castel Ursino in Catania befasst sich mit der Entstehung, der Architektur und der Bedeutung des Kastells im Kontext der Stadt Catania.
Schlüsselwörter
Staufische Architektur, Kastellbau, Sizilien, Friedrich II., Castel Maniace, Augusta, Castel Ursino, Militärarchitektur, Herrschaftsinstrumente, Bautätigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche drei Kastelle Friedrichs II. werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht das Castel Maniace in Syrakus, das Kastell von Augusta und das Castel Ursino in Catania.
Was ist das Besondere an der Architektur dieser Kastelle?
Sie weisen einen regelmäßigen, annähernd quadratischen oder rechteckigen Grundriss auf, was sie von früheren, unregelmäßigeren Bauten abhebt.
Welchen Zweck erfüllten diese Kastelle für Friedrich II.?
Sie dienten als militärische Wehrbauten zur Sicherung der Küste, als Herrschaftssymbole und als persönliche Rückzugsorte (loca solaciorum).
Was besagten die Gesetze „de novis edificiis deruendis“?
Diese Gesetze ordneten an, dass ohne Genehmigung erbaute Wehrbauten entweder an den Kaiser zurückzugeben oder zu zerstören seien, um seine Macht zu festigen.
Wie hängen diese Bauten mit dem Castel del Monte zusammen?
Die strenge Geometrie dieser sizilianischen Kastelle gilt als architektonischer Vorläufer für das berühmte, streng stereometrische Castel del Monte.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Birgit Wagner (Autor:in), 1998, Die Kastelle von Syrakus, Augusta und Catania, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49335