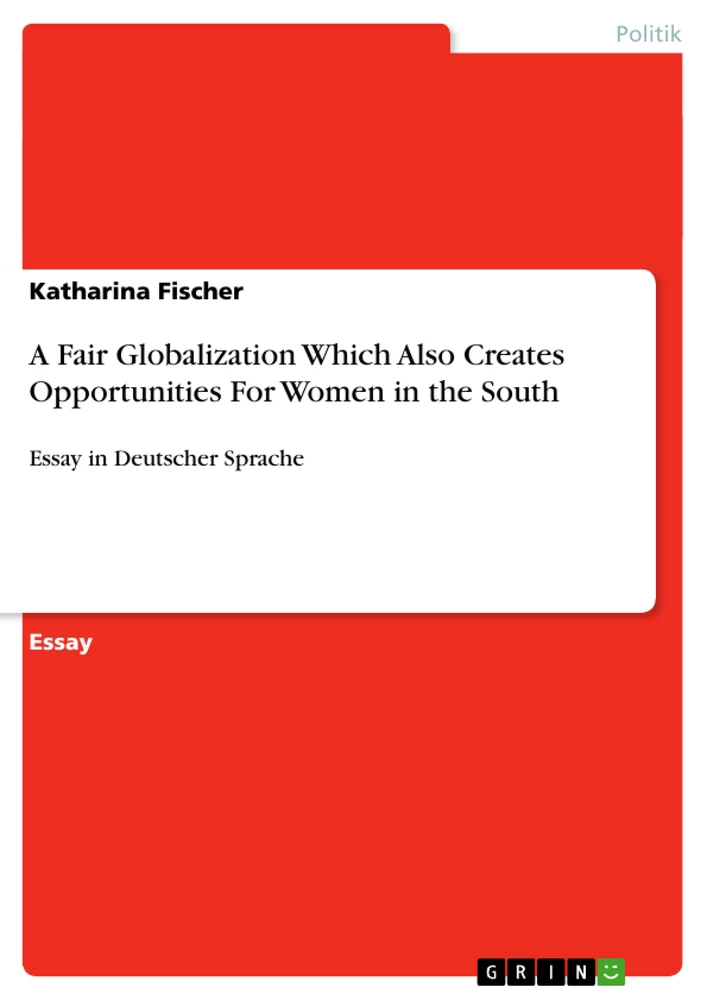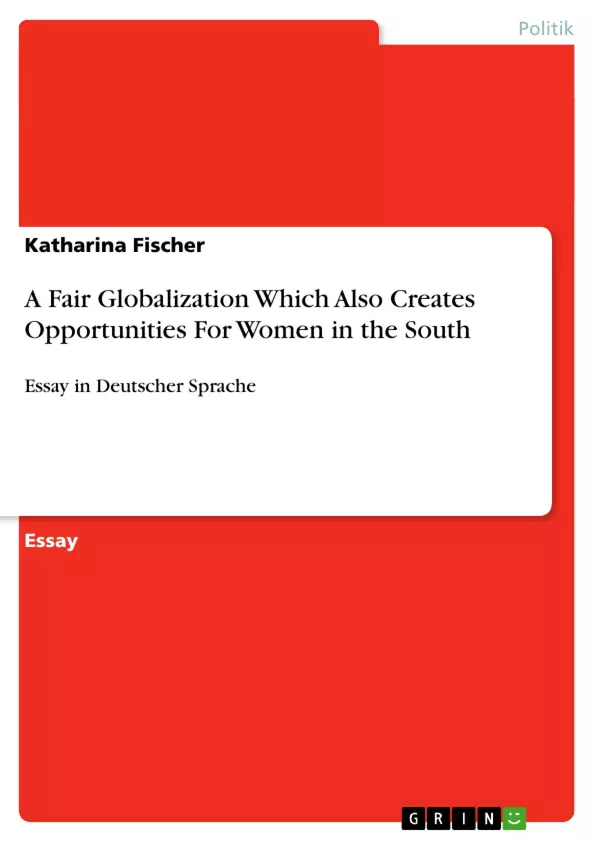Befürworter der Globalisierung argumentieren, dass die weltumspannende kapitalistische Ökonomie den Völkern Wohlstand beschert. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Globalisierung bringt neue Ausbeutungsverhältnisse und Ungleichheiten besonders für Frauen aus Peripheriestaaten hervor. Doch was ist eigentlich Ungleichheit und vor allem: Wie lässt sie sich messen? Für den Soziologen Jan Nederveen Pieterse impliziert der Terminus „globale Ungleichheit“ einen weltweiten Horizont und setzt die „Gleichheit der Menschen“ als Norm (Pieterse 2002, 1024). Dabei entlarvt er allgemeine Annahmen, dass z.B. Ungleichheit in armen Ländern weiter verbreitet sei, als im Westen, als Märchen. Industriestaaten, wie die USA oder Großbritannien, gemessen am Einkommen, haben die größte Ungleichheit zu verzeichnen (vgl. Pieterse 2002, 1025). Doch gibt es auch ungleiche Entwicklungen und Chancen für Männer und Frauen sowohl im „Westen“, wie auch in „Entwicklungsländern“. Diese misst der Gender Development Index (GDI), anhand Daten für Lebenserwartung, Bildungschancen und Einkommen, die geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt werden (Schlussbericht der Enquete Kommission 2002, 310). Es lässt sich so feststellen, dass „[…] in keiner Gesellschaft der Welt […] Frauen die gleichen Chancen auf ein „gutes Leben“ wie Männer [haben]“ (ebenda, 310). Tatsache bleibt auch, dass Frauen in vielen Ländern der Peripherie trotz, oder wegen der Globalisierung benachteiligt werden, und noch mehr: Diese Entwicklung bringt Gewinnerinnen und Verliererinnen hervor. So scheinen in den letzten zwanzig Jahren sowohl in Südamerika und Asien immer mehr Frauen erwerbstätig geworden zu sein, jedoch meist im informellen Wirtschaftssektor, d.h. oft unterbezahlt und ohne jeglichen Kündigungsschutz. Für höher qualifizierte weibliche Erwerbstätige aus westlichen Industrieländern haben sich neue Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben, während Arbeitsmigrantinnen aus Südländern u.a. als Hauspersonal im Niedriglohnsektor für eben diese Frauen arbeiten (vgl. Young und Hoppe 2004, 486).[...] [...] Im folgenden Essay werden daher zunächst Probleme der Auswirkungen der ökonomischen und sozialen Umbrüche der letzten Jahre auf Frauen anhand zweier Beispiele (Südamerika und Südkorea) dargestellt. Anschließend wird ein Blick in die Zukunft geworfen und Lösungsansätze vorgestellt. [...] [...]
Inhaltsverzeichnis
- Globalisierung = Wohlstand für Jeden?
- Die Globalisierung und ihre Verliererinnen: Zwei Beispiele
- Gastarbeiterinnen in Südkorea: Von Ausbeutungsverhältnissen und Rechtlosigkeit
- Südamerika: Doppelbelastung von Frauen und fehlende Aufstiegschancen
- Problematik der Frauen im Süden
- Ausblick: Gerechtere Arbeitsverhältnisse, Armutsbekämpfung und Verteilung der sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen in Peripheriestaaten und beleuchtet die Herausforderungen, denen sie im globalen Arbeitsmarkt gegenüberstehen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Ungleichheiten und Benachteiligungen, die durch die Globalisierung entstehen.
- Ausbeutungsverhältnisse und Rechtlosigkeit von Gastarbeiterinnen
- Doppelbelastung von Frauen durch bezahlte Arbeit und unbezahlte Hausarbeit
- Fehlende Aufstiegschancen für Frauen in Peripheriestaaten
- Die Rolle des "fordistischen" Gesellschaftsmodells in der Globalisierung
- Möglichkeiten für gerechtere Arbeitsverhältnisse und soziale Absicherung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Essay beginnt mit einer kritischen Analyse der Behauptung, dass die Globalisierung zu Wohlstand für alle führt. Es wird gezeigt, dass die Globalisierung neue Ungleichheiten und Ausbeutungsverhältnisse schafft, insbesondere für Frauen in Peripheriestaaten. Der Gender Development Index (GDI) wird als Maßstab für die geschlechtsspezifische Entwicklung herangezogen und die Ungleichheit der Chancen für Frauen und Männer in verschiedenen Ländern aufgezeigt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet zwei Beispiele für die negative Auswirkung der Globalisierung auf Frauen in Peripheriestaaten: Gastarbeiterinnen in Südkorea und Frauen in Südamerika. In Südkorea zeigt der Essay, wie Frauen durch prekäre Arbeitsverhältnisse, fehlenden Rechtsschutz und Ausbeutung durch ihre Arbeitgeber benachteiligt sind. Im Fall Südamerikas wird die Doppelbelastung von Frauen durch bezahlte Arbeit und unbezahlte Hausarbeit sowie die fehlenden Aufstiegschancen im Arbeitsmarkt hervorgehoben. Die Krise des "fordistischen" Gesellschaftsmodells und die Folgen für die Geschlechterrollen werden erläutert.
- Kapitel 2.3: Dieser Abschnitt fasst die Problematik der Frauen im Süden zusammen. Es wird deutlich, dass die Situation der Frauen in beiden Beispielen (Südkorea und Südamerika) durch eine komplexe Verkettung von Faktoren geprägt ist, die zu Armut, Abhängigkeit und fehlenden Aufstiegschancen führt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Essays sind Globalisierung, Ungleichheit, Ausbeutung, Geschlechterrollen, Frauenrechte, Gastarbeiterinnen, informeller Sektor, Südamerika, Südkorea, "fordistisches" Gesellschaftsmodell, soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, Verteilung der sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Führt Globalisierung zu mehr Wohlstand für alle?
Der Essay argumentiert kritisch, dass Globalisierung oft neue Ausbeutungsverhältnisse und Ungleichheiten schafft, insbesondere für Frauen in Peripheriestaaten.
Was ist der Gender Development Index (GDI)?
Der GDI misst die geschlechtsspezifische Ungleichheit anhand von Daten zu Lebenserwartung, Bildungschancen und Einkommen.
Warum sind Frauen im "Süden" besonders benachteiligt?
Frauen arbeiten dort oft im informellen Sektor ohne Kündigungsschutz und unterliegen einer Doppelbelastung durch bezahlte Arbeit und unbezahlte Hausarbeit.
Welche Beispiele für Frauenarmut werden genannt?
Der Essay beleuchtet die Situation von Gastarbeiterinnen in Südkorea sowie die fehlenden Aufstiegschancen und Doppelbelastungen von Frauen in Südamerika.
Welche Lösungsansätze schlägt die Arbeit vor?
Vorgeschlagen werden gerechtere Arbeitsverhältnisse, gezielte Armutsbekämpfung und eine bessere Verteilung der sozialen Arbeit zwischen den Geschlechtern.
- Quote paper
- Katharina Fischer (Author), 2005, A Fair Globalization Which Also Creates Opportunities For Women in the South, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49349