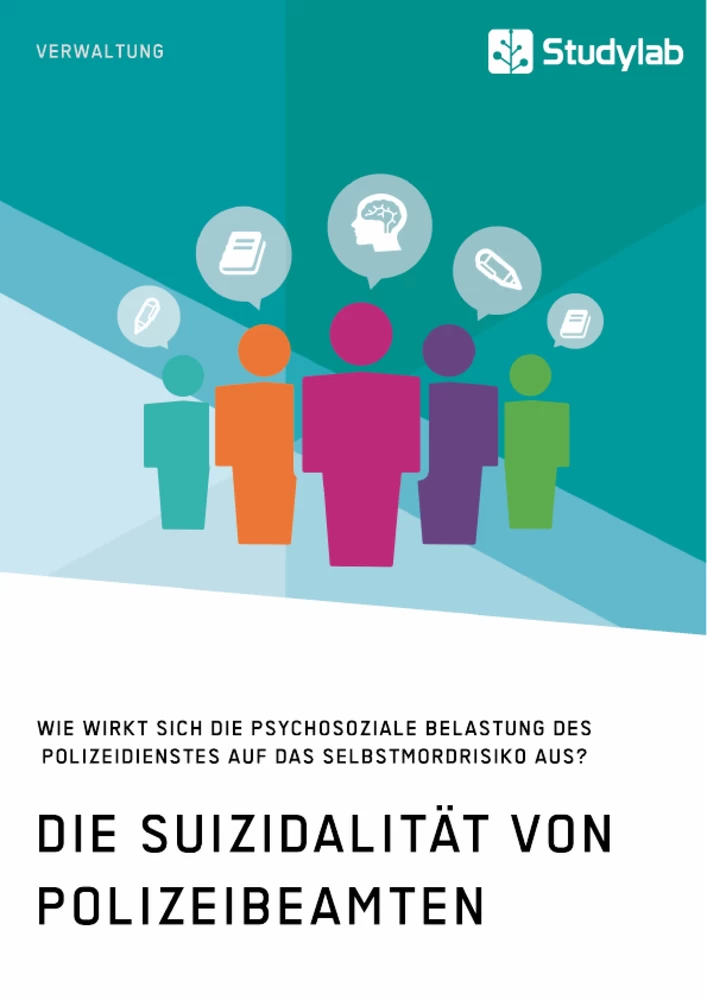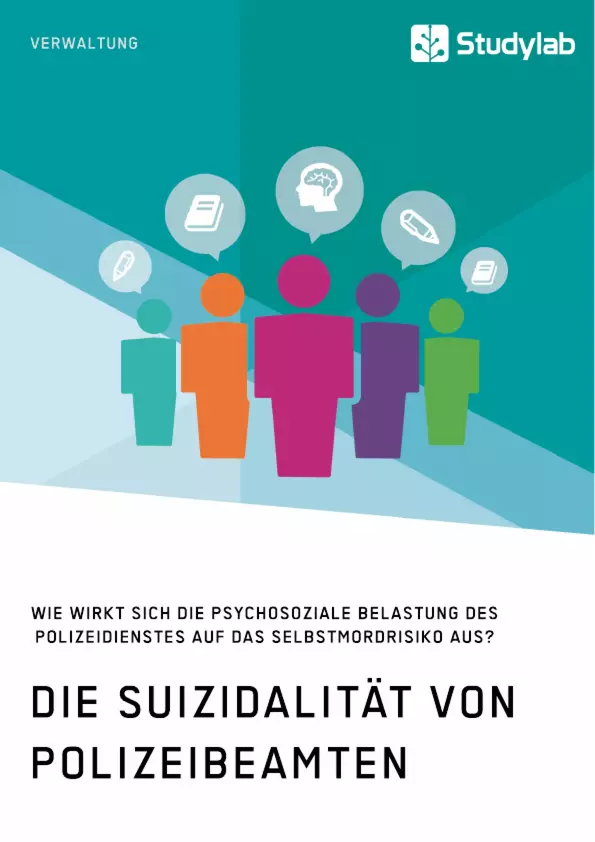Die Medien berichten eher selten von Suiziden, da eine gesteigerte Berichterstattung häufig zu nachahmenden Selbstmordversuchen führen kann. Doch Berichte über Selbstmorde von Polizeibeamten erfahren trotzdem eine sehr große mediale Aufmerksamkeit.
Besteht aufgrund der psychosozialen Belastung bei Polizeibeamten ein erhöhtes Suizidrisiko? Diese Publikation eröffnet einen Blick hinter die Kulissen des unentbehrlichen, jedoch vielfach unterschätzen Berufs des Polizeibeamten.
Welche psychischen Erkrankungen sind im Polizeidienst besonders häufig? Welche Risikofaktoren können zu einer erhöhten Suizidrate führen? Und welche Schutzmechanismen gibt es? Die Publikation klärt die wichtigsten Fragen und stellt Möglichkeiten der Prävention vor.
Aus dem Inhalt:
- Stressor;
- Vulnerabilität;
- Trauma;
- Depression;
- Resilienz
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Fragestellung
- Begriffsbestimmung psychosoziale Belastung
- Begriffsbestimmung Gesundheit/Krankheit
- Suizidrate / -problematik der Polizei
- Absolute Suizidzahlen
- Entwicklungen der letzten Jahre
- Psychologische Störungen
- Verfügbarkeit von Mitteln
- Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- Vulnerabilität
- Stressoren
- Auswahl Psychischer- und Verhaltensstörungen
- Akute Belastungsreaktion
- PTBS
- Anpassungsstörung
- Depression
- Prätraumatische Risikofaktoren
- Alter
- Geschlecht
- Familiäre Umgebung
- Frühere Traumatisierung
- Einschätzung der Sicherheit
- Traumatisierungsfolgen im und durch den Polizeidienst
- Stress und Traumareaktionen
- Primäre Traumatisierung
- Sekundäre Traumatisierung
- Peritraumatische Faktoren innerhalb eines Einsatzes
- Peritraumatische Dissoziation
- Ausmaß der Traumaexposition
- Posttraumatische Bewältigung
- Gesundheitsfaktoren
- Schutzfaktoren
- Schutzmechanismen innerhalb der Polizei
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Suizidalität von Polizeibeamten und analysiert die Auswirkungen der psychosozialen Belastung des Polizeidienstes auf das Selbstmordrisiko. Sie befasst sich mit den Ursachen und Folgen von Traumatisierung im Polizeidienst und den damit verbundenen psychischen und verhaltensbezogenen Störungen. Darüber hinaus werden Prätraumatische Risikofaktoren und Schutzfaktoren in der Polizeiarbeit beleuchtet.
- Psychosoziale Belastung des Polizeidienstes
- Suizidalität von Polizeibeamten
- Traumareaktionen und -folgen im Polizeidienst
- Psychische und verhaltensbezogene Störungen im Zusammenhang mit dem Polizeidienst
- Prätraumatische Risikofaktoren und Schutzfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Suizidalität von Polizeibeamten ein und definiert die zentralen Begriffe "psychosoziale Belastung" und "Gesundheit/Krankheit". Kapitel 2 analysiert die Suizidrate und -problematik innerhalb der Polizei, wobei insbesondere auf die Entwicklung der letzten Jahre, die psychologischen Störungen und die Verfügbarkeit von Ressourcen eingegangen wird. Das dritte Kapitel widmet sich dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell, das eine Erklärung für die erhöhte Suizidalität von Polizeibeamten bietet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Auswahl von psychischen und verhaltensbezogenen Störungen, die mit dem Polizeidienst in Verbindung stehen, wie zum Beispiel der akuten Belastungsreaktion, PTBS, der Anpassungsstörung und der Depression. Kapitel 5 beleuchtet prätraumatische Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, familiäre Umgebung, frühere Traumatisierung und die Einschätzung der Sicherheit. Kapitel 6 widmet sich den Traumatisierungsfolgen im und durch den Polizeidienst, wobei die primäre und sekundäre Traumatisierung, peritraumatische Faktoren und die posttraumatische Bewältigung im Fokus stehen. Kapitel 7 thematisiert Schutzfaktoren, die Polizeibeamten vor Traumatisierung und psychischen Problemen schützen können. Kapitel 8 beleuchtet Schutzmechanismen innerhalb der Polizei, die das Wohlbefinden der Beamten fördern sollen. Das Resümee fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Suizidalität, psychosoziale Belastung, Polizeidienst, Traumatisierung, PTBS, psychische Störungen, Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Die wichtigsten Konzepte umfassen die Analyse der Suizidrate, die Untersuchung von Stressoren und Vulnerabilität im Polizeidienst, sowie die Erforschung von Schutzmechanismen und Präventionsmaßnahmen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Suizidalität von Polizeibeamten. Wie wirkt sich die psychosoziale Belastung des Polizeidienstes auf das Selbstmordrisiko aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493916