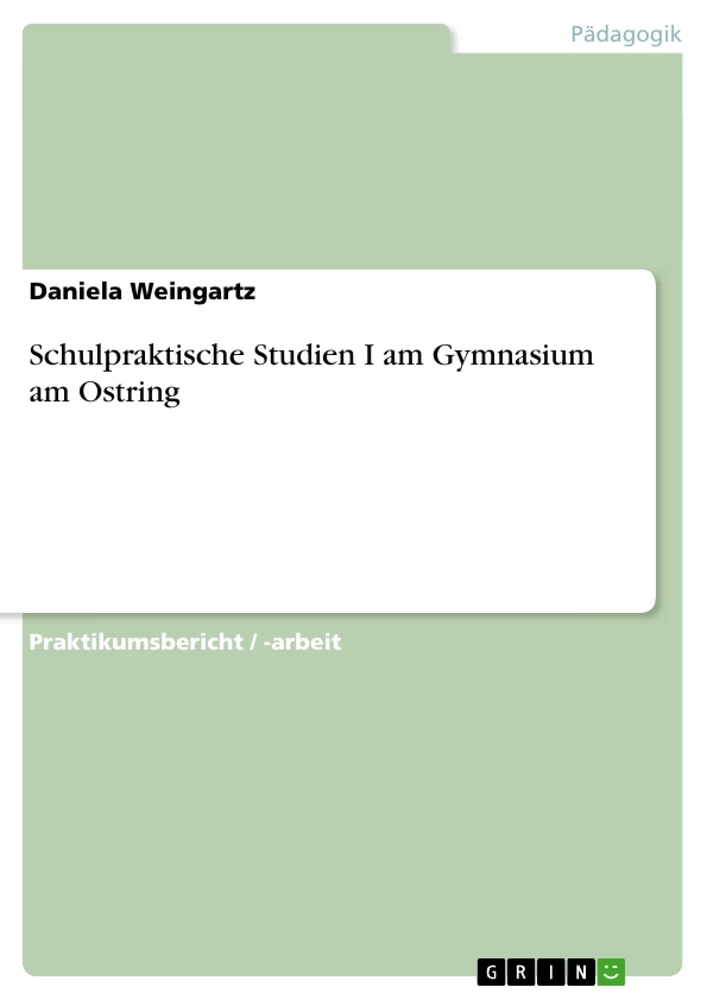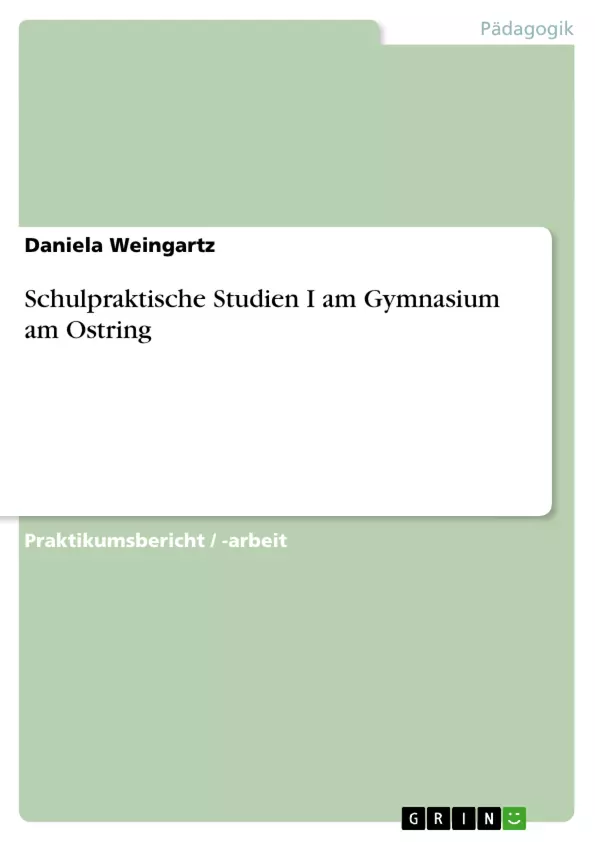Der vorliegende Bericht liefert einen Überblick über die schulpraktischen Studien. Er besteht aus der Vorstellung der Schule und den Beobachtungen eines speziellen Themas.
Am 16.2.2004 nahm ich das fachdidaktische Praktikum für das Fach Französisch am Gymnasium am Ostring (im Folgenden auch durch GaO abgekürzt) auf. Nach kurzer Begrüßung der zehn Praktikanten durch den Schulleiter wurden wir einer Praktikumsbetreuerin überwiesen. Sie zeigte uns die Schule und stellte den Ablauf für die ersten beiden Praktikumstage vor. An dieser Schule wird so verfahren, dass jeder Praktikant am ersten Tag eine Klasse begleitet und in ihrem Unterricht hospitiert. Damit soll dem Praktikanten die Einfindung in den Schulalltag erleichtert werden. Am zweiten Tag schließt sich der Praktikant dem jeweiligen Fachlehrer an, um einen Einblick in seinen Unterricht zu erhalten. Für den weiteren Verlauf ist jeder Praktikant eigenständig verantwortlich, wobei von der Praktikumsbetreuerin Empfehlungen ausgesprochen wurden, in welchem Unterricht hospitiert werden kann. Ein Teil der Lehrer war zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Betreuung eines Referendars, den Abiturvorbereitungen ausgelastet oder grundsätzlich nicht zur Praktikantenaufnahme in seinen Unterricht bereit. Neben mir absolvierte gleichzeitig eine Studentin der Ruhr-Universität Bochum ihr Französisch-Praktikum, so dass es sich anbot, den Unterricht gemeinsam zu besuchen. In den ersten zwei Wochen hatten wir die Gelegenheit am Französischunterricht der 9. Klasse, die seit Beginn dieses Schuljahres Französisch lernt, sowie vereinzelt am Unterricht eines Französischgrundkurses der Jahrgangsstufe 12 teilzunehmen. Leider blieb uns der weitere Besuch der 9. Klasse in der zweiten Praktikumshälfte verwehrt, da ab diesem Zeitpunkt der Unterricht von einer Referendarin fortgeführt wurde. Der seit der ersten Woche geplante Besuch in der 7. Klasse konnte erst im Laufe der dritten Woche erfolgen, nachdem der zuständige Lehrer genesen war. Insgesamt hätte ich mir eine bessere Organisation seitens der Schule gewünscht. Ich hatte den Eindruck, dass die vier Französischlehrer mit zwei Referendaren und zwei Praktikanten überfordert waren und dies auch uns Praktikanten gegenüber deutlich zum Ausdruck brachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorstellung der Schule
- 2. Modelle zur Präsentation von Lehrwerktexten
- 2.1. Beobachtungen zur Präsentation und Behandlung von Lehrwerktexten im Anfangsunterricht der Klassen 7 und 9
- 3. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Bericht schildert die schulpraktischen Studien des Autors am Gymnasium am Ostring (GaO) im Wintersemester 2003/2004. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Präsentation von Lehrwerktexten im Französischunterricht der Klassen 7 und 9. Der Bericht zeichnet ein Bild der Schule, beschreibt beobachtete Unterrichtspraktiken und reflektiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Lehrwerktextpräsentation im Anfangsunterricht.
- Die Rolle von Lehrwerktexten im Französischunterricht
- Methoden der Präsentation von Lehrwerktexten
- Beobachtungen und Analyse des Unterrichts in den Klassen 7 und 9
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Lehrwerktextpräsentation im Anfangsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die schulpraktischen Studien des Autors am GaO ein. Sie beschreibt die Schule, ihre Besonderheiten und die Organisationsstruktur des Praktikums. Außerdem werden die Themen des Berichts, insbesondere die Präsentation von Lehrwerktexten im Französischunterricht der Klassen 7 und 9, vorgestellt.
2. Modelle zur Präsentation von Lehrwerktexten
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Präsentation von Lehrwerktexten im Französischunterricht der Klassen 7 und 9. Der Autor beschreibt verschiedene Modelle und Ansätze, die von den Lehrkräften eingesetzt werden, und analysiert deren Stärken und Schwächen.
Schlüsselwörter
Lehrwerktexte, Französischunterricht, Anfangsunterricht, Präsentation, Behandlung, Beobachtungen, Unterrichtsmethoden, Schulpraktikum, Gymnasium am Ostring.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Schwerpunkt des Französisch-Praktikums am GaO?
Der Schwerpunkt lag auf der Beobachtung und Analyse der Präsentation von Lehrwerktexten im Anfangsunterricht der Klassenstufen 7 und 9.
Wie verliefen die ersten Tage des Praktikums?
Zuerst begleiteten die Praktikanten eine Klasse durch ihren gesamten Schultag, am zweiten Tag schlossen sie sich einem spezifischen Fachlehrer an.
Welche Probleme traten während der schulpraktischen Studien auf?
Der Autor kritisiert die mangelnde Organisation und die Überlastung der Fachlehrer durch die gleichzeitige Betreuung von Referendaren und Praktikanten.
Wie werden Lehrwerktexte im Unterricht behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle zur Einführung neuer Texte und analysiert, wie diese didaktisch aufbereitet werden, um das Sprachenlernen zu fördern.
Welches Fazit zieht der Praktikumsbericht?
Trotz organisatorischer Mängel bot das Praktikum wertvolle Einblicke in die methodische Vielfalt und die Herausforderungen der Textarbeit im Fremdsprachenunterricht.
- Quote paper
- Daniela Weingartz (Author), 2004, Schulpraktische Studien I am Gymnasium am Ostring, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49400