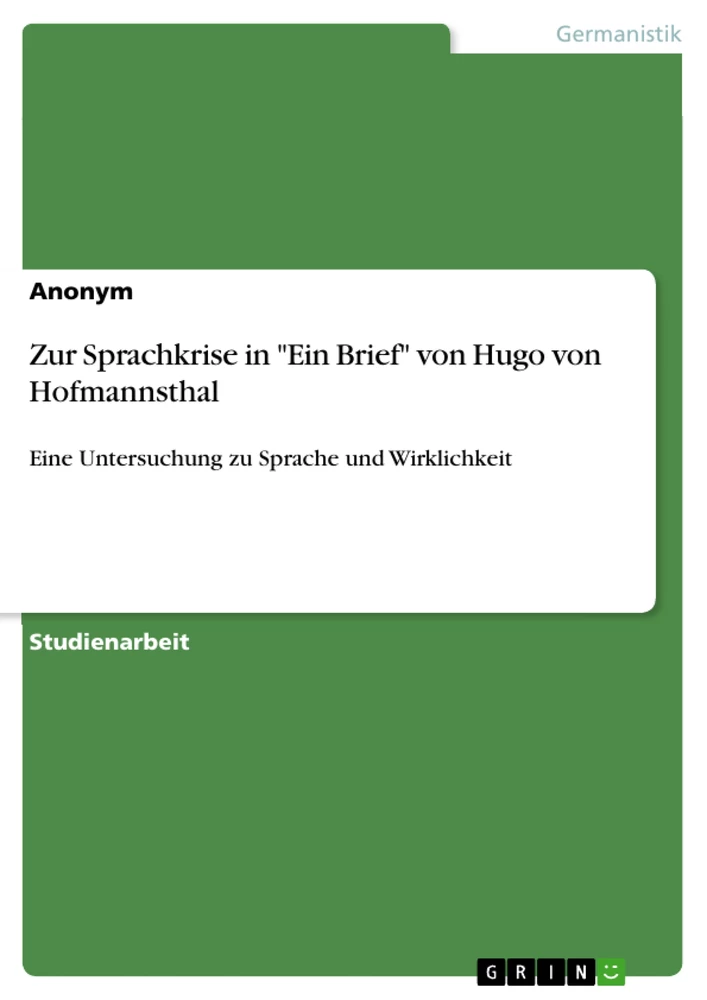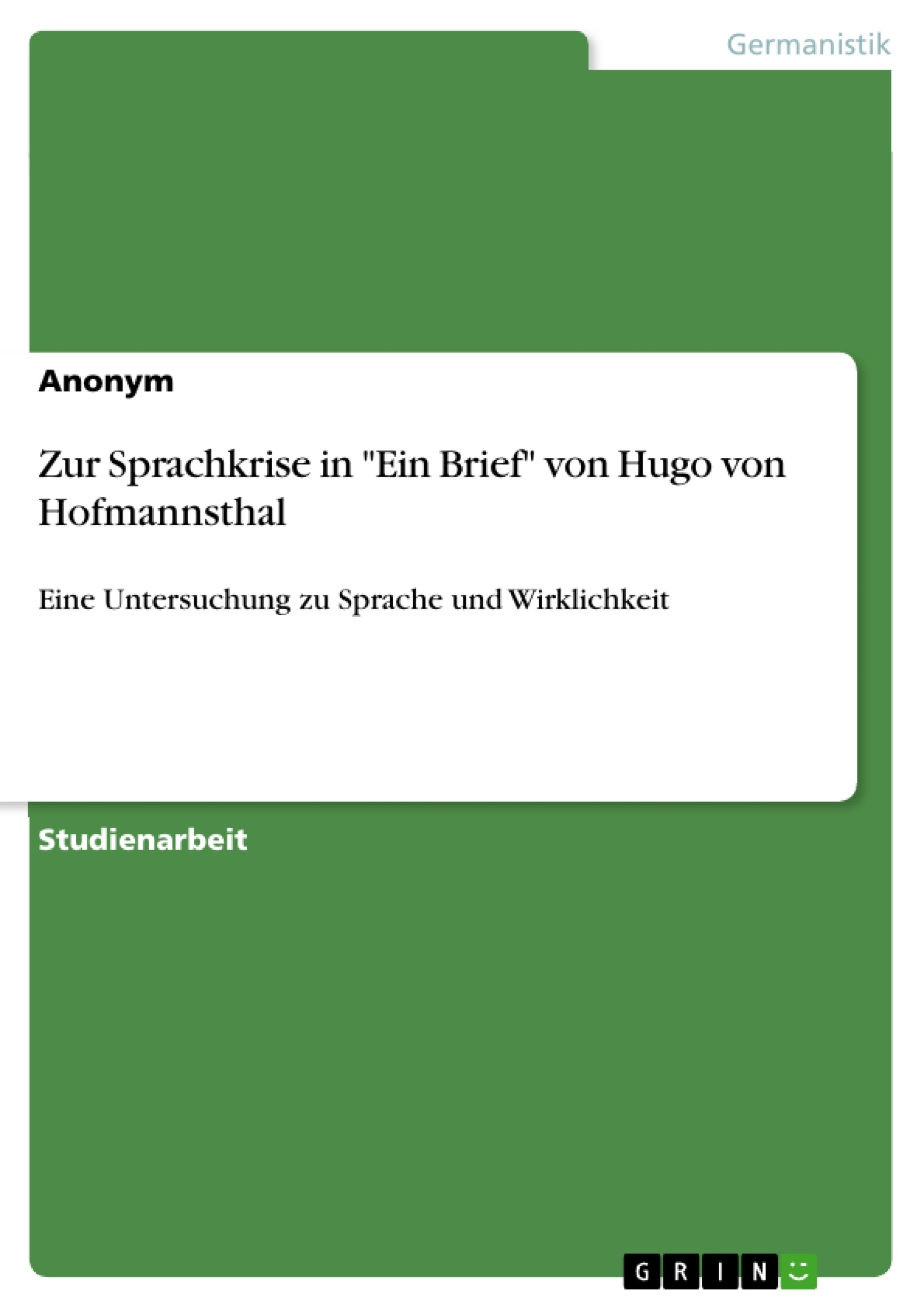In dieser Seminararbeit zu Hugo von Hofmannsthals "Ein Brief" soll untersucht werden, inwiefern sich die um die Jahrhundertwende vorherrschende Sprachkrise in diesem Werk, vor allem in der Figur des Lord Chandos, widerspiegelt. Es wird erläutert, an welche Bedingungen seine Krise gebunden ist, auf welche Art und Weise sich die Merkmale ebendieser äußern und worin ihr Ursprung liegt.
Zu Beginn soll die grundlegende Problematik zum Themenkomplex der Sprachkrise um das Jahr 1900 noch einmal wiedergegeben werden, die während der Wiener Moderne aufgrund gesellschaftlicher Umbrüche stattfand. Die Erkenntnisse und Kriterien, die ebendiese Krise ausmachten, konstituieren die Grundlage der daran anschließenden Kapitel.
Darauf folgend soll die Sprachkrise in "Ein Brief" eruiert werden. Dieses Kapitel erfährt eine Gliederung in drei Abschnitte, sodass eine differenzierte und stufenweise Annäherung an die Problematik gewährleistet werden kann. Der erste Abschnitt soll deutlich machen, welche Umstände zur Sprachkrise des Lord Chandos geführt haben. Es wird seine Ausgangssituation transparent gemacht, sodass eine Grundlage errichtet wird, auf der alle nachfolgenden Erkenntnisse, hinsichtlich des Auslösers der Krise, basieren. An dieser Stelle findet eine Betrachtung des Sprachsystems und dessen Verwendung in mündlicher und schriftlicher Form statt, um eine Eingrenzung der Krise des Lord Chandos vorzunehmen und die Bedingung des Eintretens der Krise zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachkrise um 1900
- Hugo von Hofmannsthal – Ein Brief
- Gründe der Krise
- Merkmale der Krise
- Epiphane Momente und die neue Sprache
- Sprachkrise bei von Hofmannsthal
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Sprachkrise in Hugo von Hofmannsthals Werk „Ein Brief“, auch bekannt als Chandos-Brief. Die Arbeit untersucht, inwieweit die um die Jahrhundertwende vorherrschende Sprachkrise in der Figur des Lord Chandos widergespiegelt wird. Dabei werden die Ursachen, Merkmale und der Ursprung der Krise erläutert.
- Die Sprachkrise um 1900 und ihre Ursachen
- Die Sprachkrise in „Ein Brief“
- Die Merkmale der Krise in der Figur des Lord Chandos
- Epiphane Momente und die Möglichkeit einer neuen Sprache
- Der Bezug zur Sprachkrise bei Hugo von Hofmannsthal
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Sprachkrise um 1900 dar, die durch gesellschaftliche Umbrüche der Wiener Moderne ausgelöst wurde. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der Sprachkrise in Hofmannsthals „Ein Brief“ und die Verbindung zur Figur des Lord Chandos.
Sprachkrise um 1900: Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext der Sprachkrise um 1900 und die verschiedenen Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitrugen. Dazu gehören gesellschaftliche Herausforderungen der Moderne, der Einfluss neuer Medien, die Defizite der Sprache im wissenschaftlichen Kontext und die Sprachphilosophie von Nietzsche und Mauthner.
Hugo von Hofmannsthal – Ein Brief: Dieses Kapitel analysiert die Sprachkrise in „Ein Brief“ in drei Abschnitten. Im ersten Abschnitt werden die Umstände, die zur Krise des Lord Chandos führten, beleuchtet. Der zweite Abschnitt widmet sich den Merkmalen der Sprachkrise und ihrer Ausprägung bei Chandos. Im dritten Abschnitt werden die epiphanen Momente und die Möglichkeit einer neuen Sprache diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Themenfeld der Sprachkrise, insbesondere im Kontext des Fin de Siècle und der Wiener Moderne. Die Schlüsselwörter umfassen: Sprachkrise, Sprachskepsis, Sprachkritik, Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief, Chandos-Brief, Wiener Moderne, Gesellschaftliche Umbrüche, Lord Chandos, Epiphane Momente.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Zur Sprachkrise in "Ein Brief" von Hugo von Hofmannsthal, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494118