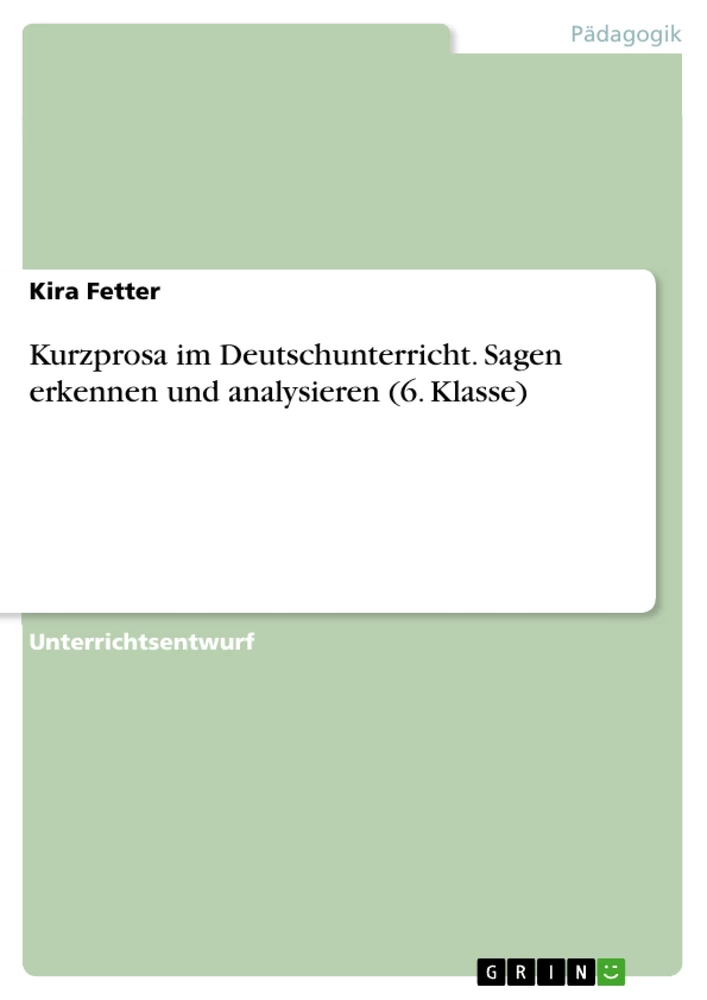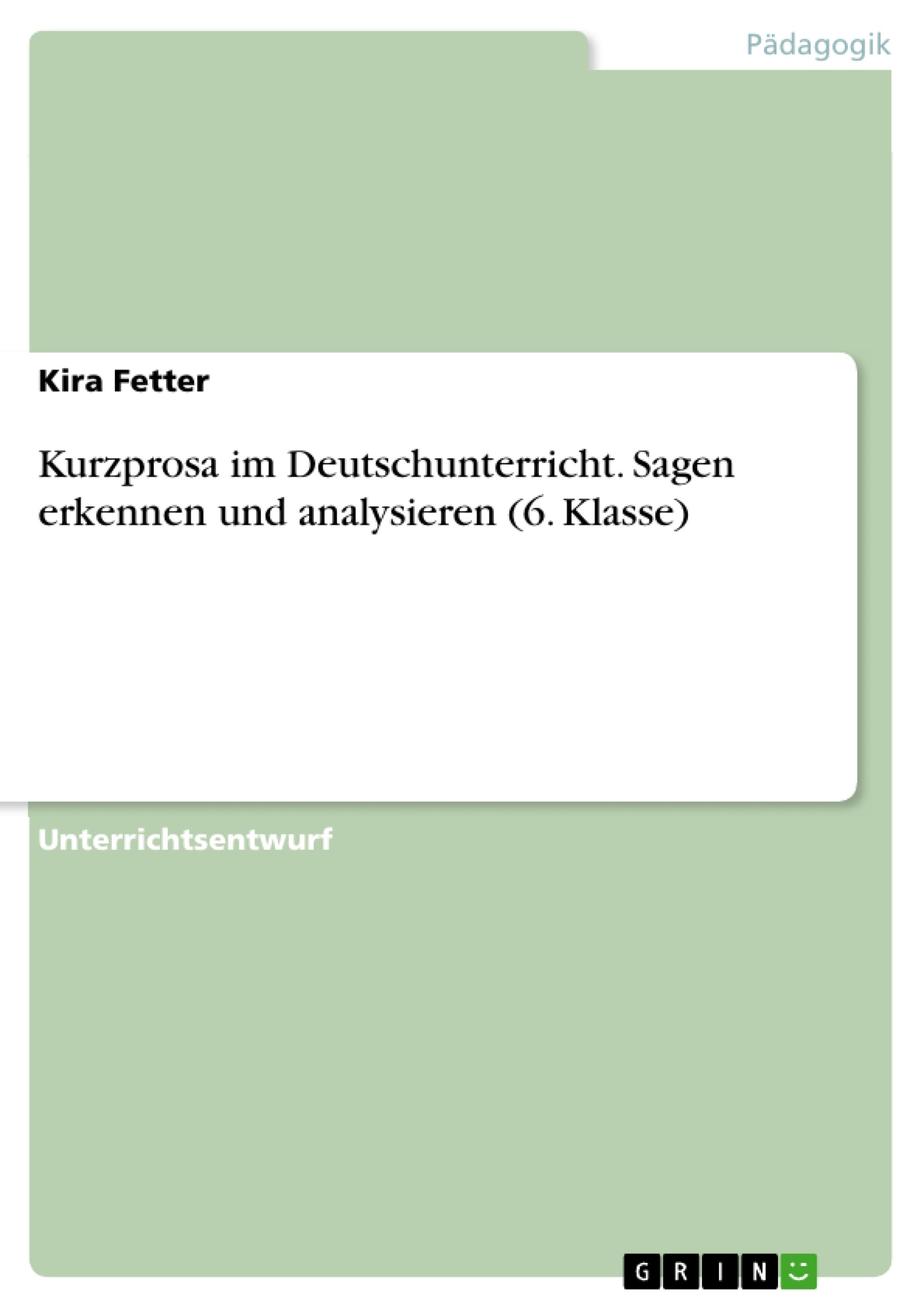Diese Arbeit stellt einen Unterrichtsentwurf für eine Doppelstunde im Fach Deutsch einer 6. Klasse eines Gymnasiums in Baden-Württemberg dar. Die Doppelstunde umfasst den Themenbereich der prosaischen Kurzformen, speziell den der Sagen.
Mit der Kurzprosa können grundlegende Kompetenzen, die im Rahmen der gymnasialen Schulbildung geschult werden sollen, aufgegriffen werden. Ein zentraler Aspekt der Untergattung ist die bereits im Namen verankerte Kürze. Die Schüler werden dadurch zum Lesen und Weiterlesen angeregt, motiviert und verlieren nicht so schnell die Lust am Lesen. Damit kann besonders bei Kindern, die nicht gerne Bücher lesen, die Lust am literarischen Lernen gefördert werden. Der Aspekt, dass die Thematik der Kurzprosa meist an die Lebenswelt der Heranwachsenden anknüpft, wirkt außerdem motivierend. Aus diesen Gründen ist die Kurzprosa unverzichtbar im Deutschunterricht des Gymnasiums.
Die Sagen, die im Bildungsplan 2016 erstmals in der Unterstufe thematisiert wurden, bilden eine wichtige Grundlage für spätere Lern- und Leseprozesse, da die Schüler bestimmte Stoffe und Motive kennen lernen, die sie in ihrer späteren Schullaufbahn, beispielsweise in Romanen oder Dramen, wiederfinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzprosa im Deutschunterricht
- Sagen im Deutschunterricht
- Klassensituation
- Einordnung in die Unterrichtseinheit
- Sachanalyse
- Definition und Terminologie der Erzählgattung Sage
- Die Sagen „Sonnenstrahlen auf der Brezel“ und „Die Weiber von Weinsberg“
- Angestrebte (Teil-)Kompetenzen/Bildungsplanbezug
- Didaktisch-methodische Analyse
- Tabellarischer Stundenentwurf
- Material (mit Erwartungshorizont)
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse des Gymnasiums einen Einstieg in die Textsorte Sage zu ermöglichen. Die Stunde dient als Einführung und soll die Schülerinnen und Schüler mit grundlegenden Merkmalen der Sage vertraut machen.
- Definition und Merkmale der Sage als Erzählgattung
- Unterscheidung von Sage und Märchen
- Analyse der Sagenmotive und -strukturen
- Die Rolle der Sage in der deutschen Literatur und Kultur
- Zusammenhang von Sagen mit dem Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Entwurfs erläutert die Bedeutung der Kurzprosa im Deutschunterricht und beleuchtet die Entwicklung der didaktischen Ansätze. Der Abschnitt über Sagen im Deutschunterricht behandelt die historische Rezeption und die Rolle der Sage als Bildungsgut.
Die Klassensituation beschreibt die Rahmenbedingungen der Unterrichtsstunde und die Einordnung in die Unterrichtseinheit erläutert den Platz der Sagen im Kontext des Unterrichts. Die Sachanalyse definiert die Erzählgattung Sage und befasst sich mit zwei konkreten Beispielen. Weitere Kapitel behandeln den Bildungsplanbezug, didaktisch-methodische Aspekte und den tabellarischen Stundenentwurf.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Unterrichtsentwurfs sind: Kurzprosa, Sage, Märchen, Didaktik, Unterrichtsplanung, Bildungsplan, Sachanalyse, Gattungsmerkmale, Sagenmotive, Sagenstruktur, Lebenswelt, Kultur, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Sagen besonders für den Deutschunterricht in der 6. Klasse?
Sagen sind kurz und motivierend. Sie knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an und fördern die Lust am literarischen Lernen, besonders bei Schülern, die sonst seltener zu Büchern greifen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Sage und einem Märchen?
Im Gegensatz zum Märchen haben Sagen oft einen realen Kern (Orte, Personen oder Ereignisse), werden aber mit phantastischen Elementen ausgeschmückt. Sie beanspruchen oft eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Welche Sagen werden in diesem Unterrichtsentwurf behandelt?
Der Entwurf analysiert die Sagen „Sonnenstrahlen auf der Brezel“ und „Die Weiber von Weinsberg“ als konkrete Textbeispiele.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler durch die Arbeit mit Sagen erwerben?
Die Schüler lernen Gattungsmerkmale kennen, analysieren Erzählstrukturen und Motive und erfahren etwas über die kulturelle Bedeutung von Sagen in der deutschen Literatur.
Welche Rolle spielt der Bildungsplan 2016 in diesem Entwurf?
Der Entwurf bezieht sich auf den Bildungsplan 2016 für Baden-Württemberg, in dem Sagen erstmals explizit als Thema für die Unterstufe im Gymnasium verankert wurden.
- Quote paper
- Kira Fetter (Author), 2019, Kurzprosa im Deutschunterricht. Sagen erkennen und analysieren (6. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494326