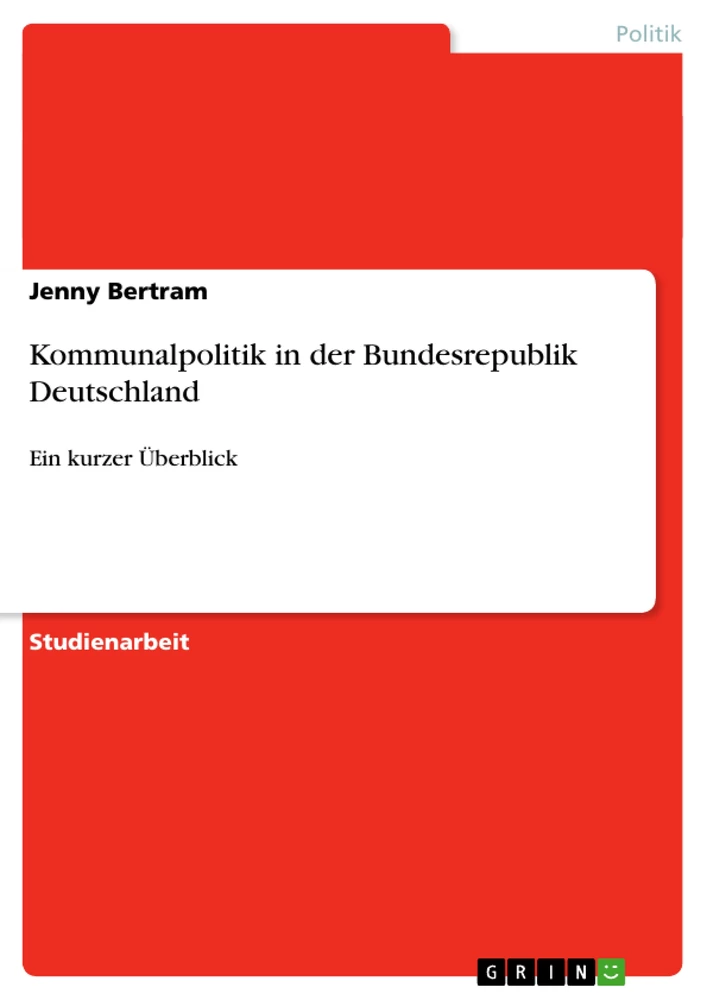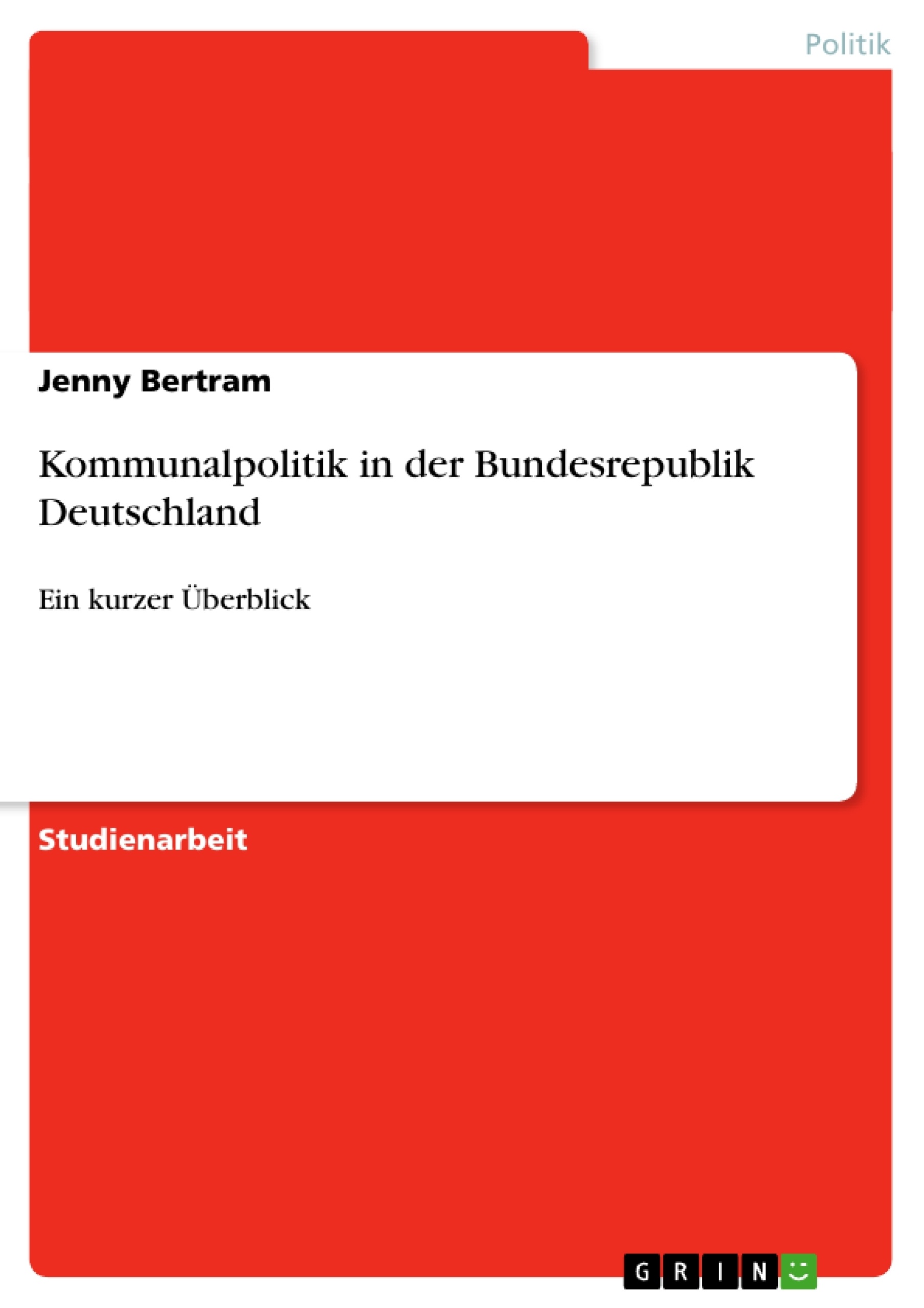Artikel 28:
„(…) In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. (…)
In Gemeinden kann an die Stelle von einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.
Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgaben der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.(…)“
Dieser Artikel ist für die Kommunen in Deutschland wohl der bedeutendste, da er die kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden gewährleistet. Doch was genau hinter dem Begriff kommunaler Selbstverwaltung steht, wissen nur wenige Deutsche. Obwohl dieses Prinzip das Leben aller Bürger beeinflusst und auch Auswirkungen auf unser aller Leben hat.
In der folgenden Arbeit werde ich versuchen den Begriff Kommune und was sich alles dahinter verbirgt dem Leser nahe zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Kommune
- Bedeutung einer Kommune
- Aufbau der Kommune
- Die rechtliche Stellung der Kommune
- Die Organisation der Exekutiven auf der Kommunalebene
- Die Gesetzgebungsbefugnisse der Kommune
- Die Unterschiede in den Länderverfassungen
- Die süddeutsche Ratsverfassung
- Die norddeutsche Ratsverfassung
- Die Bürgermeisterverfassung
- Die Magistratsverfassung
- Die rechtliche Stellung der Kommune
- Die eigenen Aufgaben der Kommune
- Die Aufgabenzuteilung von Bund und Ländern
- Die Verwaltungsgliederung in der Kommune
- Die finanziellen Einnahmen und Ausgaben einer Kommune
- Der Haushaltsplan einer Kommune
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Sie erläutert die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung, ihre Organisation und ihre Rolle im politischen System. Dabei wird auch auf die Unterschiede in den Länderverfassungen und die finanziellen Einnahmen und Ausgaben einer Kommune eingegangen.
- Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung und seine Bedeutung
- Der Aufbau der Kommunen und ihre rechtliche Stellung im deutschen Bundesstaat
- Die Organisation der Exekutiven auf der Kommunalebene und die Gesetzgebungsbefugnisse der Kommune
- Die verschiedenen Verfassungsmodelle der Kommunen in den einzelnen Bundesländern
- Die Aufgaben und Finanzierung der Kommunen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der kommunalen Selbstverwaltung ein und erläutert die Bedeutung von Artikel 28 des Grundgesetzes. Das zweite Kapitel definiert den Begriff Kommune und beleuchtet dessen Bedeutung im politischen und sozialen Leben. Im dritten Kapitel wird der Aufbau der Kommune im Kontext der deutschen Staatsgewalt erläutert, wobei die rechtliche Stellung der Kommune und die Unterschiede in den Länderverfassungen im Fokus stehen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den eigenen Aufgaben der Kommune, insbesondere mit der Aufgabenzuteilung von Bund und Ländern und der Verwaltungsgliederung innerhalb der Kommune. Schließlich geht das fünfte Kapitel auf die finanziellen Einnahmen und Ausgaben einer Kommune ein und erläutert den Aufbau des kommunalen Haushaltsplans.
Schlüsselwörter
Kommunale Selbstverwaltung, Kommune, Artikel 28 Grundgesetz, Staatsaufbau, Gewaltenteilung, Landesverfassung, Aufgaben, Finanzierung, Haushaltsplan, Daseinsvorsorge.
- Quote paper
- Jenny Bertram (Author), 2005, Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49450