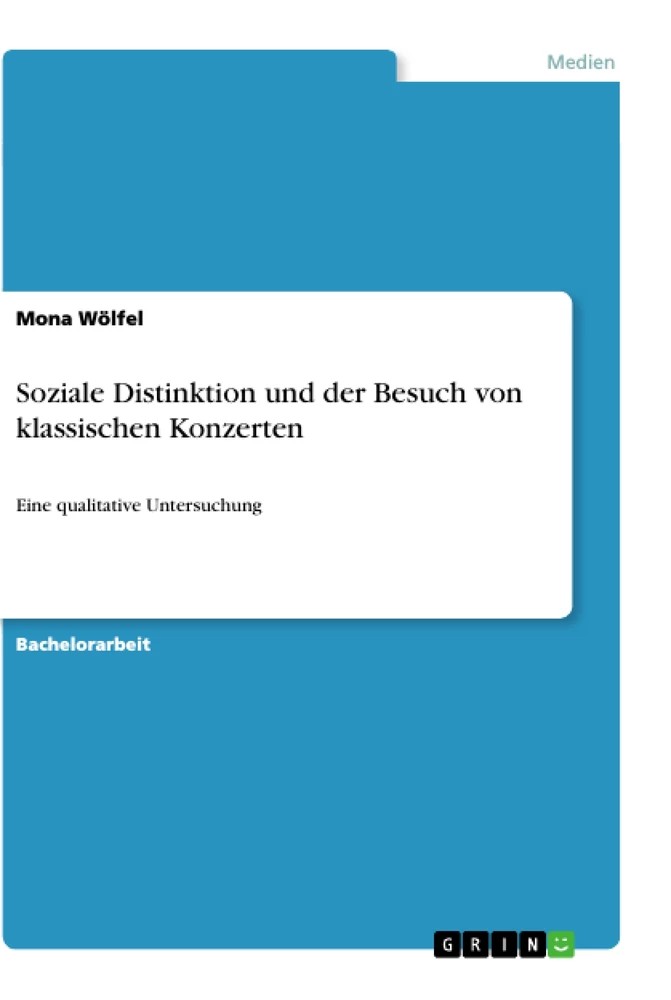Diese Arbeit soll sich mit den musikfremden Motiven eines Konzertbesuchs beschäftigen. Wer sind die Personen, die sich in Konzerthäusern zu einer Gesellschaft zusammenfinden, welche Rituale gehen mit einem Konzertabend einher und welche Rolle spielen der Prestigegewinn, das ‚sehen und gesehen werden’ und der Wunsch, einer auserlesenen Musikhörerschaft anzugehören für Besucher? Inwiefern dient das klassische Konzert der gesellschaftlichen Abgrenzung, der Distinktion?
Das klassische Konzert, wie wir es heute kennen, besteht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beinahe unverändert. Konventionen und Rituale, die mit einem Konzertbesuch einhergehen wie elegante Kleidung, gepflegte Konversation im Foyer bei einem Glas Wein und vollkommen konzentrierte Musikrezeption, die allenfalls vom Husten des Sitznachbarn unterbrochen wird, all jene Aspekte lassen das musikalische Ereignis veraltet, angestaubt und wenig zeitgemäß wirken. Trotz alledem hat die klassische Musik nach wie vor viele Liebhaber, die gerne regelmäßig ins Konzert gehen. Würdevoll anmutende Konzerthäuser sind heutzutage genau wie vor 150 Jahren Treffpunkt bestimmter gesellschaftlicher Schichten, die sich zwar auch, aber nicht nur durch ihren gemeinsamen Musikgeschmack auszeichnen. Einer elitären Hörerschaft anzugehören, ‚sehen und gesehen werden’ und Prestigegewinn können ebenso Motive für den Konzertbesuch sein wie der Wunsch nach zwei Stunden exquisitem Musikgenuss.
Doch warum eignet sich die Praxis des öffentlichen Musikgenusses so gut zur sozialen Abgrenzung? Wie kommt es, dass der Besuch eines klassischen Konzerts eine solch stark distinguierende Wirkung mit sich bringen kann? Diese Fragen werden mit Bezug auf Bourdieus Konzept des Habitus und der Distinktion theoretisch hergeleitet. Mithilfe einer qualitativen Studie wird ein Versuch unternommen, Dimensionen der Abgrenzung in Bezug auf das Klassikkonzert herzuleiten. Aus zehn durchgeführten Leitfadeninterviews werden unter anderem Informationen darüber gewonnen, welchen Konzertritualen die fragliche Klientel folgt, um sich abzugrenzen, welche Rolle dabei ein bestimmter Verhaltenskodex spielt, inwiefern der Klassikgenuss mit Bildung einhergeht und welche Hürden zu überwinden sind, bevor eine Person Teil der geschlossenen Konzertgesellschaft werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Forschungsinteresse
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Historische Entwicklung klassischer Konzerte
- 2.2 Das Konzertritual in der heutigen Zeit
- 2.3 Das Konzertpublikum
- 2.3.1 Motive für den Besuch klassischer Konzerte
- 2.4 Habitus und Distinktion
- 2.4.1 Das klassische Konzert als Mittel zur sozialen Distinktion
- 3 Fragestellung
- 4 Empirische Umsetzung
- 4.1 Das Einzelinterview
- 4.1.1 Leitfadenkonstruktion
- 4.2 Auswahlkriterien der Befragten
- 4.2.1 Sampling
- 4.2.2 Rekrutierung und Kontaktaufnahme mit Befragten
- 4.2.3 Ablauf des Interviews
- 4.2.4 Transkription
- 4.1 Das Einzelinterview
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Klientel
- 5.2 Konzertrituale
- 5.2.1 Vorbereitung auf das Konzert
- 5.2.2 Pausenaktivitäten
- 5.2.3 Nach dem Konzert
- 5.3 Dimensionen der Distinktion
- 5.3.1 Sehen und Gesehen werden
- 5.3.2 Kulturelles Interesse zeigen
- 5.3.3 Anerkennung erhalten
- 5.3.4 In Gesellschaft sein
- 5.3.5 Stars der klassischen Musik erleben
- 5.3.6 Luxuriöses Ambiente genießen
- 5.3.7 Musikalische Perfektion live erleben
- 5.4 Verhaltenskodex im Konzert
- 5.4.1 Festliche Kleidung
- 5.4.2 Ruhe im Saal
- 5.4.3 Beifallsbekundungen
- 5.4.4 Konzertverhalten erlernen
- 5.5 Klassik und Bildung
- 5.6 Die geschlossene Konzertgesellschaft
- 6 Schlussbetrachtung
- 6.1 Reflexion
- 6.2 Limitationen der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den musikfremden Motiven eines Konzertbesuchs. Sie untersucht die Rolle des klassischen Konzerts als Mittel zur sozialen Distinktion und analysiert die Rituale und Verhaltensweisen, die mit dem Besuch klassischer Konzerte verbunden sind.
- Die gesellschaftliche Relevanz des klassischen Konzerts
- Die Rolle von Ritualen und Verhaltensweisen in der Abgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen
- Die Verbindung von klassischer Musik und Bildung
- Die Bedeutung von Status und Prestige im Kontext des Konzertbesuchs
- Die Herausforderungen, die mit dem Eintritt in die "geschlossene Konzertgesellschaft" verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Präsentation des Themas und des Forschungsinteresses.
- Diskussion des Zusammenhangs zwischen klassischer Musik und sozialer Distinktion.
- Kapitel 2: Forschungsstand
- Historische Entwicklung des klassischen Konzerts.
- Das Konzertritual in der heutigen Zeit.
- Analyse des Konzertpublikums und der Motive für den Konzertbesuch.
- Theoretische Einordnung mit Bezug auf Bourdieus Konzept des Habitus und der Distinktion.
- Kapitel 3: Fragestellung
- Formulierung der Forschungsfragen, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden.
- Kapitel 4: Empirische Umsetzung
- Beschreibung der Forschungsmethodik, insbesondere der Einzelinterviews.
- Leitfadenkonstruktion und Auswahlkriterien der Befragten.
- Kapitel 5: Ergebnisse
- Analyse der Klientel und der typischen Konzertrituale.
- Identifizierung von Dimensionen der Distinktion im Kontext des Konzertbesuchs.
- Untersuchung des Verhaltenskodex im Konzert.
- Zusammenhang zwischen Klassik und Bildung.
- Beschreibung der geschlossenen Konzertgesellschaft.
Schlüsselwörter
Klassisches Konzert, soziale Distinktion, Habitus, Bourdieu, Konzertritual, Verhaltenskodex, Bildung, gesellschaftliche Gruppe, Status, Prestige, geschlossene Gesellschaft, qualitative Studie, Einzelinterview.
- Arbeit zitieren
- Mona Wölfel (Autor:in), 2015, Soziale Distinktion und der Besuch von klassischen Konzerten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494638