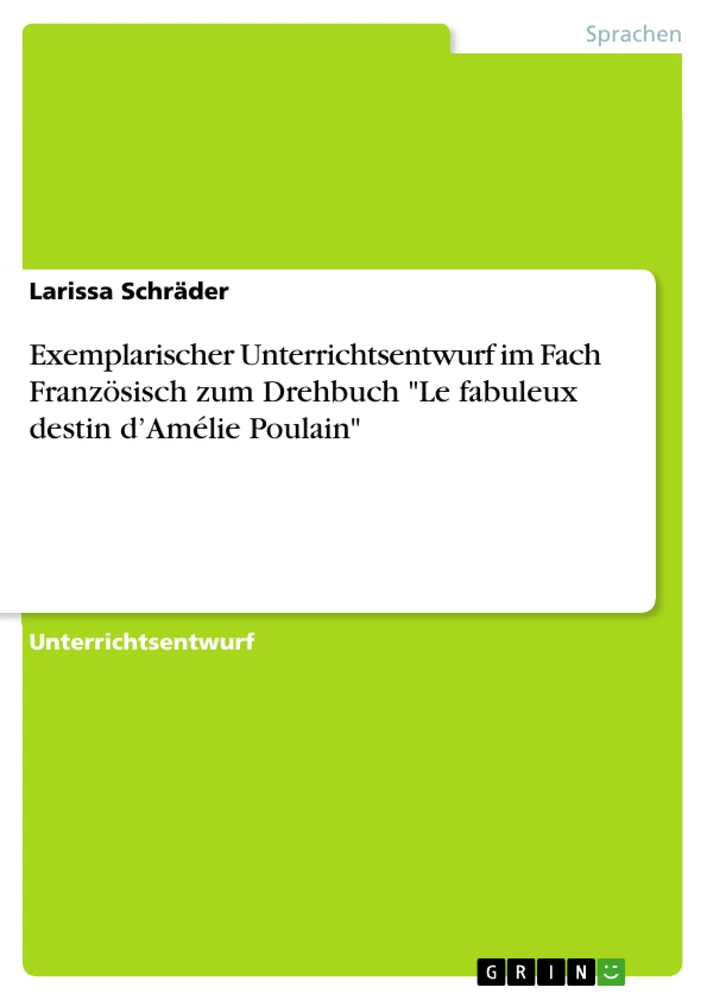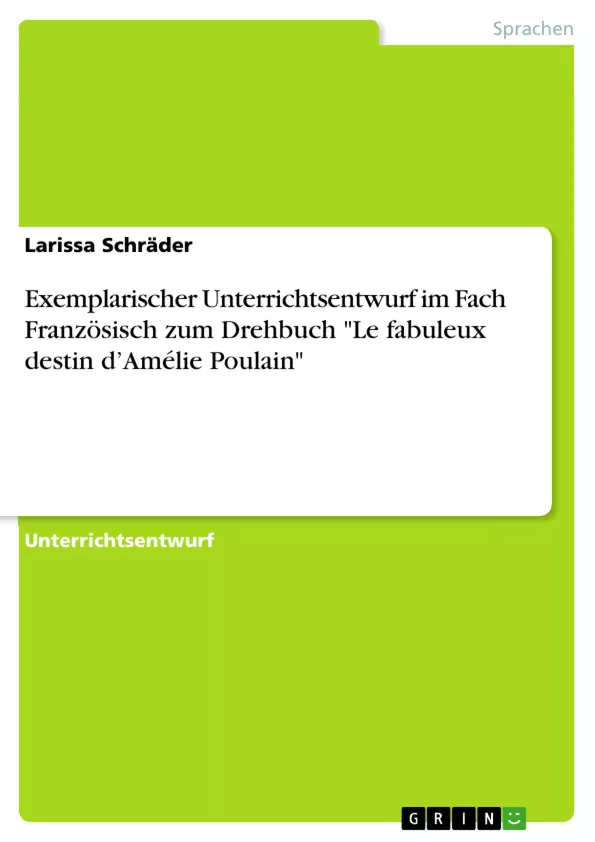In diesem Unterrichtsentwurf wird versucht, eine Doppelstunde zum Drehbuch "Le fabuleux destin d’Amélie Poulain" im Französischunterricht zu entwerfen.
Die Suche nach dem Glück und einer erfüllenden Liebe ist in unserer heutigen Gesellschaft ein zentrales und allgegenwärtiges Thema. Sie ist verbunden mit dem Bestreben des modernen Menschen, sein Leben selbst zu bestimmen und sich zu verwirklichen. In dem Drehbuch zu dem gleichnamigen Spielfilm "Le fabuleux destin d’Amélie Poulain" greifen Jean-Pierre Jeunet und Guillaume Laurant dieses Thema aus der Perspektive der jungen, in Paris isoliert lebenden Amélie auf. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Café im Stadtteil Montmartre und erträumt sich ihre eigene Welt. Obwohl ihr Alltag eher grau erscheint, findet sie Freude an den kleinen Dingen des Lebens.
Eines Tages beschließt sie, ausgelöst durch den Fund eines kleinen Kästchens, Menschen in ihrem Umfeld zu einem glücklicheren Leben zu verhelfen. Sie spielt Schicksal und inszeniert scheinbare Zufälle. Auch wenn sie in der Erfüllung des Glückes anderer eine Art Berufung findet und dies ein wichtiger Bestandteil ihres eigenen Glückes darstellt, droht das große Glück und die eigene Liebe auf der Strecke zu bleiben. Ihr Nachbar zeigt ihr schließlich auf, dass sie sich auch um ihr eigenes Glück kümmern muss und ermutigt Amélie dazu, sich dem Leben und dem Umgang mit Menschen zu stellen.
Die geplante 90-minütige Doppelstunde bezieht sich thematisch auf das Ende des 7. Kapitels und spielt in dem Café, in dem Amélie arbeitet. In diesem Abschnitt geht es um das Rezept Suzannes für einen coup de foudre und den Versuch Amélies, dieses am Beispiel von Georgette und dem krankhaft eifersüchtigen, fast psychopatischen Stammgast Joseph umzusetzen. Das Rezept von Suzanne Idee besteht aus der Idee, zwei alleinstehende Menschen in dem Glauben zu lassen, dass der andere ihn unwiderstehlich findet. Sie ist von der Wirkung dieses Rezepts überzeugt und geht davon aus, dass die beiden Betroffenen sich verlieben. Amélie, begeistert von der Idee, möchte dies sofort ausprobieren und knöpft sich zunächst Joseph vor, der bisher nur Augen für Gina hatte. Danach folgt ein Gespräch mit Georgette, in dem Amélie versucht auch sie zu überzeugen, dass Joseph nur so häufig ihretwegen in das Café kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Lehr- und Lernvoraussetzungen
- Didaktische Begründung des Themas
- Sachanalyse
- Didaktische Transformation des Themas
- Lehr- und Lernziele
- Hauptlernziel
- Fachliche Kompetenzen und Indikatoren
- Überfachliche Kompetenzen
- Tabellarischer Verlaufsplan zur Stunde
- Didaktisch-methodische Begründungen der einzelnen Lern- bzw. Unterrichtsschritte
- Bibliographie
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, die Textkompetenz von Schülerinnen und Schülern in der zwölften Jahrgangsstufe im Fach Französisch zu fördern, indem sie mit dem Drehbuch "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" von Jean-Pierre Jeunet arbeiten. Die Stunde konzentriert sich auf die Darstellung von Liebe und Glück in der Lebenswelt der Figuren und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich mit den Themen "projets de vie", "amour" und "identité" auseinanderzusetzen.
- Die Suche nach dem Glück und einer erfüllenden Liebe
- Die Bedeutung der eigenen Träume und Sehnsüchte
- Die Rolle von Zufall und Schicksal im Leben
- Die Fähigkeit, Liebe zu finden und zu leben
- Die Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Lehr- und Lernvoraussetzungen skizzieren die Situation der Lerngruppe und ihre Stärken und Schwächen im Fach Französisch. Die didaktische Begründung des Themas verdeutlicht die Relevanz des Drehbuchs "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" für den Unterricht und den Fokus auf Themen wie Liebe und Identität. Die Sachanalyse stellt den Inhalt des Drehbuchs und dessen Kontext vor, während die didaktische Transformation des Themas die methodischen Ansätze und die Lernziele der Stunde erläutert. Die Lehr- und Lernziele umreißen die angestrebten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter für diesen Unterrichtsentwurf sind: "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain", "Jean-Pierre Jeunet", "Drehbuch", "Textkompetenz", "Liebe", "Glück", "Identität", "projets de vie", "amour", "Zufall", "Schicksal", "Rollenspiel", "Interkulturelle Kompetenz", "Lebenswelt".
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel hat der Französischunterricht zu „Amélie Poulain“?
Das Hauptziel ist die Förderung der Textkompetenz und die Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Glück und Identität anhand des Original-Drehbuchs von Jean-Pierre Jeunet.
Welche Rolle spielt das Thema Glück im Unterrichtsentwurf?
Glück wird als zentrales Motiv untersucht: Amélie versucht, das Glück anderer zu inszenieren, muss dabei aber lernen, auch Verantwortung für ihr eigenes Glück und ihre Liebe zu übernehmen.
Was ist das „Rezept für einen coup de foudre“?
Es ist eine Idee der Figur Suzanne, zwei einsame Menschen in dem Glauben zu lassen, der jeweils andere fände sie unwiderstehlich, um so eine Verliebtheit (den „Blitzschlag“) zu provozieren.
Für welche Jahrgangsstufe ist dieser Entwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für eine 12. Jahrgangsstufe im Fach Französisch gedacht, da er komplexe Themen wie Lebensentwürfe und interkulturelle Kompetenz behandelt.
Welche Methoden werden in der Doppelstunde angewendet?
Es kommen analytische Textarbeit, Rollenspiele und didaktisch-methodische Schritte zur Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit und Interpretation zum Einsatz.
- Citar trabajo
- Master Ed. Larissa Schräder (Autor), 2016, Exemplarischer Unterrichtsentwurf im Fach Französisch zum Drehbuch "Le fabuleux destin d’Amélie Poulain", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494802