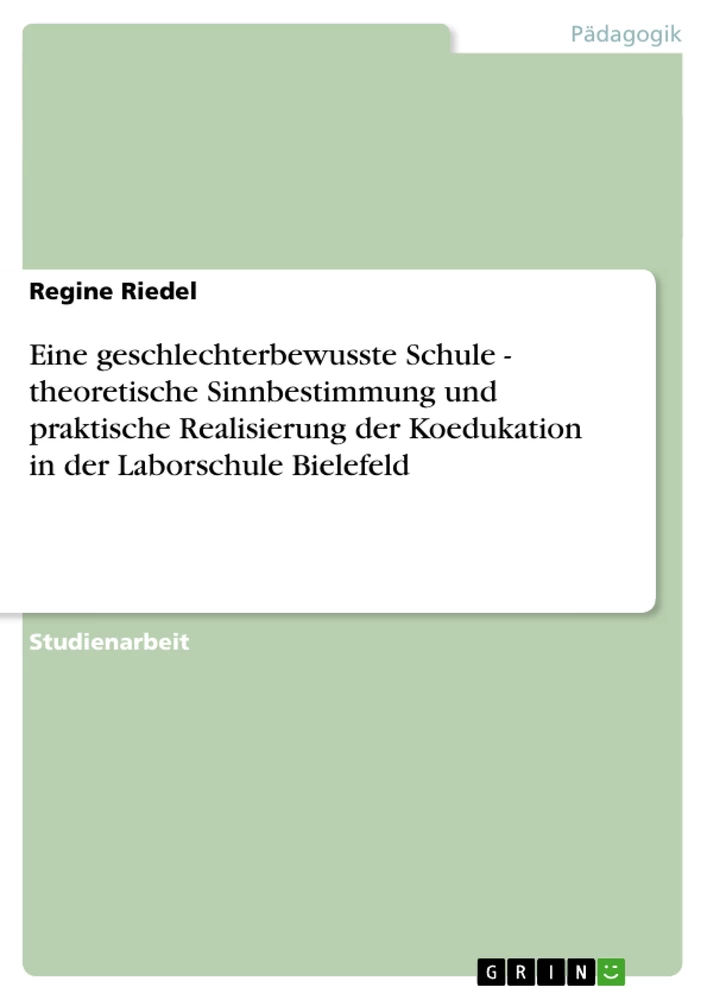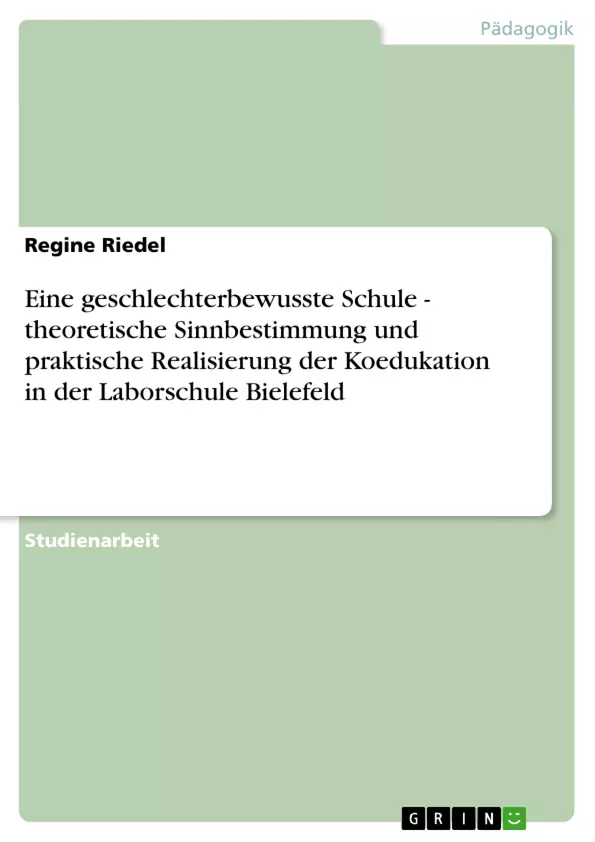Um der Frage nach der Bedeutsamkeit der Koedukation auf den Grund zu gehen, bedarf es einer geschlechtsspezifischen Sozialisationsforschung. Doch hat geschlechtsspezifische Sozialisationsforschung einen Sinn? Denn schließlich ist „ bislang weder der Begriff der Geschlechtersozialisation expliziert noch das neue Gesicht der Geschlechtersozialisation ausgearbeitet worden“.
Es scheint in der Tat keine Thematik zu sein, die sich so eindeutig bearbeiten, oder aufklären lässt, wie eine Formel in der Mathematik. Ich habe es mir dennoch zur Aufgabe gemacht, im ersten Teil dieser Arbeit einige Thesen und Forschungsergebnisse Anderer aufzugreifen, um die Thematik der Koedukation und somit auch der Geschlechtersozialisation, etwas transparenter werden zu lassen.
Helga Bilden versteht unter Sozialisation oder Entwicklung einen „Prozeß, in dem aus einem Neugeborenen ein in seiner Gesellschaft handlungsfähiges Subjekt wird (und bleibt)“. Den Grund für die mangelhaften Forschungsergebnisse der geschlechtspezifischen Sozialisation sieht sie in dem Problem der „Konstruktion eines bipolaren Geschlechterdualismus.“ Denn die Frage nach der geschlechtsspezifischen Sozialisation bedeutet gleichsam die Sozialisationsbedingungen geschlechtsdifferenzierend zu untersuchen; was auch bedeutet, nach Unterschieden bei den Geschlechtern im Fühlen, Denken usw. zu suchen. So konstruiert man sich zwangläufig einen männlichen und weiblichen Sozialcharakter und „reproduzier[t] den schematischen Dualismus von männlich und weiblich.“ Diesem Ansatz möchte ich zu Beginn meiner Arbeit etwas näher auf den Grund gehen. Zudem werde ich einige Untersuchungen und Beobachtungen aus der Schulpraxis, in geschlechts-soziologischer Sicht, beschreiben und auswerten.
Um einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung der Thematik gerecht zu werden, soll, neben den vordergrüngig theoretischen Betrachtungen der Koedukation im ersten Teil der Arbeit, auch den empirischen Belegen Beachtung geschenkt werden: Im zweiten Teil dieser Arbeit wird der Fokus daher auf konkrete praktische Realisierungsmöglichkeiten
geschlechterbewusster schulischer Sozialisation gerichtet werden. Hierfür soll der Blick auf die Laborschule in Bielefeld gerichtet werden, da hier in den letzten Jahren zahlreiche Beispiele eines kritischen Umgangs mit der Koedukation zu verzeichnen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Sinnbestimmung der Koedukation
- Einige Thesen zur geschlechterspezifischen Sozialisation
- Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Koedukation
- Ein bewusster praktischer Umgang mit der Koedukation: Die Laborschule in Bielefeld
- Ein kurzer zeitlicher Abriss der koedukativen Entwicklung in der Laborschule
- Die aktuelle Realisierung der Koedukation in der Laborschule
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Koedukation im Bildungssystem. Sie untersucht, wie geschlechterbewusste Schulentwicklung die Sozialisationsprozesse von Mädchen und Jungen beeinflussen kann. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse theoretischer Ansätze zur geschlechtspezifischen Sozialisation sowie der konkreten Umsetzung der Koedukation in der Laborschule Bielefeld.
- Theoretische Fundierung der Koedukation
- Kritik an geschlechtsdifferenzierenden Sozialisationsmodellen
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Koedukation in der Praxis
- Die Laborschule Bielefeld als Beispiel für eine geschlechterbewusste Schule
- Die Bedeutung von geschlechtergerechter Bildung für die Zukunft der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der geschlechterbewussten Bildung und die Bedeutung von Koedukation in den Kontext der aktuellen Bildungslandschaft. Sie beleuchtet die Problematik der Geschlechterforschung und die Schwierigkeit, eindeutige Aussagen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation zu treffen.
Theoretische Sinnbestimmung der Koedukation
Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Koedukation. Es analysiert verschiedene Thesen zur geschlechterspezifischen Sozialisation und hinterfragt die Sinnhaftigkeit von traditionellen Geschlechterrollen. Die Autorin kritisiert die Konstruktion eines bipolaren Geschlechterdualismus und plädiert für eine differenziertere Betrachtung von Geschlecht und Sozialisation.
Ein bewusster praktischer Umgang mit der Koedukation: Die Laborschule in Bielefeld
In diesem Kapitel wird die Laborschule in Bielefeld als Beispiel für eine Schule vorgestellt, die einen bewussten und reflektierten Umgang mit der Koedukation praktiziert. Die Autorin beschreibt die historische Entwicklung der Schule und zeigt, wie sie sich im Laufe der Jahre zu einem Modell für eine geschlechterbewusste Schule entwickelt hat. Sie beleuchtet die aktuellen Konzepte und Methoden, die in der Laborschule angewendet werden, um eine geschlechtergerechte Bildung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Koedukation, geschlechterbewusste Bildung, geschlechterspezifische Sozialisation, Geschlechterrollen, Schulentwicklung, Laborschule Bielefeld, Bildungsgerechtigkeit, Pädagogik, Sozialisationstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Koedukation im schulischen Kontext?
Koedukation bezeichnet die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Mädchen und Jungen in einer Schule.
Welche Kritik gibt es am traditionellen Verständnis der Geschlechtersozialisation?
Kritiker bemängeln die Konstruktion eines "bipolaren Geschlechterdualismus", der starre Rollenbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit reproduziert, anstatt individuelle Potenziale zu fördern.
Was macht die Laborschule Bielefeld in Bezug auf Koedukation besonders?
Die Laborschule verfolgt einen geschlechterbewussten Ansatz, der die Koedukation kritisch reflektiert und praktische Konzepte entwickelt, um Geschlechtergerechtigkeit im Alltag umzusetzen.
Wie definiert Helga Bilden den Prozess der Sozialisation?
Sie versteht darunter einen Prozess, in dem aus einem Neugeborenen ein in seiner Gesellschaft handlungsfähiges Subjekt wird.
Warum ist geschlechtergerechte Bildung für die Gesellschaft wichtig?
Sie trägt zur Bildungsgerechtigkeit bei und ermöglicht es Kindern, sich unabhängig von stereotypen Rollenerwartungen zu entwickeln.
- Quote paper
- Regine Riedel (Author), 2006, Eine geschlechterbewusste Schule - theoretische Sinnbestimmung und praktische Realisierung der Koedukation in der Laborschule Bielefeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49501