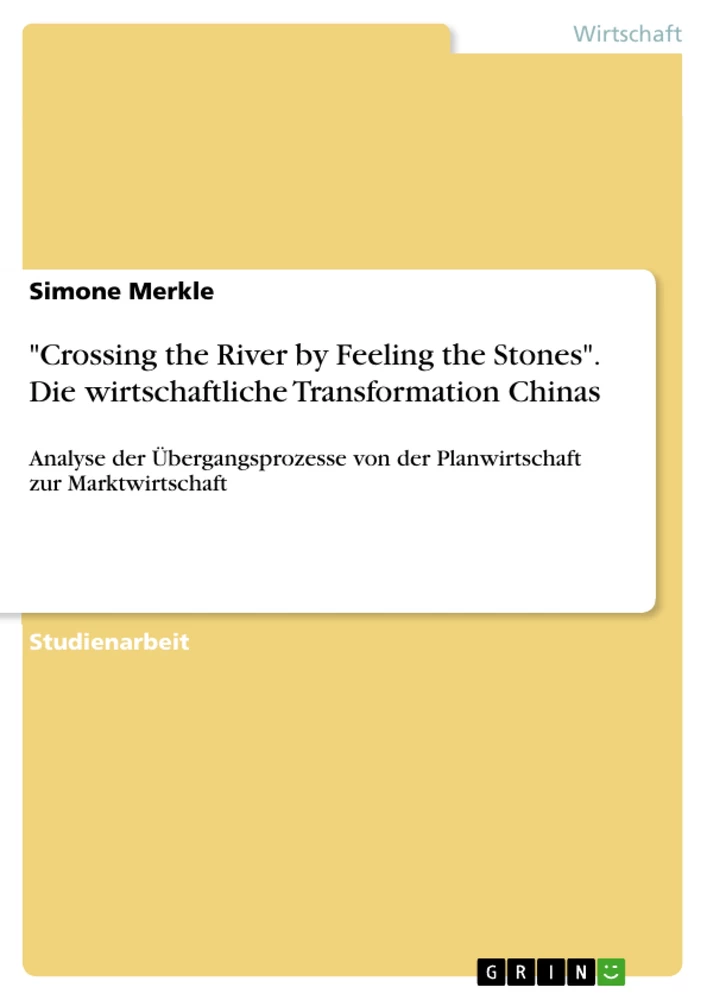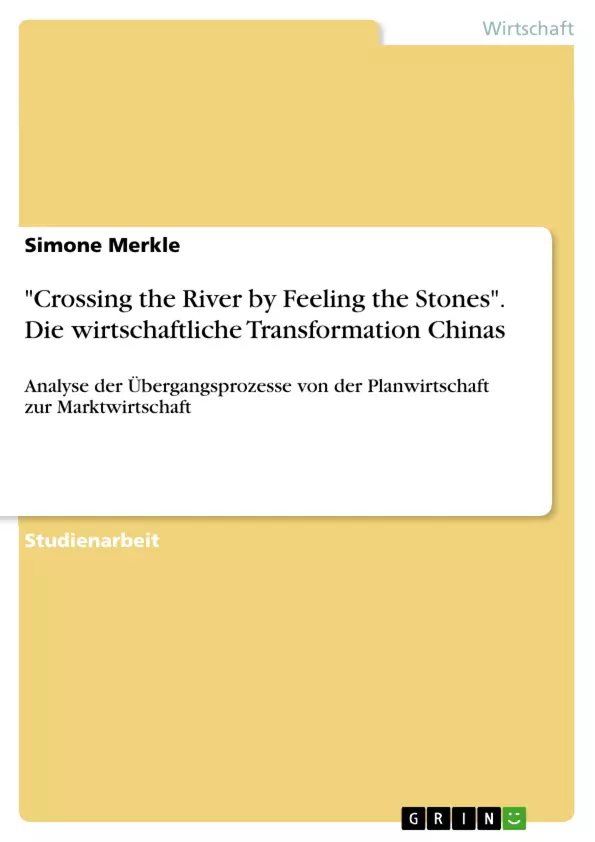Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Übergangsprozessen von Chinas Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Beginnend wird thematisch in die politische und wirtschaftliche Geschichte eingeführt, wobei auf die Herrschaftsperioden Mao Zedongs und Deng Xiaopings eingegangen wird. Hierbei liegt die Konzentration auf einschneiden historische Reformen, wie zum Beispiel die Agrarreformen. Weiterführend wird die Priorität auf die Transformationsstrategie in Form des Dual-Track-Systems liegen, wobei wichtige Aspekte der zwei Phasen Strategie, der Marktöffnung sowie der De- und Rezentralisierung erklärt werden.
Um aktuelle Züge der chinesischen Wirtschaft aufzugreifen, werden im abschließenden Kapitel aktuelle Entwicklungsindikatoren samt wichtigen Hindernissen der Disparität, Auslandsnachfrage und der Energieabhängigkeit Chinas aufgezeigt, um die Arbeit mit einem aktuellen Bezug abzurunden.
Es steht die Frage im Fokus, wie sich der beeindruckende wirtschaftliche Aufstieg Chinas möglich war und welche Probleme für eine zukünftige Entwicklung auftreten.
„Made in China“ – Dieser Slogan ist allgegenwärtig, denn Chinas wirtschaftliche Supermacht ist in aller Munde. Die Zahl der Produkte, die aus China zu uns kommen, wächst stetig. Abgesehen von der Popularität Chinas bewegt sich das Land immer mehr weg von dem ursprünglichen Schwellenlandstatus hin zu einem entwickelten Industriestaat. Chinas große Population und das damit verbundene Arbeitskräftepotential haben den Weg einer wirtschaftlichen Entwicklung gebettet, die sich von denen anderer Länder unterscheidet. Der ökonomische Systemübergang ist äußerst erfolgreich und gestaltet sich im Gegensatz zu radikalen Transformationen als eine Politik des sanften Wandels.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der chinesischen Geschichte aus wirtschaftlicher und politischer Sicht
- China unter Mao Zedong
- Der Übergang der maoistischen Wirtschaftspolitik zu Deng Xiaoping
- Die Deng'sche Wende: Chinas Wirtschaft unter Deng Xiaoping
- Vom Plan zum Markt
- Erste Reformen im Agrarsektor
- Dual-Track-System
- Öffnung der Märkte
- Die Zwei Phasen des Transitionsprozesses
- De- und Rezentralisierung
- Dual Track Mechanismus im theoretischen Modell
- Entwicklungsindikatoren Chinas – Ein Überblick
- Auslandsnachfrage
- Energieabhängigkeit
- Disparität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Übergangsprozessen von Chinas Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Im Fokus stehen die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die China in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat, insbesondere die Herrschaftsperioden Mao Zedongs und Deng Xiaopings. Dabei werden wichtige Reformen wie die Agrarreformen und die Transformationsstrategie in Form des Dual-Track-Systems untersucht. Die Arbeit analysiert die Öffnung der Märkte, die De- und Rezentralisierung sowie die zwei Phasen des wirtschaftlichen Übergangs. Darüber hinaus werden aktuelle Entwicklungsindikatoren und wichtige Hindernisse für die weitere Entwicklung Chinas wie Disparität, Auslandsnachfrage und Energieabhängigkeit beleuchtet.
- Chinas wirtschaftlicher Aufstieg: Von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft
- Die Rolle der Politik und der Reformen in Chinas Wirtschaftsentwicklung
- Das Dual-Track-System als Transformationsstrategie
- Die Herausforderungen der Marktwirtschaft in China
- Aktuelle Entwicklungsindikatoren und Zukunftsaussichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung liefert einen Überblick über den Kontext der Arbeit und stellt die wichtigsten Fragestellungen und Themen vor.
- Grundzüge der chinesischen Geschichte aus wirtschaftlicher und politischer Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die chinesische Geschichte, insbesondere die Herrschaftsperioden Mao Zedongs und Deng Xiaopings, und zeigt die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Veränderungen auf.
- Vom Plan zum Markt: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft in China und analysiert die wichtigsten Reformen, das Dual-Track-System, die Öffnung der Märkte sowie die De- und Rezentralisierung.
- Entwicklungsindikatoren Chinas – Ein Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet aktuelle Entwicklungsindikatoren und wichtige Hindernisse für die weitere Entwicklung Chinas wie Disparität, Auslandsnachfrage und Energieabhängigkeit.
Schlüsselwörter
Chinas Wirtschaft, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, Transformation, Dual-Track-System, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Agrarreformen, Öffnung der Märkte, De- und Rezentralisierung, Entwicklungsindikatoren, Disparität, Auslandsnachfrage, Energieabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Metapher „Crossing the River by Feeling the Stones“?
Dieser Ausspruch von Deng Xiaoping beschreibt Chinas Strategie der schrittweisen und pragmatischen wirtschaftlichen Transformation – im Gegensatz zu einer radikalen „Schocktherapie“.
Was ist das Dual-Track-System in der chinesischen Wirtschaft?
Es ist eine Übergangsstrategie, bei der Planwirtschaft und Marktwirtschaft nebeneinander existierten. Betriebe mussten staatliche Quoten zu Festpreisen erfüllen, durften Überschüsse aber zu Marktpreisen verkaufen.
Welche Rolle spielten die Agrarreformen für Chinas Aufstieg?
Die Agrarreformen unter Deng Xiaoping waren der erste Schritt der Öffnung. Die Auflösung der Volkskommunen und die Einführung individueller Anreize steigerten die Produktivität massiv und legten die Basis für weiteres Wachstum.
Vor welchen Herausforderungen steht die chinesische Wirtschaft heute?
Zu den größten Hindernissen zählen die wachsende soziale Disparität (Ungleichheit), die hohe Abhängigkeit von Energieimporten und die Schwankungen der Auslandsnachfrage.
Wie unterschied sich die Wirtschaftspolitik von Mao und Deng?
Während Maos Ära von einer strengen Planwirtschaft und ideologischen Kampagnen geprägt war, leitete Deng eine Ära der Reformen, der Marktöffnung und der Dezentralisierung ein.
- Citation du texte
- Simone Merkle (Auteur), 2017, "Crossing the River by Feeling the Stones". Die wirtschaftliche Transformation Chinas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495152