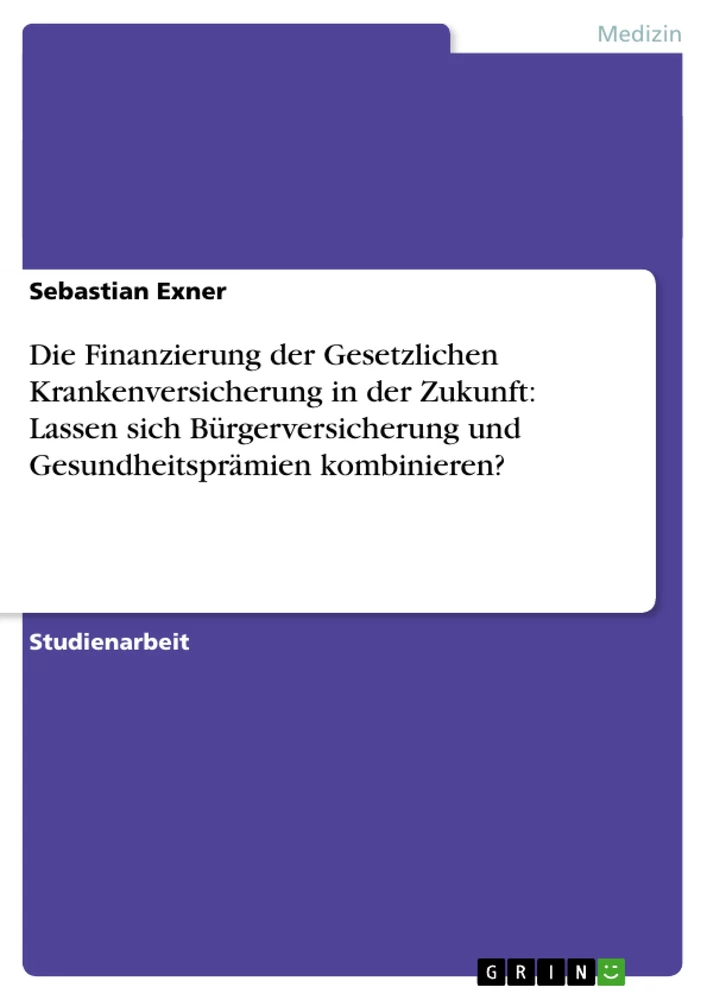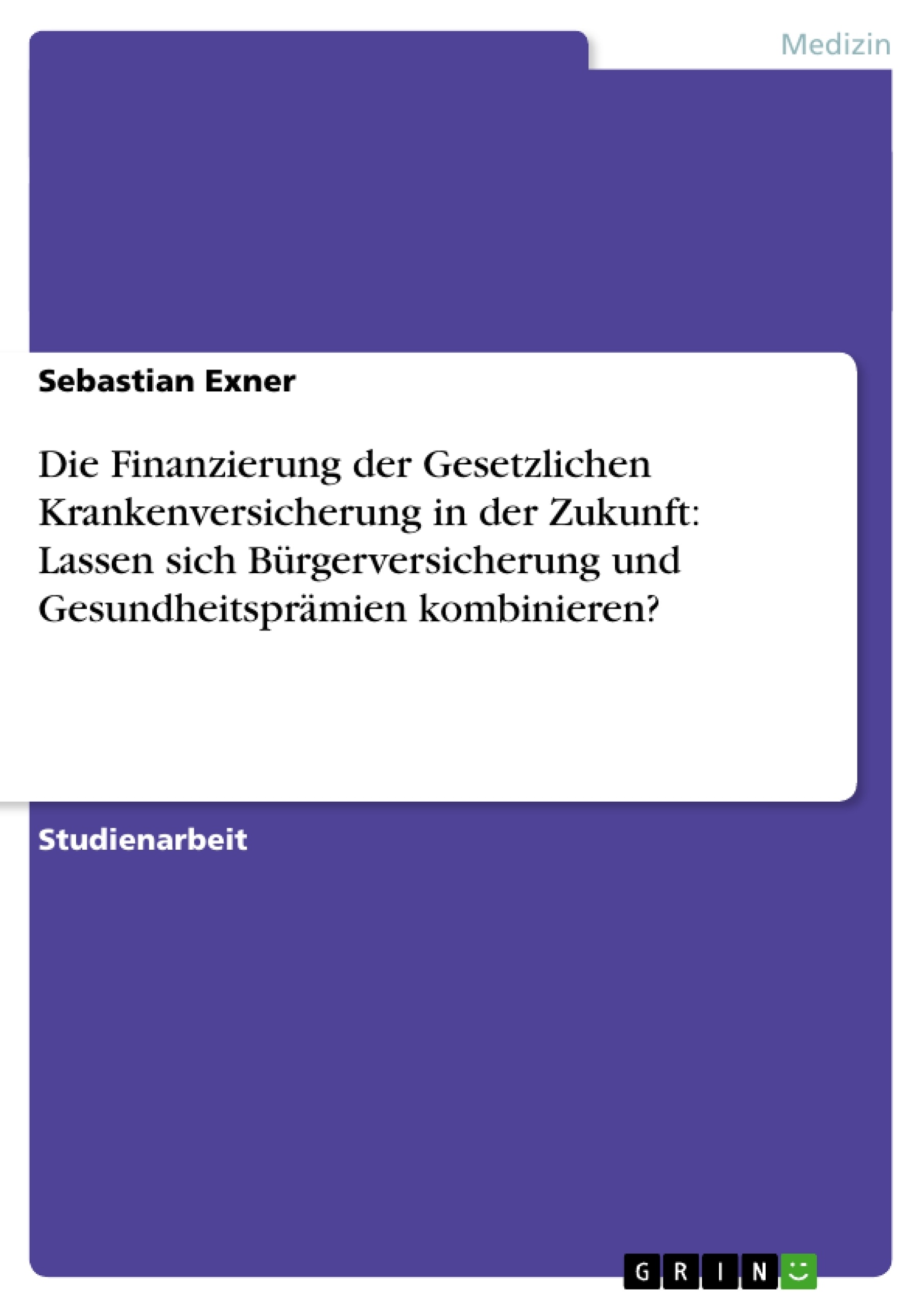In der gesetzlichen Krankenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit ca. 71 Millionen Menschen, also ungefähr 90% der Gesamtbevölkerung, versichert1. Gesetzliche Regelungen zu den Mitgliedern der GKV finden sich im SGB V. Ausgehend von einer Pflicht zur Versicherung in der GKV für Arbeiter, Angestellte Beschäftigte, Arbeitslose, Behinderte, Rentner und Student en findet sich auch die Möglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht für Personen, deren Jahreslohn die sog. Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt. Nach den Absätzen 6 und 7 des § 6 SGB V liegt diese derzeit bei 42.300 EUR. Die GKV finanziert sich durch Beiträge. Diese bemessen sich prozentual am Arbeitslohn und sind jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlen. Der Beitrag orientiert sich also an der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Person. Wenigverdiener zahlen geringere Beiträge, gut verdienende Personen dafür mehr. Dies, verbunden mit der Tatsache, daß die Beiträge unabhängig von dem jeweiligen Gesundheitszustand des Versicherten erhoben werden, manifestiert das der GKV zu Grunde liegende Solidaritätsprinzip. Eine weitere Säule in der Organisation und Finanzierung der GKV ist das Sachleistungsprinzip. Es bedeutet, daß, unabhängig von den entstehenden Kosten, jeweils das medizinisch Notwendige für den jeweiligen Patienten geleistet wird. Das Gewähren der medizinischen Sachleistung erfolgt für den Patienten also ohne mit dem Leistungserbringer in eine ökonomische Beziehung treten zu müssen. Die Wirtschaftskraft der verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen wird durch den Risikostrukturausgleich sichergestellt. Etwaige aus der Mitgliederstruktur resultierende Wettbewerbsvorteile sollen dadurch vermieden bzw. die Nachteile ausgeglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung...
- Aktuelle Probleme..
- Die Bürgerversicherung...
- Das Modell der Gesundheitsprämien....
- Kombinationsansätze..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland. Sie analysiert die aktuellen Probleme der Finanzierung, insbesondere die demographischen Herausforderungen, und diskutiert zwei alternative Finanzierungsmodelle: die Bürgerversicherung und das Modell der Gesundheitsprämien. Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile beider Modelle und betrachtet Möglichkeiten, sie zu kombinieren.
- Finanzierung der GKV in Deutschland
- Aktuelle Herausforderungen der GKV-Finanzierung
- Das Konzept der Bürgerversicherung
- Das Modell der Gesundheitsprämien
- Kombinationsansätze zur GKV-Finanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung
Dieses Kapitel beschreibt das deutsche GKV-System und seine Finanzierung durch Beiträge. Es erläutert das Solidaritätsprinzip und das Sachleistungsprinzip sowie den Risikostrukturausgleich.
Aktuelle Probleme
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der GKV-Finanzierung, die aus dem demographischen Wandel, der steigenden Lebenserwartung und dem Rückgang der Geburtenrate resultieren. Es werden auch die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die GKV-Finanzierung betrachtet.
Die Bürgerversicherung
Dieses Kapitel diskutiert das Konzept der Bürgerversicherung als alternative Finanzierungsform der GKV. Es beschreibt die Grundprinzipien und die potenziellen Vor- und Nachteile dieses Modells.
Das Modell der Gesundheitsprämien
Dieses Kapitel stellt das Modell der Gesundheitsprämien als alternative Finanzierungsform vor. Es erläutert die Funktionsweise dieses Modells und die damit verbundenen Chancen und Risiken.
Schlüsselwörter
Gesetzliche Krankenversicherung, Finanzierung, Bürgerversicherung, Gesundheitsprämien, Solidaritätsprinzip, Sachleistungsprinzip, Risikostrukturausgleich, Demographischer Wandel, Arbeitslosigkeit, Sozialversicherung, Gesundheitskosten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) aktuell finanziert?
Die GKV finanziert sich primär durch einkommensabhängige Beiträge, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, basierend auf dem Solidaritätsprinzip.
Was sind die größten Herausforderungen für die GKV-Finanzierung?
Der demographische Wandel, die steigende Lebenserwartung bei sinkenden Geburtenraten und die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit belasten das System.
Was ist das Konzept der Bürgerversicherung?
Die Bürgerversicherung sieht vor, die Versicherungspflicht auf alle Bürger auszuweiten und möglicherweise weitere Einkommensarten neben dem Lohn für die Beitragsbemessung heranzuziehen.
Was versteht man unter dem Modell der Gesundheitsprämien?
Gesundheitsprämien (oft auch Kopfpauschalen genannt) sind einkommensunabhängige Beiträge, die für jeden Versicherten gleich hoch sind, oft ergänzt durch einen sozialen Steuerausgleich.
Was besagt das Sachleistungsprinzip in der GKV?
Es garantiert, dass Patienten medizinisch notwendige Leistungen erhalten, ohne direkt in eine ökonomische Beziehung mit dem Leistungserbringer (Arzt) treten zu müssen.
- Quote paper
- Sebastian Exner (Author), 2004, Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung in der Zukunft: Lassen sich Bürgerversicherung und Gesundheitsprämien kombinieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49544