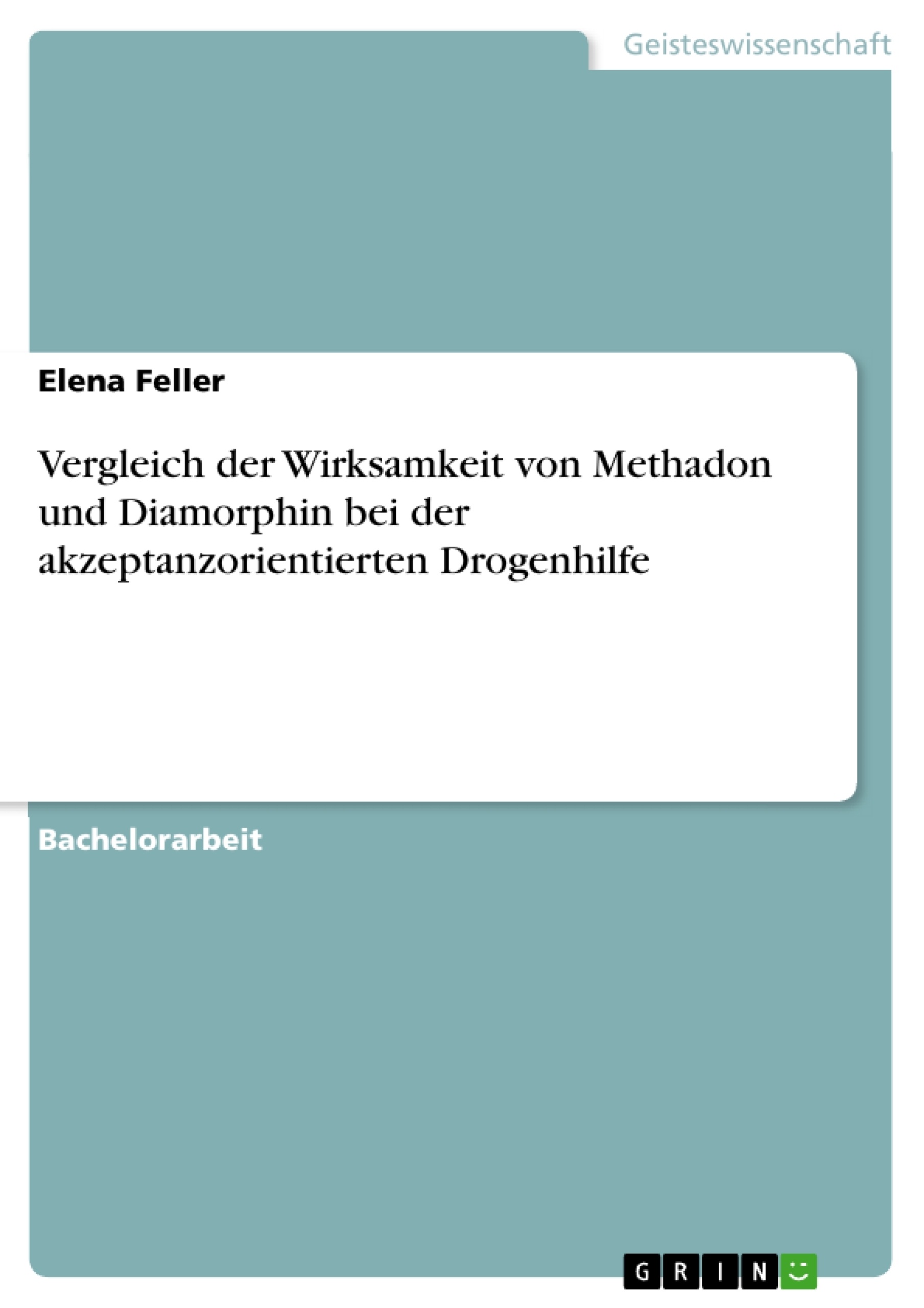Die Bachelorarbeit im Fachbereich der Sozialen Arbeit untersucht die Unterschiede von Methadon und Diamorphin. Die Vergleichbarkeit der beiden Substitute erfolgt anhand der Prinzipien und Ziele der akzeptanzorientierten Drogenarbeit. Für die Ausarbeitung wurde eine quantitative Forschung durchgeführt, die bundesweit in insgesamt drei Substitutionsambulanzen anerkannt wurde.
Hintergrund bildet die Annahme, dass Diamorphin letztlich besser geeignet ist, um die Ziele der akzeptanzorientierten Drogenarbeit zu erfüllen und somit die Zahl der Drogentodesfälle herabzuschrauben. Die Hypothese soll schwerpunktmäßig mit Hilfe des nordrhein-westfälischen Erprobungsvorhabens, des Bundesdeutschen Modellprojekts, sowie der Durchführung einer eigenen Untersuchung genauer betrachtet werden. Letzten Endes soll folgende Frage beantwortet werden: Welcher Substitutionsstoff ist tatsächlich besser geeignet, um die Ziele der akzeptanzorientierten Drogenarbeit zu erfüllen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sucht und Abhängigkeit
- 3 Die Situation opiatabhängiger Menschen
- 3.1 Körperliche Situation
- 3.2 Psychische Situation
- 3.3 Soziale Situation
- 4 Die bundesweite Drogenhilfe
- 4.1 Abstinenzorientierte Drogenarbeit
- 4.2 Akzeptanzorientierte Drogenarbeit
- 4.2.1 Grundannahmen der akzeptanzorientierten Drogenarbeit
- 4.2.2 Prinzipien der akzeptanzorientierten Drogenarbeit
- 4.2.3 Ziele der akzeptanzorientierten Drogenarbeit
- 5 Die Substitutionsbehandlung
- 5.1 Ziele der Substitutionsbehandlung
- 5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 5.3 Psychosoziale Begleitung
- 5.4 Substitutionsstoffe
- 5.4.1 Methadon
- 5.4.2 Diamorphin
- 6 Methadon- und Diamorphinsubstitutionsmodelle
- 6.1 Hannoversche Modellversuch und das nordrhein-westfälische Erprobungsvorhaben
- 6.2 Das Bundesdeutsche Modellprojekt
- 7 Eigene Untersuchung
- 7.1 Methode
- 7.2 Entwicklung des Fragebogens
- 7.3 Durchführung
- 7.4 Datenauswertung
- 7.4.1 Methadonuntersuchung
- 7.4.2 Diamorphinuntersuchung
- 7.5 Zusammenfassende Betrachtung
- 7.6 Kritik der Untersuchung
- 8 Methadon- und Diamorphinsubstitution im Vergleich
- 8.1 Allgemein
- 8.1.1 Mortalität
- 8.1.2 Haltequote
- 8.1.3 Beikonsum
- 8.1.4 Kriminalitätsverhalten
- 8.2 Gesundheitliche Situation
- 8.2.1 Physische Situation
- 8.2.2 Psychische Situation
- 8.3 Soziale Situation
- 8.3.1 Arbeitsverhältnisse
- 8.3.2 Wohnverhältnisse
- 8.3.3 Soziale Kontakte
- 8.4 Aktivierung der Selbsthilfepotenziale
- 8.1 Allgemein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, Methadon und Diamorphin als Substitutionsstoffe im Kontext der akzeptanzorientierten Drogenarbeit zu vergleichen. Die Arbeit untersucht die Effektivität beider Substanzen anhand verschiedener Kriterien wie Mortalität, Haltequote, Beikonsum und sozialer Integration. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen der jeweiligen Substitution auf die körperliche, psychische und soziale Situation opiatabhängiger Menschen.
- Vergleich von Methadon und Diamorphin als Substitutionsstoffe
- Auswirkungen der Substitutionsbehandlung auf die Lebensqualität Betroffener
- Analyse verschiedener Erfolgskriterien der Substitutionstherapie
- Bewertung der akzeptanzorientierten Drogenarbeit im Kontext der Substitutionsbehandlung
- Diskussion der rechtlichen und ethischen Aspekte der Substitutionsbehandlung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit ein und begründet die Wahl von Methadon und Diamorphin als Vergleichssubstanzen. Sie stellt die akzeptanzorientierte Drogenarbeit als relevanten Kontext vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Sucht und Abhängigkeit: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Sucht und Abhängigkeit und beschreibt die charakteristischen Merkmale und Folgen einer Opiatabhängigkeit. Es bildet die wissenschaftliche Grundlage für das Verständnis der Problematik und der Notwendigkeit von Substitutionsbehandlungen.
3 Die Situation opiatabhängiger Menschen: Hier wird die komplexe Situation opiatabhängiger Menschen aus körperlicher, psychischer und sozialer Perspektive beleuchtet. Es werden die gesundheitlichen Risiken, psychischen Belastungen und sozialen Ausgrenzungen detailliert dargestellt, um die Notwendigkeit von Interventionen zu unterstreichen.
4 Die bundesweite Drogenhilfe: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze der Drogenhilfe in Deutschland, mit einem Schwerpunkt auf dem Vergleich zwischen abstinenzorientierter und akzeptanzorientierter Drogenarbeit. Die Grundannahmen, Prinzipien und Ziele der akzeptanzorientierten Drogenarbeit werden ausführlich erläutert, um den Kontext der Substitutionsbehandlung zu verdeutlichen.
5 Die Substitutionsbehandlung: Dieses Kapitel widmet sich den Zielen, den rechtlichen Rahmenbedingungen und der psychosozialen Begleitung der Substitutionsbehandlung. Es werden die beiden Substitutionsstoffe Methadon und Diamorphin detailliert vorgestellt und ihre Eigenschaften im Kontext der Behandlung diskutiert.
6 Methadon- und Diamorphinsubstitutionsmodelle: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Modellversuche zur Methadon- und Diamorphinsubstitution in Deutschland, wie den Hannoverschen Modellversuch und das nordrhein-westfälische Erprobungsvorhaben, sowie das Bundesdeutsche Modellprojekt. Die Ergebnisse und Erfahrungen dieser Versuche werden analysiert und verglichen.
7 Eigene Untersuchung (ohne Zusammenfassung des Abschnitts 7.5 und 7.6): Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der eigenen Untersuchung, einschließlich der Entwicklung des Fragebogens, der Durchführung und der Datenauswertung. Die einzelnen Schritte der Untersuchung werden detailliert dargestellt.
8 Methadon- und Diamorphinsubstitution im Vergleich (ohne Zusammenfassung der Abschnitte 8.4, 8.1.4, 8.2, 8.3): Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der eigenen Untersuchung dar und vergleicht Methadon und Diamorphin hinsichtlich verschiedener Kriterien wie Mortalität, Haltequote und Beikonsum. Die Ergebnisse werden im Kontext der bisherigen Literatur und der Modellversuche diskutiert.
Schlüsselwörter
Methadon, Diamorphin, Opiatabhängigkeit, Substitutionsbehandlung, Akzeptanzorientierte Drogenarbeit, Drogenhilfe, Mortalität, Haltequote, Beikonsum, Soziale Integration, Psychische Gesundheit, Körperliche Gesundheit, Modellversuche, Vergleichsstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Methadon und Diamorphin im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit vergleicht die Effektivität von Methadon und Diamorphin als Substitutionsstoffe bei der Behandlung von Opiatabhängigkeit im Kontext der akzeptanzorientierten Drogenarbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen beider Substanzen auf die körperliche, psychische und soziale Situation der Betroffenen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Sucht und Abhängigkeit, die Situation opiatabhängiger Menschen (körperlich, psychisch, sozial), verschiedene Ansätze der Drogenhilfe (abstinenzorientiert vs. akzeptanzorientiert), die Substitutionsbehandlung (Ziele, rechtliche Rahmenbedingungen, psychosoziale Begleitung, Substitutionsstoffe), verschiedene Substitutionsmodelle (Hannoverscher Modellversuch, nordrhein-westfälisches Erprobungsvorhaben, Bundesdeutsches Modellprojekt), und eine eigene empirische Untersuchung zum Vergleich von Methadon und Diamorphin hinsichtlich verschiedener Kriterien (Mortalität, Haltequote, Beikonsum, soziale Integration).
Welche Methoden wurden in der eigenen Untersuchung verwendet?
Die Bachelorarbeit beinhaltet eine eigene empirische Untersuchung, deren Methodik detailliert beschrieben wird, einschließlich der Entwicklung eines Fragebogens, der Durchführung und der Datenauswertung. Die Ergebnisse werden getrennt für Methadon und Diamorphin dargestellt und verglichen.
Welche Kriterien wurden zum Vergleich von Methadon und Diamorphin herangezogen?
Methadon und Diamorphin werden anhand verschiedener Kriterien verglichen, darunter Mortalität, Haltequote, Beikonsum, Kriminalitätsverhalten, körperliche und psychische Gesundheit sowie die soziale Situation (Arbeitsverhältnisse, Wohnverhältnisse, soziale Kontakte). Die Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen wird ebenfalls betrachtet.
Welche Ergebnisse liefert die eigene Untersuchung?
Die Ergebnisse der eigenen Untersuchung werden im Kapitel 8 dargestellt und im Kontext der Literatur und der Ergebnisse der beschriebenen Modellversuche diskutiert. Eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse fehlt in der vorliegenden Inhaltsübersicht, jedoch werden die Hauptergebnisse im Vergleich von Methadon und Diamorphin bezüglich Mortalität, Haltequote und Beikonsum präsentiert.
Welche Rolle spielt die akzeptanzorientierte Drogenarbeit in dieser Arbeit?
Die akzeptanzorientierte Drogenarbeit bildet den zentralen Kontext der Arbeit. Die Grundannahmen, Prinzipien und Ziele dieser Herangehensweise werden ausführlich erläutert und in Bezug zur Substitutionsbehandlung gesetzt. Der Vergleich von Methadon und Diamorphin erfolgt innerhalb dieses Kontextes.
Welche rechtlichen und ethischen Aspekte werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Substitutionsbehandlung und berührt ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Behandlung von Opiatabhängigkeit. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesen Aspekten ist jedoch in der vorliegenden Zusammenfassung nicht explizit aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Methadon, Diamorphin, Opiatabhängigkeit, Substitutionsbehandlung, Akzeptanzorientierte Drogenarbeit, Drogenhilfe, Mortalität, Haltequote, Beikonsum, Soziale Integration, Psychische Gesundheit, Körperliche Gesundheit, Modellversuche, Vergleichsstudie.
- Arbeit zitieren
- Elena Feller (Autor:in), 2017, Vergleich der Wirksamkeit von Methadon und Diamorphin bei der akzeptanzorientierten Drogenhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495451