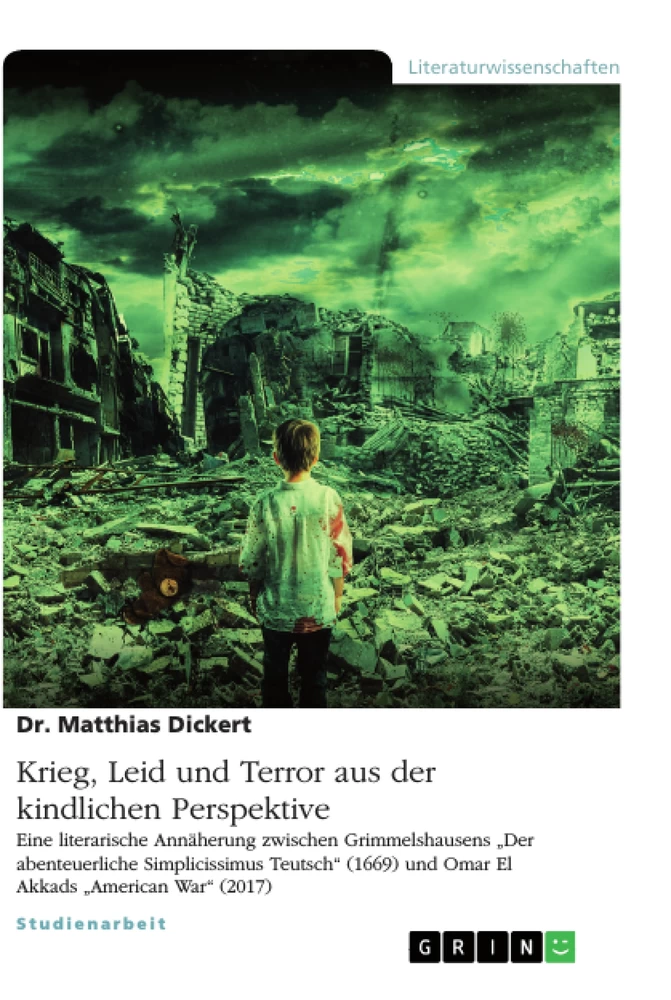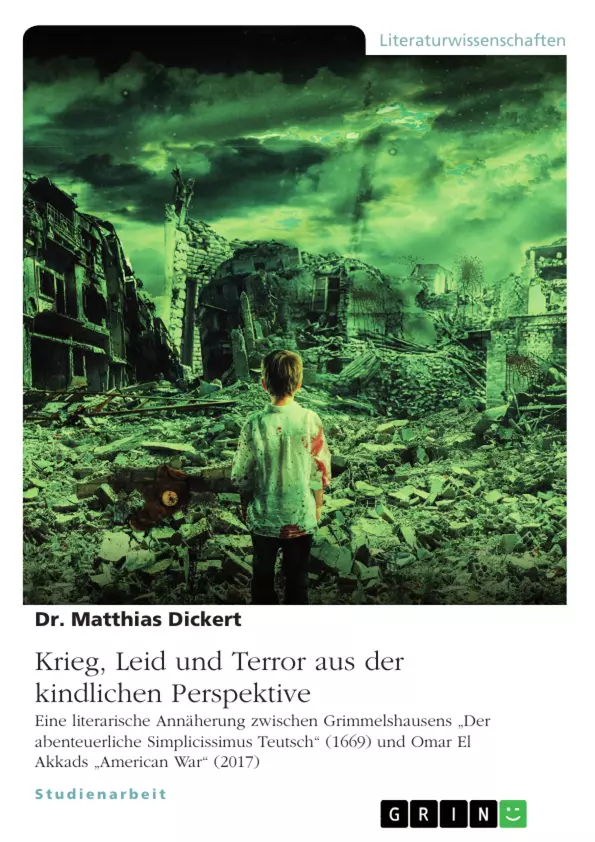Krieg, Leid und Terror haben die Literatur der Jahrhunderte beherrscht, weil Literatur immer auch Spiegel der jeweiligen Zeitepoche ist. Auffallend ist in der literarischen Aufarbeitung dieser Thematik ein durchgängiges Fehlen der kindlichen Perspektive, eine Tendenz, die sich bis heute gehalten hat. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig, verweisen aber auch auf eine gewisse Ignoranz gegenüber dieser Gruppe der Zivilbevölkerung, die besonders Opfer und Leidtragende von kriegerischen Handlungen waren und sind.
Die beiden hier untersuchten Romane können deshalb als Ausnahmen angesehen werden, da sie Kindsein im Krieg reflektieren und Krieg als ein Leitmotiv benutzt wird. Die große zeitliche Diskrepanz, hier das 17., dort das 21. Jahrhundert, sowie die verschiedenen Romantypen, hier biografisch und dort dystopisch, mögen zunächst einer gemeinsamen Analyse widersprechen, sie wird aber durch diese zentrale Rolle des Kindes im Krieg aufgehoben und verweist auf dessen literarische Bedeutung. Beide Autoren stellen Kindsein bewusst in die Kollision zwischen Frieden (Zukunft) und Krieg (Tod).
Für eine gemeinsame Analyse beider Werke spricht ebenfalls die autofiktionale Erzählform durch einen (alten) Erzähler, der die Handlung beider Romane prägt und die Erzählung vom Ende lenkt sowie reminiszierend begleitet. Diese beiden zentralen Parallelen der Erzählung überwiegen auch die Tatsache, dass Grimmelshausen einen satirischen Roman vorlegt, der lehrhaft, unterhaltsam und moraldidaktisch verwertbar ist, etwas was EI Akkad nicht beabsichtigt. Sein Roman ist vielmehr auch politisch zu verstehen. Dennoch ist beiden Romanarten, dem satirischen Roman und der Dystopie, eins gemeinsam, nämlich die Aussagen, dass der Krieg als solcher furchtbar ist, was beide Werke ethisch lesbar macht.
Zusätzlich verweist die Entscheidung beider Autoren, Krieg und Kindheit zu thematisieren, auf eine inhaltliche und literarische Nähe beider Werke, die beide zu zentralen Werken im deutsch- und englischsprachigen Raum macht.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- PARALLELEN DER ROMANE
- DER DREISSIGJÄHRIGE KRIEG UND DIE OPTION EINES (NEUEN) AMERIKANISCHEN BÜRGERKRIEGES – WIDERSPRUCH ODER LOGISCHE FORTSETZUNG DER KRIEGE NACH 1648?
- DIE FIGUR DES WAISENKINDES IM ROMAN
- DIE LITERARISCHE KONSTELLATION KIND UND KRIEG – EIN KURZER ÜBERBLICK AUS ENGLISCHSPRACHIGER PERSPEKTIVE
- EIN LITERARISCHER VERGLEICH DER THEMATIK KRIEG – KIND IN BEIDEN ROMANEN
- DER ERINNERUNGSROMAN ODER 'FICTIONS OF MEMORY' – IHRE LITERARISCHEN ANSÄTZE UND CHARAKTERISTIKA
- ZUSAMMENFASSUNG
- AUSBLICK
- EPILOG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die literarische Darstellung von Krieg, Leid und Terror aus der Perspektive von Kindern in zwei Romanen: Grimmelshausens "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" (1669) und Omar El Akkads "American War" (2017). Die Arbeit befasst sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Werke, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung von Kindsein im Krieg und die Rolle der Erinnerung in der Erzählung.
- Die Darstellung von Krieg und Terror aus der Perspektive von Kindern
- Die Rolle von Erinnerung und Trauma in den Romanen
- Der Vergleich der beiden Romane im Kontext ihrer jeweiligen historischen und literarischen Traditionen
- Die ethische Dimension der Kriegserfahrung
- Die autofiktionale Erzählstruktur und ihre Auswirkungen auf die Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
- VORWORT: Dieses Kapitel bietet einen einleitenden Überblick über die Thematik der Arbeit und die Motivation des Autors. Es stellt die beiden untersuchten Romane vor und erläutert deren zentrale Parallelen und Unterschiede.
- PARALLELEN DER ROMANE: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der Gemeinsamkeiten zwischen "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" und "American War" und konzentriert sich insbesondere auf die zentrale Rolle des Kindes im Krieg.
- DER DREISSIGJÄHRIGE KRIEG UND DIE OPTION EINES (NEUEN) AMERIKANISCHEN BÜRGERKRIEGES – WIDERSPRUCH ODER LOGISCHE FORTSETZUNG DER KRIEGE NACH 1648?: Dieses Kapitel analysiert die historischen Kontexte der beiden Romane und untersucht, wie die jeweiligen Kriegserfahrungen in den Texten widergespiegelt werden.
- DIE FIGUR DES WAISENKINDES IM ROMAN: Dieses Kapitel fokussiert auf die Figur des Waisenkindes als zentrales Motiv in beiden Romanen und analysiert die Auswirkungen von Krieg und Gewalt auf die kindliche Entwicklung.
- DIE LITERARISCHE KONSTELLATION KIND UND KRIEG – EIN KURZER ÜBERBLICK AUS ENGLISCHSPRACHIGER PERSPEKTIVE: Dieses Kapitel beleuchtet die literarische Tradition der Darstellung von Krieg und Kind in der englischsprachigen Literatur und bietet einen kurzen Vergleich mit den beiden untersuchten Werken.
- EIN LITERARISCHER VERGLEICH DER THEMATIK KRIEG – KIND IN BEIDEN ROMANEN: Dieses Kapitel vertieft den literarischen Vergleich der beiden Romane, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung von Krieg und Kind, und analysiert die unterschiedlichen literarischen Strategien, die beide Autoren einsetzen.
- DER ERINNERUNGSROMAN ODER 'FICTIONS OF MEMORY' – IHRE LITERARISCHEN ANSÄTZE UND CHARAKTERISTIKA: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Erinnerung in den beiden Romanen und untersucht, wie die Vergangenheit in die Gegenwart einfließt und die Erzählung prägt.
- ZUSAMMENFASSUNG: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die zentralen Ergebnisse der Analyse.
Schlüsselwörter
Kindheit, Krieg, Terror, Erinnerung, Trauma, Autofiktion, Satirischer Roman, Dystopie, Grimmelshausen, El Akkad, Simplicissimus, American War.
Häufig gestellte Fragen
Welche Romane werden in dieser literarischen Analyse verglichen?
Verglichen werden Grimmelshausens „Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ (17. Jahrhundert) und Omar El Akkads „American War“ (21. Jahrhundert).
Was ist das zentrale Thema der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Krieg, Leid und Terror aus der spezifischen Perspektive von Kindern, ein Motiv, das in der klassischen Kriegsliteratur oft fehlt.
Welche Rolle spielt die Figur des Waisenkindes?
Das Waisenkind dient als zentrales Motiv, um die Auswirkungen von extremer Gewalt und den Verlust von Schutzräumen auf die kindliche Entwicklung im Krieg darzustellen.
Wie wird die Erzählform der Romane beschrieben?
Beide Werke nutzen eine autofiktionale Erzählstruktur, in der ein rückblickender Erzähler das Geschehen ordnet und traumatische Erinnerungen verarbeitet.
Inwiefern unterscheiden sich die literarischen Genres der beiden Werke?
Während Grimmelshausen einen satirischen und moraldidaktischen Barockroman verfasst hat, handelt es sich bei El Akkads Werk um eine politisch motivierte Dystopie.
Was ist die ethische Kernaussage beider Romane?
Beide Werke vermitteln trotz ihrer zeitlichen Distanz die universelle Botschaft von der Furchtbarkeit des Krieges und machen die Leiden der Zivilbevölkerung ethisch lesbar.
- Arbeit zitieren
- Dr. Matthias Dickert (Autor:in), 2019, Krieg, Leid und Terror aus der kindlichen Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495872