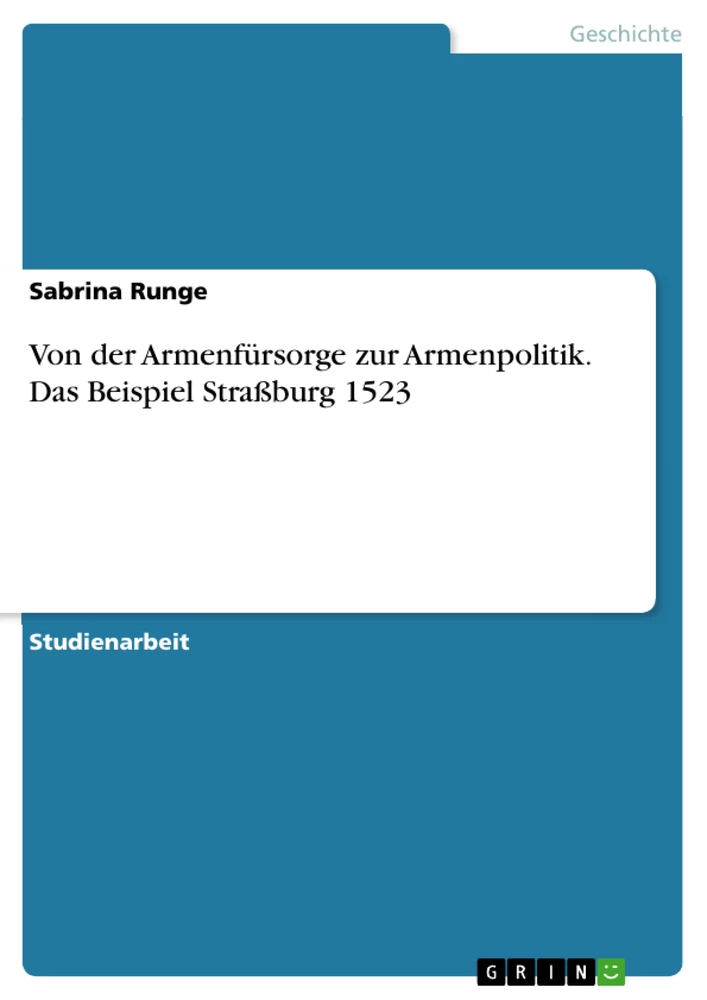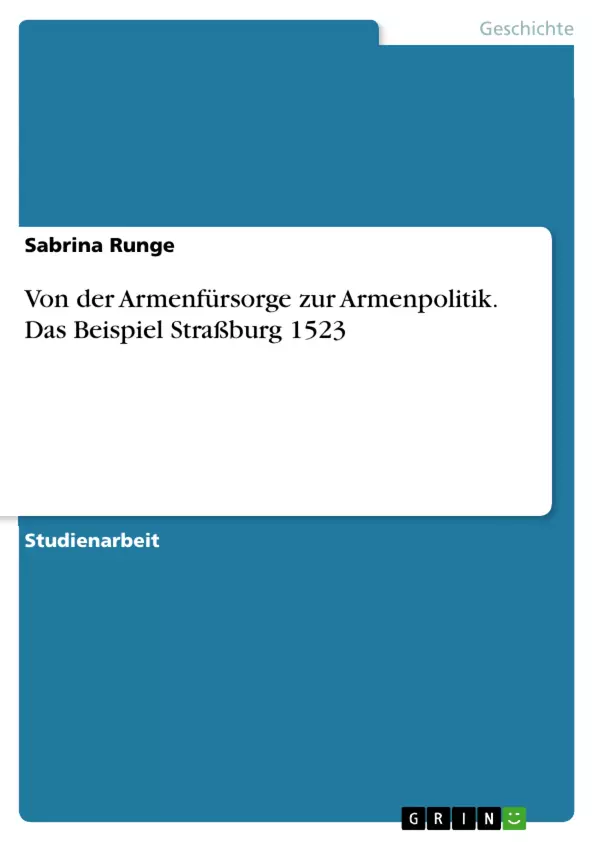In der europäischen Armutsgeschichte war die gesellschaftliche Wahrnehmung von Armut einem steten Wandel unterworfen, denn Armut ist kein eindeutig definierter, sondern ein relativer Sachverhalt, der seine Bedeutung aus dem jeweiligen kulturellen, ökonomischen und sozialen Kontext gewinnt. Insbesondere Veränderungen der Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Armut und Arbeit sowie die damit einhergehende Wertung der Betroffenen seitens der Nicht-Betroffenen, bestimmten die Geschichte der Armenfürsorge in Europa.
Grundsätzlich bezeichnet Armut einen Mangel. Im Mittelalter bestimmte sich der Armutsbegriff jedoch nicht allein durch materiellen Besitz, sondern auch durch den rechtlich-ständischen Aspekt der personalen Herrschaft. In den sich entwickelnden Städten des Mittelalters setzte sich aufgrund zunehmender Differenzierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen verstärkt der ökonomisch bestimmte Armutsbegriff durch. In der Folge wurde das Verhältnis zwischen Armut und Arbeit neu definiert und Arbeit galt fortan als Mittel gegen Armut.
Seit den 1520er Jahren entwickelte sich die städtische Armenfürsorge überall in Europa weg von unorganisierter dezentraler Almosenvergabe hin zu einer rationalisierten „Armenpolitik“ zentraler Institutionen. Die Geschichtswissenschaft ist sich einig, dass die städtischen Armenreformen des 16. Jahrhunderts in Folge der maßgeblichen Wende in der Beurteilung des Verhältnisses von Armut und Arbeit erfolgten, die konkreten wirtschaftlichen und sozialen Ursachen dieser Zäsur sind jedoch umstritten.
Die ersten Forschungsansätze zu den städtischen Armenreformen des 16. Jahrhunderts stammen aus dem späten 19. Jahrhundert und leiteten diese allein aus dem Einfluss der Reformation seit 1517 ab. Die neueren vergleichenden Studien von Thomas Fischer und Robert Jütte relativierten diesen Standpunkt jedoch, indem sie Parallelen zwischen reformierten und katholischen Städten aufzeigten. Stattdessen erforschten die Sozialhistoriker der 1980er Jahre die Almosenordnungen des 16. Jahrhunderts verstärkt unter dem Gesichtspunkt des von Gerhard Oestreich geprägten Konzeptes des gesamtgesellschaftlichen Prozesses der „Sozialdisziplinierung“ als Mittel zur Kontrolle und Erziehung der Armen. Die Forschung argumentierte die Notwendigkeit des disziplinierenden Eingreifens der städtischen Obrigkeiten überwiegend als Folge von Pauperisierungsprozessen des 15. und 16. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel gesellschaftlicher Wahrnehmung und erste obrigkeitliche Eingriffe in Armenfürsorge 14. - 16. Jahrhundert
- Das Straßburger Fürsorgewesen im 15. Jahrhundert
- Neuordnung der städtischen Armenfürsorge Straßburgs 1523
- Bettelverbot und Beschränkung des Empfängerkreises
- Organisation und Verwaltung
- Bedürftigkeitskriterien und Arbeitspflicht
- Durchführung und Ergebnisse der Armenreform
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entwicklung der Armenfürsorge in Straßburg im 16. Jahrhundert, speziell die Armenordnung von 1523. Die Arbeit beleuchtet die Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Armut und das zunehmende Eingreifen städtischer Obrigkeiten in die Armenfürsorge im 14. und 15. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Straßburger Armenordnung von 1523, insbesondere ihrer Struktur, Durchführung und Ergebnisse. Schließlich werden die Reformen im Kontext der Reformation und im Vergleich zu anderen Städten, wie Freiburg im Breisgau, untersucht.
- Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Armut im Spätmittelalter
- Auswirkungen des Bevölkerungswachstums und wirtschaftlicher Krisen auf die Armenfürsorge
- Die Entwicklung von der dezentralen Almosenvergabe hin zur „Armenpolitik“ städtischer Institutionen
- Auswirkungen der Reformation auf die Armenreformen des 16. Jahrhunderts
- Vergleich der Armenreformen in Straßburg und Freiburg im Breisgau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die historische Entwicklung des Armutsbegriffs in Europa und die Bedeutung der Arbeit in diesem Kontext. Kapitel 2 untersucht die Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Armut sowie die ersten Eingriffe städtischer Obrigkeiten in die Armenfürsorge im 14. und 15. Jahrhundert. Kapitel 3 beleuchtet das Straßburger Fürsorgewesen im 15. Jahrhundert, bevor Kapitel 4 die Neuordnung der städtischen Armenfürsorge Straßburgs 1523 analysiert. Kapitel 4 unterteilt sich in vier Unterkapitel, die sich mit dem Bettelverbot, der Organisation und Verwaltung, den Bedürftigkeitskriterien und der Arbeitspflicht sowie den Ergebnissen der Armenreform befassen. Das Resümee bietet schließlich eine abschließende Bewertung der Ergebnisse und stellt die Reformen in Straßburg in den Kontext anderer Städte, insbesondere Freiburg im Breisgau.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Armut, Armenfürsorge, Armenpolitik, Sozialdisziplinierung, Reformation, städtische Obrigkeiten, Straßburg, Freiburg im Breisgau, Almosenordnung, Arbeitspflicht, Bedürftigkeitskriterien, 15. und 16. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte sich in der Armenfürsorge im 16. Jahrhundert?
Es fand ein Wandel von unorganisierter Almosenvergabe hin zu einer rationalisierten, zentral gesteuerten "Armenpolitik" statt.
Welche Bedeutung hatte die Straßburger Armenordnung von 1523?
Sie führte ein Bettelverbot ein, beschränkte den Empfängerkreis und knüpfte Unterstützung an Bedürftigkeitskriterien und Arbeitspflicht.
Was versteht man unter "Sozialdisziplinierung" in diesem Kontext?
Es bezeichnet den Prozess, Armenfürsorge als Mittel zur Kontrolle und Erziehung der Armen einzusetzen.
Welchen Einfluss hatte die Reformation auf die Armenreformen?
Obwohl die Reformation ein wichtiger Impuls war, zeigen Studien, dass ähnliche Reformen auch in katholischen Städten stattfanden.
Wie wurde das Verhältnis zwischen Armut und Arbeit neu definiert?
Arbeit wurde zunehmend als das primäre Mittel gegen Armut angesehen, was zur Einführung einer Arbeitspflicht für Arbeitsfähige führte.
- Citar trabajo
- Sabrina Runge (Autor), 2019, Von der Armenfürsorge zur Armenpolitik. Das Beispiel Straßburg 1523, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496074