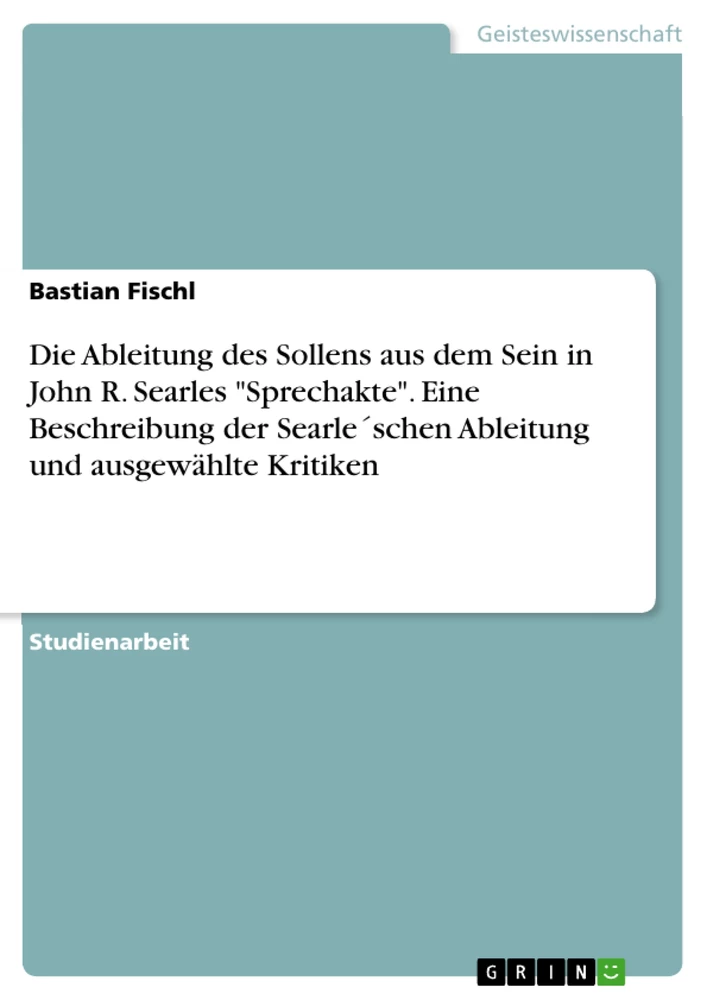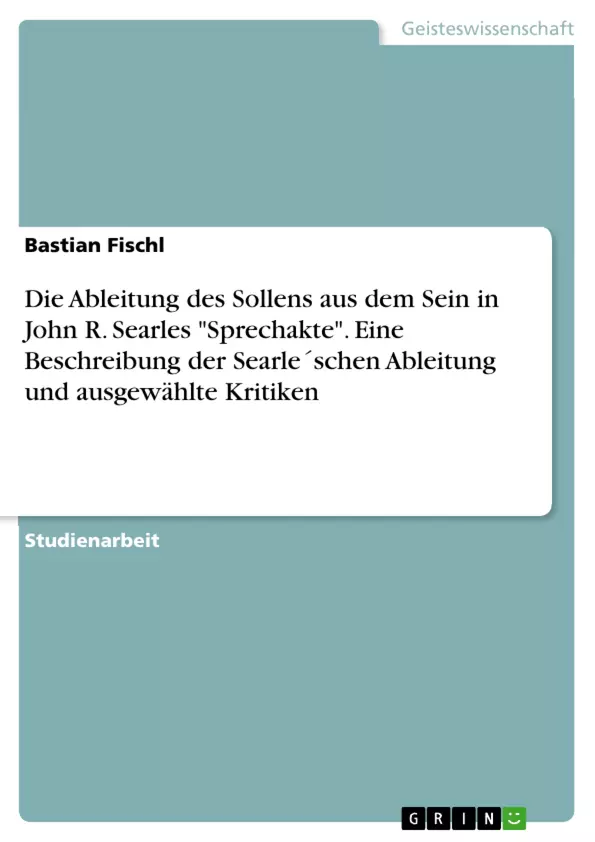In John Searles sprachphilosophischem Essay „Sprechakte“ ist die Ableitung eines Sollens aus dem Sein eine der am meisten diskutierten Passagen. Searle greift in dieser die klassische Vorstellung an, nach der aus deskriptiven Aussagen keine Wertaussagen ableitbar sind.
Die Folgende Arbeit beschreibt grundsätzliche Funktionalitäten der Searle´schen Ableitung und gibt einen Überblick über wesentliche Kritikansätze, unter besonderer Berücksichtigung der Ableitung von Aussage (1) nach (2). In erster Linie soll dabei nicht die Berechtigung der Ableitung selbst überprüft werden. Vielmehr sollen kritische Gegenpositionen dargestellt und deren Logik aufgezeigt werden. Eine Kritik der Kritiken wäre im Anschluss an diese Arbeit in einer weiterführenden Stellungnahme jedenfalls denkbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangssituation: klassisch-empirisches Modell
- Funktion
- Wahrheitsgehalt
- Definitorische Abgrenzung
- Searles Ansatz: Ein Angriff auf das klassisch-empirische Modell
- Die Aussagenreihe
- zu Aussage (1)
- Voraussetzungen
- Kritik
- zu Aussage (2)
- Voraussetzungen
- Kritik
- zu Aussage (3)
- Voraussetzungen
- Kritik
- zu Aussage (4) / (5)
- Voraussetzungen
- Kritik
- zu Aussage (1)
- Schluss Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ableitung eines Sollens aus dem Sein in John R. Searles „Sprechakte“ zu beschreiben und ausgewählte Kritikansätze zu beleuchten. Dabei liegt der Fokus auf der Darstellung und Analyse der logischen Struktur der Kritik, nicht auf der Bewertung der Ableitung selbst. Die Arbeit fokussiert sich auf die Ableitung von Aussage (1) nach (2).
- Das klassisch-empirische Modell der Sein-Sollen-Dichotomie
- Searles Angriff auf das klassisch-empirische Modell
- Die Ableitung von Wertaussagen aus deskriptiven Aussagen
- Die Kritik an Searles Ableitung, insbesondere der Aussage (1) nach (2)
- Die Logik der Kritikansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Searles „Sprechakte“ und die darin diskutierte Ableitung eines Sollens aus dem Sein als Ausgangspunkt der Arbeit vor. Kapitel 2 beschreibt das klassische empirische Modell der Sein-Sollen-Dichotomie, das die Grundlage für Searles Angriff darstellt. Kapitel 3 beleuchtet Searles Ansatz und seine Kritik an der traditionellen Trennung zwischen deskriptiven und normativen Aussagen. Die folgenden Kapitel befassen sich mit der einzelnen Aussagenreihe von Searle, inklusive der Voraussetzungen und der Kritikpunkte. Im Fokus steht dabei die Ableitung von Aussage (1) nach (2).
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Sprachphilosophie, insbesondere mit der Sprechakttheorie nach John R. Searle. Im Zentrum steht die Frage der Ableitung eines Sollens aus dem Sein, wobei die klassische Unterscheidung zwischen deskriptiven und normativen Aussagen sowie der Angriff Searles auf dieses Modell im Vordergrund stehen. Die Analyse fokussiert sich auf die Logik der Kritik an Searles Ableitung, wobei die einzelnen Aussagenreihen, insbesondere die Ableitung von Aussage (1) nach (2), im Fokus stehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von John Searles Ableitung?
Es geht um die sprachphilosophische Frage, ob man aus rein beschreibenden Aussagen (Sein) moralische oder verpflichtende Aussagen (Sollen) logisch ableiten kann.
Welches Modell greift Searle in seinem Essay an?
Searle greift das klassisch-empirische Modell an, das eine strikte Trennung (Dichotomie) zwischen Fakten und Werten postuliert.
Welche Rolle spielen Sprechakte bei dieser Ableitung?
Searle nutzt die Theorie der Sprechakte, um zu zeigen, dass bestimmte sprachliche Handlungen (wie Versprechen) bereits eine Verpflichtung beinhalten.
Worauf liegt der Fokus der Kritik in dieser Arbeit?
Der Fokus liegt auf der logischen Analyse der Ableitung von Aussage (1) nach Aussage (2) und der Darstellung kritischer Gegenpositionen.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel ist es, Searles Ableitung zu beschreiben und die Logik wesentlicher Kritikansätze aufzuzeigen, ohne die Berechtigung der Ableitung selbst abschließend zu bewerten.
- Quote paper
- Bastian Fischl (Author), 2017, Die Ableitung des Sollens aus dem Sein in John R. Searles "Sprechakte". Eine Beschreibung der Searle´schen Ableitung und ausgewählte Kritiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496170