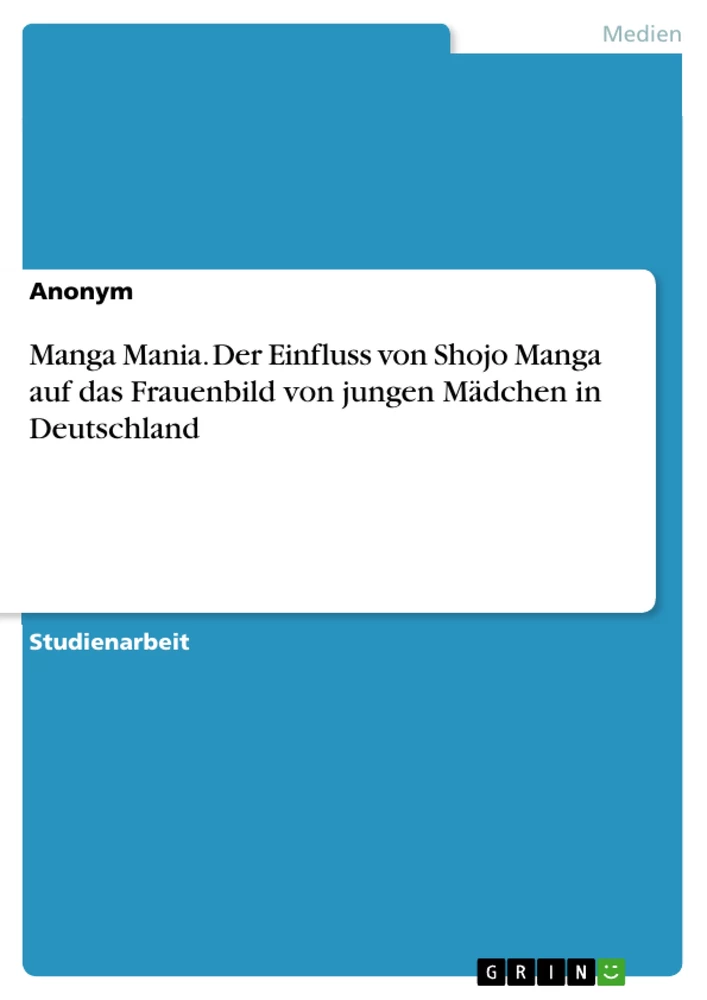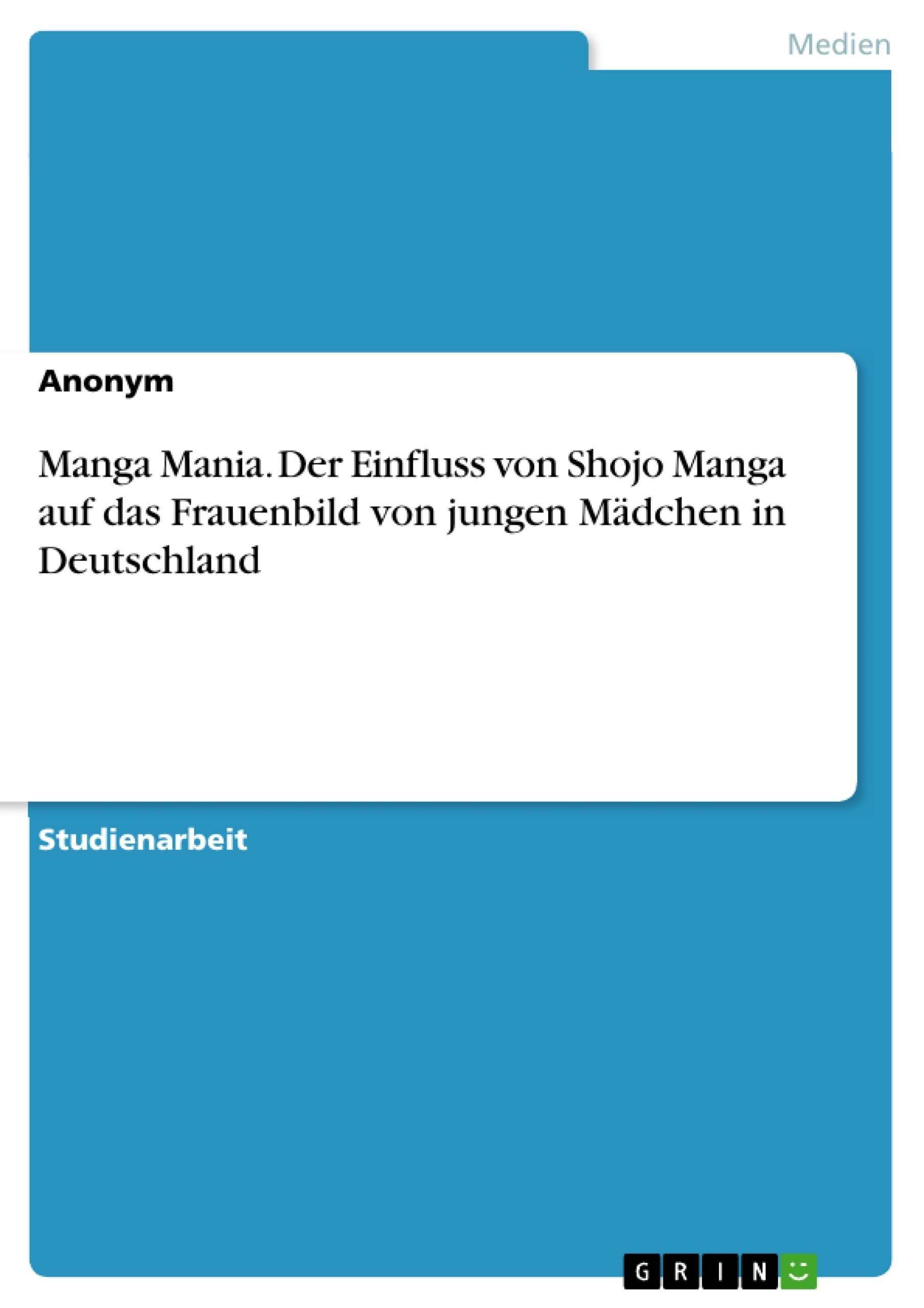Die Jugend Japans liebt und lebt einen westlichen Lebensstil mit Computern, Smartphones und mp3-Playern. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind sogenannte Manga. Dabei handelt es sich um die japanische Variante von Comics. Wie auch in anderen Teilen der Welt gibt es Manga für alle Geschlechter und Altersstufen. Diese japanischen Comics sollen auch das Thema dieser Hausarbeit stellen. Inwieweit wird durch den Einfluss des in Shojo Manga vermittelten Frauenbildes die Wahrnehmung des eigenen Geschlechts junger Mädchen in Deutschland beeinflusst?
Ich möchte im Verlauf dieser Arbeit sowohl versuchen den Begriff der interkulturellen Kommunikation zu erklären, als auch die Frauenbilder innerhalb der japanischen und der deutschen Kultur darzustellen und zu vergleichen. Im Anschluss daran soll die Geschichte der Shojo-Manga näher erläutert und das vermittelte Frauenbild des Shojo-Manga „Tokyo Mew Mew“ analysiert werden. Daraus ergibt sich als letzter Punkt die Analyse möglicher Einflüsse des vermittelten Frauenbildes auf junge Mädchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Interkulturelle Kommunikation“
- Frauenbilder
- Das Frauenbild innerhalb der japanischen Kultur
- Das Frauenbild innerhalb der deutschen Kultur
- Vergleich
- Geschichte der Shojo Manga
- Der Shojo Manga „Tokyo Mew Mew“
- Das vermittelte Frauenbild in „Tokyo Mew Mew“
- Einfluss des vermittelten Frauenbildes auf junge Mädchen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss des Frauenbildes in Shojo Manga auf die Wahrnehmung des eigenen Geschlechts junger Mädchen in Deutschland. Sie untersucht die interkulturelle Kommunikation und die Unterschiede im Frauenbild zwischen Japan und Deutschland. Des Weiteren analysiert sie den Shojo Manga „Tokyo Mew Mew“ und seinen Einfluss auf junge Mädchen.
- Interkulturelle Kommunikation und ihre Bedeutung im Kontext des Manga-Konsums
- Vergleichende Analyse des Frauenbildes in der japanischen und deutschen Kultur
- Die Geschichte und Entwicklung des Shojo Manga
- Die Darstellung des Frauenbildes in „Tokyo Mew Mew“
- Der mögliche Einfluss des Manga-Frauenbildes auf die Selbstwahrnehmung junger Mädchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Kapitel 2 widmet sich der Definition von „Interkultureller Kommunikation“ und zeigt die Unterschiede zwischen „interkultureller Interaktion“ und „interkultureller Kommunikation“ auf. Kapitel 3 beleuchtet die verschiedenen Frauenbilder in Japan und Deutschland, wobei die historische Entwicklung und die kulturellen Einflüsse auf das jeweilige Frauenbild beleuchtet werden. In Kapitel 4 wird die Geschichte der Shojo Manga dargestellt und der Manga „Tokyo Mew Mew“ im Detail analysiert, wobei das vermittelte Frauenbild im Fokus steht.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Shojo Manga, Frauenbild, „Tokyo Mew Mew“, Japan, Deutschland, Selbstwahrnehmung, Geschlechterrollen, Kulturvergleich, Medienanalyse.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Manga Mania. Der Einfluss von Shojo Manga auf das Frauenbild von jungen Mädchen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496208