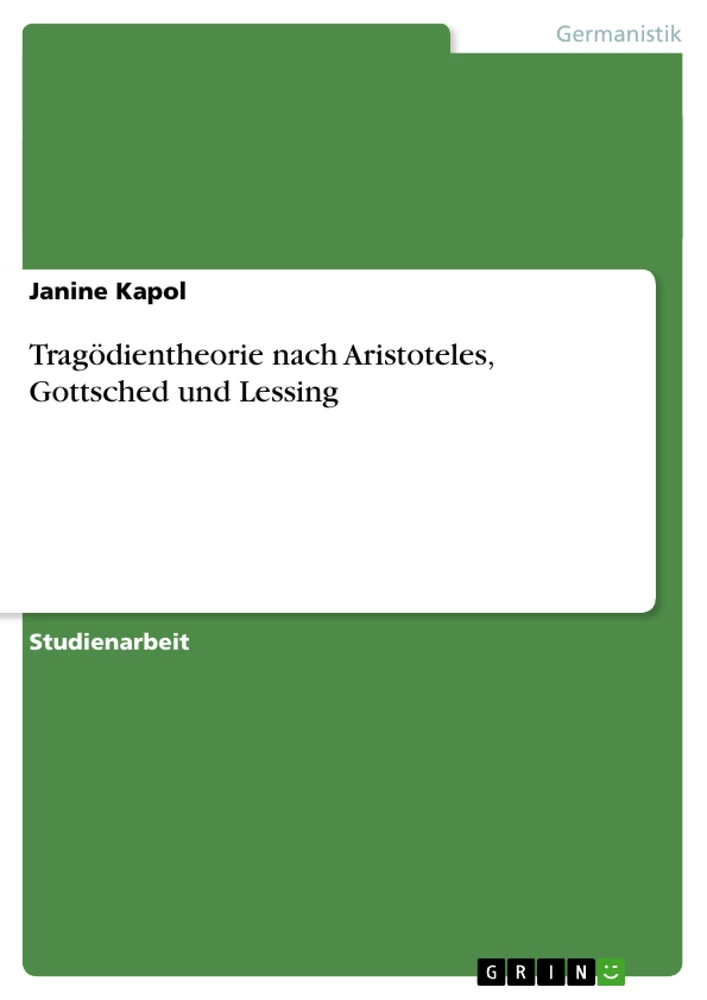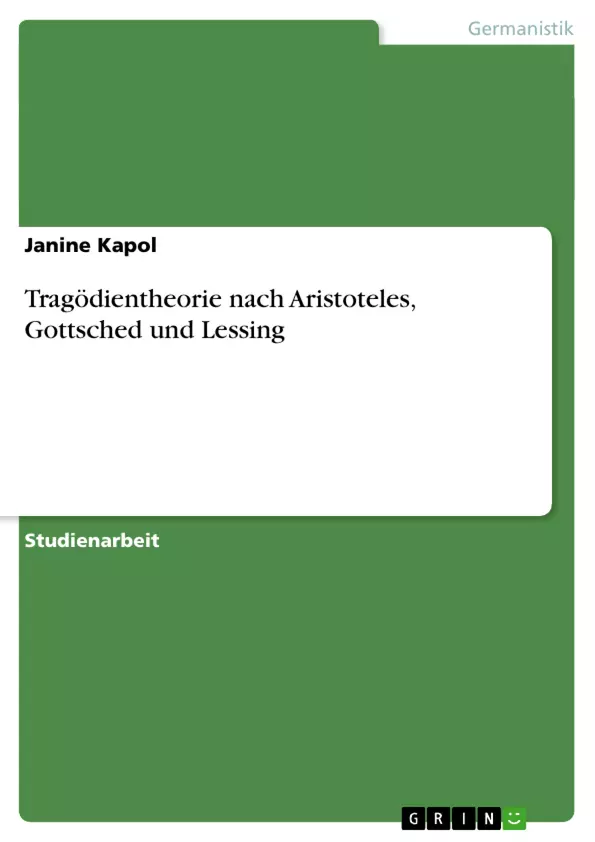Das Begriff der Tragödie entstammt dem griechischen 'tragodia', das mit 'Bockgesang' zu übersetzen ist. Das bedeutet dann "entweder 'Gesang der Böcke' mit tragischen Chören in Bocksmasken oder 'Gesang um den Bock' als Preis oder Opfer" [Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 8., verbesserte und erweitete Auflage Stuttgart: Kröner 2001, S. 843.]. Hierin zeigt sich die zentrale Bedeutung des Gesangs für den Ursprung des dramatischen Genus. Die Urform der Tragödie ist der Chorgesang und entstanden ist sie aus der Improvisation heraus. Die Entwicklung vollzog sich dann dahingehend, dass der Chor zunehmend zurückgedrängt wurde und die Anzahl der Schauspieler stieg.
Doch was verbinden wir heute mit dem Wort 'tragisch'? Zunächst beinhaltet es den Untergang eines Menschen, der zumeist in der physischen Vernichtung desselben mündet. Als weiteres Strukturmerkmal lässt sich anführen, dass der Untergang "unnatürlich, nicht zufällig, ungewollt, selbstverschuldet und moralisch nicht völlig verdient" [Gelfert, Hans-Dieter: Die Tragödie. Theorie und Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1995. (Kleine Vandenhoeck-Reihe. 1570.), S. 14.] ist.
Die Herausbildung dieses Verständnisses folgt einer langen Tradition der Tragödie, die auf eine 2500 jährige Geschichte zurückblicken kann. Über diesen Zeitraum haben die vielen Tragödientheoretiker unseren Begriff des Tragischen geformt. Um drei von ihnen soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Darunter Aristoteles, der den Grundstein einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Tragödie geliefert hat und die beiden Theoretiker und Schriftsteller der Aufklärung, Gottsched und Lessing, die dem Theater in Deutschland zu neuer Blüte verholfen haben, nicht zuletzt durch eine Rückkehr zum Ursprung – zu Aristoteles.
Ich werde im Verlaufe meiner Arbeit zunächst auf die drei Persönlichkeiten und ihre Theorie im Einzelnen eingehen, wobei mein Schwerpunkt im 18. Jahrhundert liegen wird, unter Berücksichtigung der damaligen Situation des Theaters und der Differenzen zwischen Gottsched und Lessing.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die drei Tragödientheoretiker Aristoteles, Gottsched und Lessing
- Aristoteles - Urvater der Tragödientheorie
- Gottsched und Lessing - Abkehr vom Barockdrama
- Gottsched - der Regelpoetiker
- Lessing Aufbrechen der Gattungsgrenzen
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Tragödientheorie von Aristoteles, Gottsched und Lessing und beleuchtet die Entwicklung des Tragödienbegriffs im 18. Jahrhundert. Insbesondere werden die Unterschiede zwischen Gottscheds Regelpoetik und Lessings Aufbruch der Gattungsgrenzen im Kontext der damaligen Theaterlandschaft untersucht.
- Entwicklung der Tragödientheorie von Aristoteles bis Lessing
- Einfluss der Aufklärung auf die Tragödientheorie
- Unterschiede zwischen Gottscheds Regelpoetik und Lessings Drama
- Bedeutung der Einheit der Handlung in der Tragödie
- Die Rolle der Charaktere in der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Das Vorwort führt in das Thema der Tragödie ein und erklärt die Bedeutung des Gesangs in ihrer Entstehung. Es definiert den Begriff „tragisch“ und beschreibt die historische Entwicklung der Tragödie. Die Arbeit fokussiert sich auf drei wichtige Tragödientheoretiker: Aristoteles, Gottsched und Lessing.
Die drei Tragödientheoretiker Aristoteles, Gottsched und Lessing
Aristoteles – Urvater der Tragödientheorie
Dieser Abschnitt beleuchtet Aristoteles‘ Leben und seine Tragödientheorie, die in seiner „Poetik“ dargestellt wird. Aristoteles‘ naturwissenschaftliche Methode zur Analyse von Literatur wird erklärt und seine „Poetik“ in den Kontext seiner Zeit sowie der späteren Rezeption gesetzt. Der Tragödiensatz wird vorgestellt und die wichtigsten Elemente der aristotelischen Tragödie wie Handlung, Größe, Einheit und die Rolle der Charaktere werden erläutert.
Gottsched und Lessing - Abkehr vom Barockdrama
Dieser Abschnitt untersucht die Tragödientheorien von Gottsched und Lessing im 18. Jahrhundert und beleuchtet die Unterschiede zwischen ihren Ansätzen. Gottscheds Regelpoetik und Lessings Aufbrechen der Gattungsgrenzen werden im Kontext der damaligen Theaterlandschaft betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Tragödientheorie, Aristoteles, Gottsched, Lessing, Aufklärung, Regelpoetik, Drama, Einheit der Handlung, Charaktere, Barockdrama, Theatergeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Tragödie" ursprünglich?
Der Begriff stammt vom griechischen 'tragodia' und bedeutet 'Bockgesang', was auf die Ursprünge im rituellen Chorgesang hinweist.
Was ist die zentrale Lehre von Aristoteles zur Tragödie?
Aristoteles definierte in seiner 'Poetik' wichtige Elemente wie die Einheit der Handlung und die Katharsis (Reinigung der Affekte durch Mitleid und Furcht).
Was versteht man unter Gottscheds "Regelpoetik"?
Gottsched forderte eine strenge Einhaltung vernunftgemäßer Regeln und der drei Einheiten (Ort, Zeit, Handlung), um das Theater moralisch und ästhetisch aufzuwerten.
Wie unterscheidet sich Lessing von Gottsched?
Lessing brach die starren Gattungsgrenzen auf und plädierte für eine stärkere emotionale Wirkung auf das Publikum sowie für Charaktere, mit denen man mitfühlen kann.
Was macht ein Ereignis laut dieser Theorie "tragisch"?
Ein Ereignis ist tragisch, wenn der Untergang eines Menschen unnatürlich, ungewollt und moralisch nicht völlig verdient ist.
- Arbeit zitieren
- Janine Kapol (Autor:in), 2005, Tragödientheorie nach Aristoteles, Gottsched und Lessing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49623