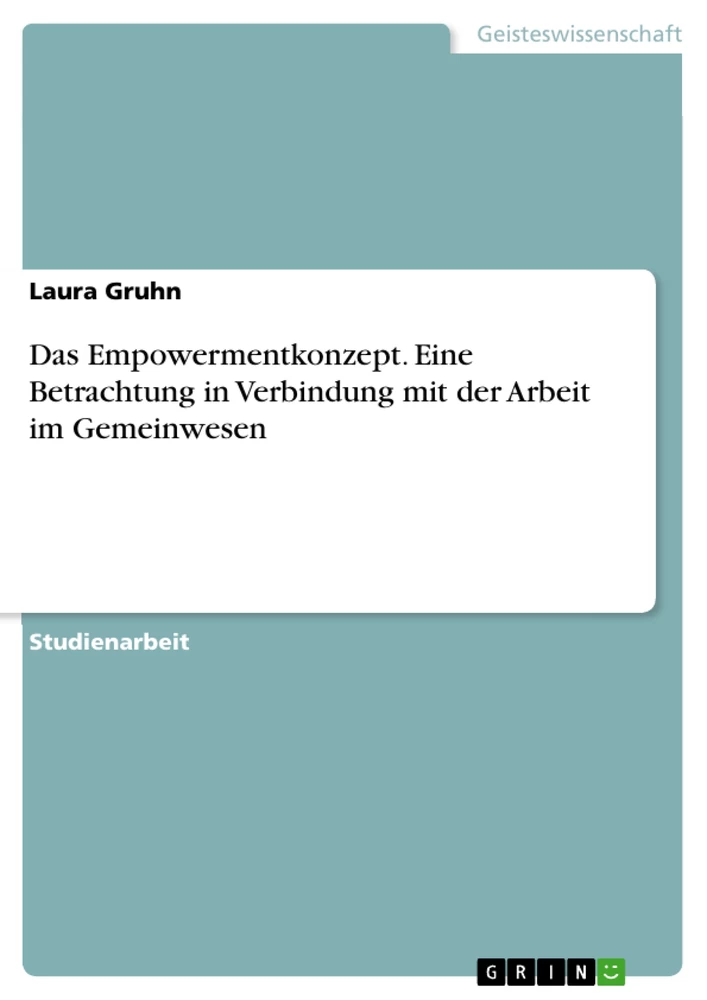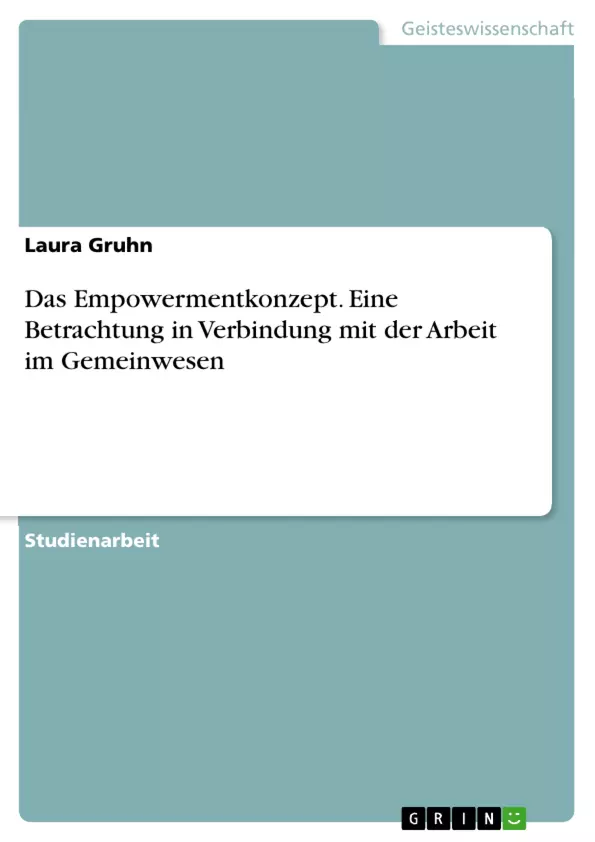Ob in den Medien, in den Vorlesungen der Hochschulen und Universitäten oder dem Arbeitsalltag, findet der Begriff des Empowerments immer häufiger Verwendung. Vor allem im Bereich der Sozialen Arbeit bekommt dieses Konzept immer stärkeren Zuspruch, um mit den immer umfassenderen Forderungen in diesem Arbeitsfeld zurande zu kommen. Der Fokus der professionellen Kräfte richtet sich in eine veränderte Denkstruktur, in welcher die Klienten und Klientinnen zur Selbsthilfe aktiviert werden sollen. Die betroffenen Personen als Experten ihres eigenen Alltags anzusehen und sie bei der Mobilisierung ihrer Stärken und Ressourcen hin zu Unabhängigkeit und autonomen Entfaltung zu unterstützen, liegt im Sinne dieses Gesamtkonzeptes. Obgleich ist zu beachten, dass das Konzept des Empowerments nicht nur der Disziplin der Sozialen Arbeit zuzuordnen ist. Vielmehr findet dies auch immer mehr Bedeutung in anderen Bereichen, wie beispielsweise in Prozessen des Managements. Da dieses Konzept in unterschiedlichen Bereichen Anwendung findet, liegt die Vermutung nahe, dass sich aus diesem heraus viele Chancen und Möglichkeiten des Handelns ergeben. Andererseits kommt die Frage auf, was Selbstbestimmung und Aktivierung der Autonomie genau bedeutet. Auch ist die Rolle der Fachkräfte nicht klar definiert, denn wie muss dieser oder diese ausgebildet sein, um angemessen auf den Bedarf der hilfesuchenden Personen einzugehen? In diesem Zusammenhang treten auch Herausforderungen, wie auch Grenzen hervor, welche in der Sozialen Arbeit in Bezug auf das Konzept des Empowerments eine Rolle spielen.
Da sich diese Seminararbeit im Kontext der Gemeinwesenarbeit verfasst wird, ist auch der Bezug dahingehend herzustellen wichtig.
In vielen Städten bzw. in vielen Stadtteilen existieren soziale Spannungen und Probleme, aufgrund von verwahrlosten Grünflächen oder mangelnden kulturellen Angeboten für die Bewohner und Bewohnerinnen. Vor allem Wohngebiete, in welchen viele Arbeitslose, Migranten und Migrantinnen, alten Menschen und Sozialhilfeempfänger leben, werden meist als benachteiligt betitelt. Aus der Wissenschaft der Psychologie ist bekannt, dass das soziale Umfeld, wie auch das die Familie betreffend, ein wichtiger Aspekt für die persönliche Motivation und den Zustand der Persönlichkeit darstellt. Somit ist es gerade in den benachteiligten Stadtteilen ein zentrales Anliegen, das Stadtleben wiederaufzubauen und die Gesellschaft in diesem zu stärken.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Arbeit.
- Grundlegendes zur Gemeinwesenarbeit
- Historische Betrachtung des Empowerments.
- Geschichtlicher Hintergrund.
- Theoretischer Hintergrund
- Die Grundhaltung des Empowerments.
- Die Individualebene.......
- Die Ebene der Gruppe.
- Die Ebene der Organisation.
- Die Ebene von sozialräumlichen Kontexten
- Empowerment und Gemeinwesenarbeit…...…………..\nDas Projekt der österreichischen Kleinstadt Knittelfeld.
- Schlussfolgerung der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept des Empowerments im Kontext der Gemeinwesenarbeit. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung und die theoretischen Grundlagen des Empowerments, wobei sie insbesondere die verschiedenen Ebenen des Empowerments sowie dessen Bedeutung für die Gemeinwesenarbeit untersucht. Darüber hinaus wird das Projekt der österreichischen Kleinstadt Knittelfeld als Beispiel für die Anwendung von Empowerment in der Praxis beleuchtet.
- Die historische Entwicklung und die theoretischen Grundlagen des Empowerments.
- Die verschiedenen Ebenen des Empowerments (individuell, Gruppe, Organisation, sozialräumlicher Kontext).
- Der Zusammenhang zwischen Empowerment und Gemeinwesenarbeit.
- Die Anwendung von Empowerment in der Praxis am Beispiel des Projekts in Knittelfeld.
- Die Bedeutung des Empowerments für die soziale Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Leser in die Thematik der Seminararbeit ein und beleuchtet die Relevanz des Empowerments in der Sozialen Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem grundlegenden Verständnis der Gemeinwesenarbeit, ihrer Ziele und ihrer Arbeitsweise. Das dritte Kapitel präsentiert die historische Entwicklung des Empowerments und die verschiedenen Zugänge zu diesem Konzept. Das vierte Kapitel erläutert den theoretischen Hintergrund des Empowerments und stellt die verschiedenen Ebenen des Empowerments dar. Das fünfte Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Empowerment und Gemeinwesenarbeit anhand eines konkreten Beispielprojekts.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Seminararbeit sind: Empowerment, Gemeinwesenarbeit, soziale Arbeit, Selbsthilfe, Autonomie, Partizipation, Ressourcenaktivierung, Selbstbestimmung, soziale Spannungen, Lebensqualität, Sozialraum, Aktivierung, Handlungsfähigkeit, Projekt Knittelfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Empowerment zielt darauf ab, Klienten zur Selbsthilfe zu aktivieren, ihre eigenen Stärken zu mobilisieren und sie zu autonomer Lebensgestaltung zu befähigen.
Welche Ebenen des Empowerments werden unterschieden?
Es werden die Individualebene, die Ebene der Gruppe, die Ebene der Organisation und die Ebene von sozialräumlichen Kontexten betrachtet.
Was hat Empowerment mit Gemeinwesenarbeit zu tun?
In der Gemeinwesenarbeit dient Empowerment dazu, benachteiligte Stadtteile zu stärken und Bewohner zur aktiven Mitgestaltung ihres sozialen Umfelds zu motivieren.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit genannt?
Die Arbeit beleuchtet das Projekt der österreichischen Kleinstadt Knittelfeld als Beispiel für die gelungene Anwendung von Empowerment-Strategien.
Welche Rolle nehmen Fachkräfte im Empowerment-Konzept ein?
Fachkräfte agieren weniger als „Besserwisser“, sondern als Unterstützer, die Ressourcen freilegen und die Selbstbestimmung der Betroffenen fördern.
Wo liegen die Grenzen des Empowerment-Konzepts?
Die Arbeit diskutiert Herausforderungen wie die Definition von Autonomie und die strukturellen Grenzen, die einer vollständigen Selbstbestimmung in benachteiligten Gebieten entgegenstehen.
- Quote paper
- Laura Gruhn (Author), 2018, Das Empowermentkonzept. Eine Betrachtung in Verbindung mit der Arbeit im Gemeinwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496624