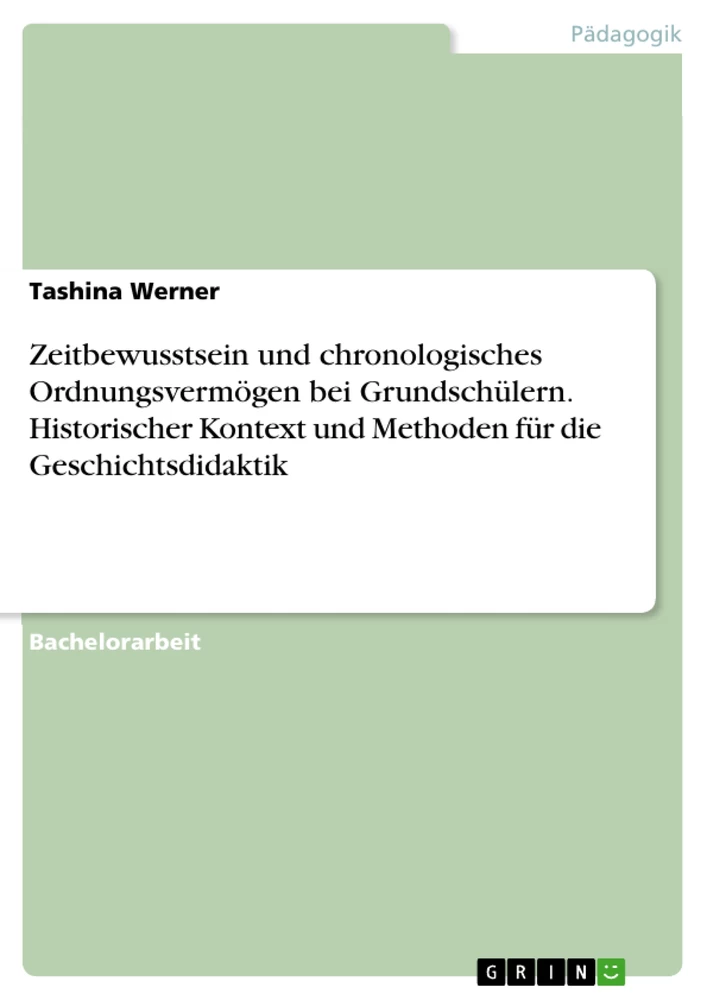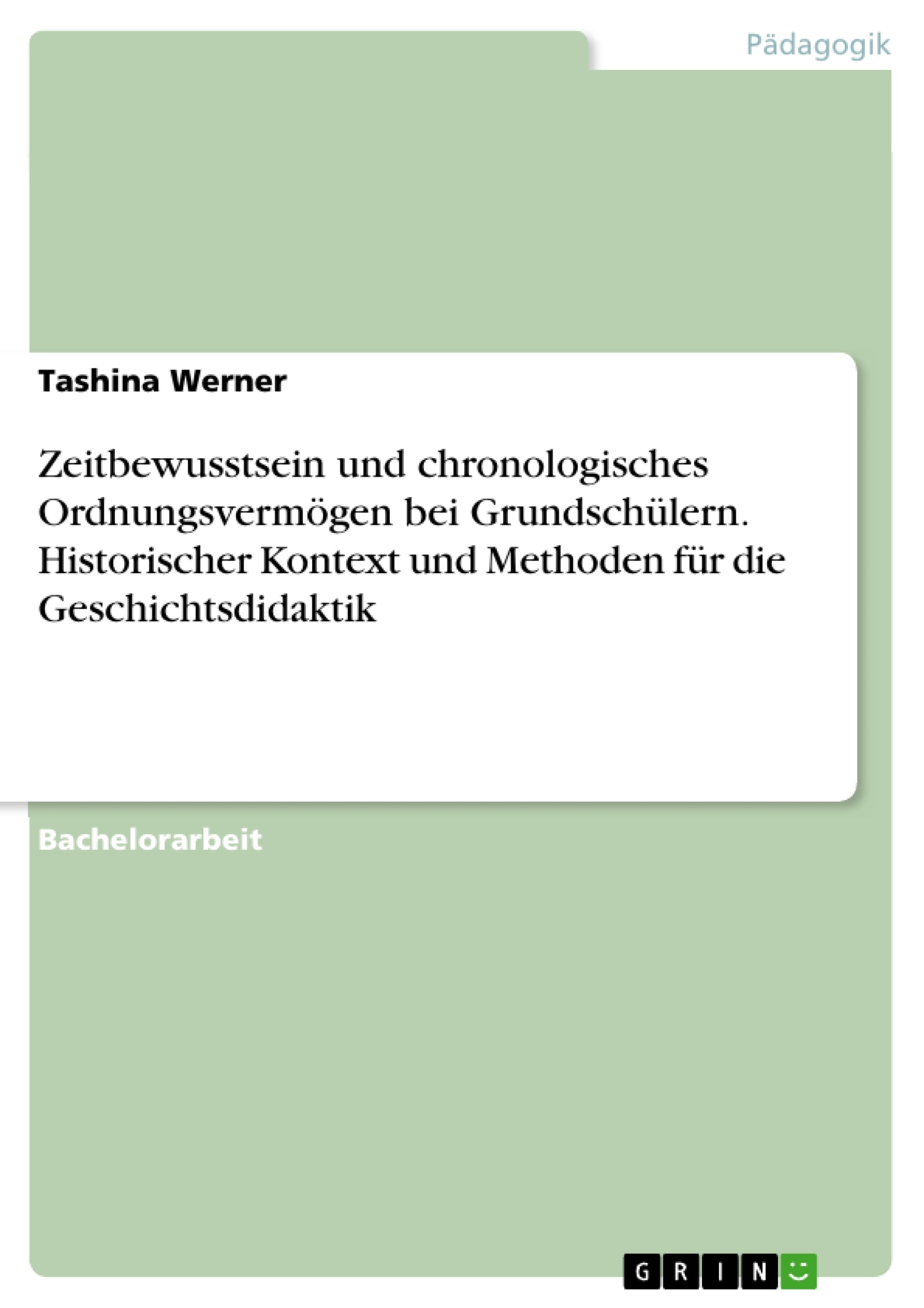In dieser Arbeit soll das Zeitbewusstsein von Grundschülern und deren chronologisches Ordnungsvermögen im historischen Kontext näher betrachtet werden. Dazu werden zunächst die verschiedenen Konzeptionen, die bei der geschichtlichen Betrachtung von Zeit eine Rolle spielen, genauer beschrieben, bevor auf die Bedeutung von Zeit und die Entwicklung des Zeitverständnisses auf Basis geschichtsdidaktischer Grundlagen eingegangen wird.
Anschließend sollen durch eine heuristische Studie, in der Grundschüler bei einer qualitativen Befragung eine chronologische Reihung von Darstellungen unterschiedlicher Zeitalter vornehmen, Erkenntnisse über die Entwicklung des Zeitbewusstseins im Laufe der vier Jahrgangsstufen sowie die unterschiedlichen Ordnungsstrategien gewonnen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass Grundschüler nicht das historische Wissen besitzen, die Epochen genau zu bestimmen und auf dieser Grundlage die Bilder richtig zu ordnen. Allerdings geht es vielmehr um die stattdessen angewendeten Strategien, mit denen die Kinder etwas als früher beziehungsweise später deklarieren. Abschließend sollen noch exemplarisch einige methodische Vorgehensweisen aufgezeigt werden, mit deren Hilfe Zeitbewusstsein im Rahmen des Unterrichts gefördert werden kann.
Zeit ist ein schwierig zu definierendes Konstrukt, das im Alltag des Menschen eine große Rolle spielt und darüber hinaus in zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen untersucht wird. Auch in der Geschichtswissenschaft ist eine Auseinandersetzung mit diesem Begriff sowie den dahinterliegenden Bedeutungszusammenhängen obligatorisch. Das Verständnis von Zeit bildet eine zentrale Voraussetzung für die Erlangung von Geschichtsbewusstsein sowie die kompetente Betrachtung und Interpretation von historischen Ereignissen. Angesichts der hohen Relevanz von Zeitbewusstsein stellt dieses auch in der Geschichtsdidaktik eine zentrale Kategorie dar und sollte bereits frühzeitig gefördert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zeit als historische Kategorie
- 2.1 Betrachtungsweisen von Zeit
- 2.1.1 Zyklisches und lineares Zeitverständnis
- 2.1.2 Synchrone und diachrone Geschichtsbetrachtung
- 2.1.3 Objektive und subjektive Zeitwahrnehmung
- 2.2 Historische Zeitmodelle
- 2.2.1 Dauer von Geschichte - Zeiteinteilung nach Braudel
- 2.2.2 Temporale Erfahrungsmodi nach Koselleck
- 2.1 Betrachtungsweisen von Zeit
- 3. Zeit und Zeitbewusstsein in der Geschichtsdidaktik
- 3.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen
- 3.1.1 Entwicklungsmodell des Zeitbewusstseins nach Roth
- 3.1.2 Entwicklungsstadien des Ordnungsvermögens nach Piaget
- 3.2 Wissensmodell des historischen Denkens nach Kühberger
- 3.3 Pandels Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
- 3.3.1 Temporalbewusstsein
- 3.3.2 Wirklichkeitsbewusstsein
- 3.3.3 Wandelbewusstsein
- 3.3.4 Gesellschaftliche Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
- 3.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen
- 4. Heuristische Studie zum zeitlichen Ordnungsvermögen von Grundschülern
- 5. Methoden zur Förderung des Zeitbewusstseins im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Zeitbewusstsein von Grundschülern und deren Fähigkeit, historische Ereignisse chronologisch zu ordnen. Die Studie zielt darauf ab, die Entwicklung des Zeitverständnisses im Laufe der Grundschulzeit zu erforschen und unterschiedliche Ordnungsstrategien von Kindern zu identifizieren. Die Ergebnisse sollen Hinweise für die Förderung des Zeitbewusstseins im Geschichtsunterricht liefern.
- Entwicklung des Zeitbewusstseins bei Grundschulkindern
- Chronologische Ordnungsstrategien von Kindern
- Vergleich zwischen zyklischem und linearem Zeitverständnis
- Geschichtsdidaktische Grundlagen des Zeitverständnisses
- Methoden zur Förderung des Zeitbewusstseins im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Zeitbewusstseins ein und betont dessen Bedeutung für das Geschichtsverständnis. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der die Untersuchung des Zeitbewusstseins von Grundschülern und deren Fähigkeit zur chronologischen Ordnung im Fokus hat. Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Konzeptionen der historischen Betrachtung von Zeit, die Bedeutung von Zeit und die Entwicklung des Zeitverständnisses auf Basis geschichtsdidaktischer Grundlagen. Eine heuristische Studie soll Erkenntnisse über die Entwicklung des Zeitbewusstseins im Laufe der vier Grundschuljahrgänge liefern und unterschiedliche Ordnungsstrategien der Kinder aufzeigen.
2. Zeit als historische Kategorie: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Betrachtungsweisen von Zeit, beginnend mit dem zyklischen und linearen Zeitverständnis. Es analysiert unterschiedliche historische Zeitmodelle, vergleicht verschiedene Kulturen und ihre Zeitauffassungen und diskutiert die Etymologie des Wortes „Zeit“ im Kontext der zyklischen Betrachtungsweise. Der Unterschied zwischen zyklischen und linearen Zeitmodellen wird anhand von Beispielen aus verschiedenen Kulturen (z.B. Ägypten, christliche und islamische Weltanschauung) veranschaulicht. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis von Zeit als historischer Kategorie.
3. Zeit und Zeitbewusstsein in der Geschichtsdidaktik: Dieses Kapitel befasst sich mit den entwicklungspsychologischen Grundlagen des Zeitbewusstseins, wobei die Modelle von Roth und Piaget im Detail erläutert werden. Es analysiert das Wissensmodell des historischen Denkens nach Kühberger und beschreibt Pandels Dimensionen des Geschichtsbewusstseins (Temporalbewusstsein, Wirklichkeitsbewusstsein, Wandelbewusstsein und gesellschaftliche Dimensionen). Das Kapitel liefert die theoretische Basis für die spätere heuristische Studie, indem es die Entwicklungsstufen des Zeitbewusstseins und die relevanten Faktoren für sein Verständnis in der Geschichtsdidaktik darstellt.
Schlüsselwörter
Zeitbewusstsein, Chronologie, Grundschüler, Geschichtsdidaktik, Zeitverständnis, zyklisch, linear, Entwicklungspsychologie, Ordnungsvermögen, heuristische Studie, historisches Denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Zeitbewusstsein von Grundschülern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Zeitbewusstsein von Grundschülern und ihre Fähigkeit, historische Ereignisse chronologisch zu ordnen. Sie erforscht die Entwicklung des Zeitverständnisses im Laufe der Grundschulzeit und identifiziert unterschiedliche Ordnungsstrategien von Kindern. Die Ergebnisse sollen Hinweise für die Förderung des Zeitbewusstseins im Geschichtsunterricht liefern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Betrachtungsweisen von Zeit (zyklisch, linear, synchron, diachron), historische Zeitmodelle (Braudel, Koselleck), entwicklungspsychologische Grundlagen des Zeitbewusstseins (Roth, Piaget), das Wissensmodell des historischen Denkens nach Kühberger, Pandels Dimensionen des Geschichtsbewusstseins und Methoden zur Förderung des Zeitbewusstseins im Unterricht. Eine heuristische Studie zu den zeitlichen Ordnungsfähigkeiten von Grundschülern bildet einen zentralen Bestandteil.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Zeit als historische Kategorie, Zeit und Zeitbewusstsein in der Geschichtsdidaktik, Heuristische Studie zum zeitlichen Ordnungsvermögen von Grundschülern und Methoden zur Förderung des Zeitbewusstseins im Unterricht. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Zeitbewusstseins und der Geschichtsdidaktik.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Zeitbewusstseins bei Grundschulkindern, deren chronologische Ordnungsstrategien, den Vergleich zwischen zyklischem und linearem Zeitverständnis, geschichtsdidaktische Grundlagen des Zeitverständnisses und Methoden zur Förderung des Zeitbewusstseins im Unterricht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine heuristische Studie, um das zeitliche Ordnungsvermögen von Grundschülern zu untersuchen. Weitere Methoden sind die Analyse bestehender geschichtsdidaktischer Theorien und Modelle zur Entwicklung des Zeitbewusstseins.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Erkenntnisse über die Entwicklung des Zeitbewusstseins im Laufe der Grundschulzeit, die Identifizierung unterschiedlicher Ordnungsstrategien von Kindern und die Entwicklung von Empfehlungen zur Förderung des Zeitbewusstseins im Geschichtsunterricht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Zeitbewusstsein, Chronologie, Grundschüler, Geschichtsdidaktik, Zeitverständnis, zyklisch, linear, Entwicklungspsychologie, Ordnungsvermögen, heuristische Studie und historisches Denken.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Geschichtslehrer, Wissenschaftler im Bereich der Geschichtsdidaktik und Entwicklungspsychologie sowie alle, die sich für das Verständnis von Zeit und dessen Entwicklung bei Kindern interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Text der Arbeit (hier nicht vollständig dargestellt).
- Quote paper
- Tashina Werner (Author), 2017, Zeitbewusstsein und chronologisches Ordnungsvermögen bei Grundschülern. Historischer Kontext und Methoden für die Geschichtsdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496663