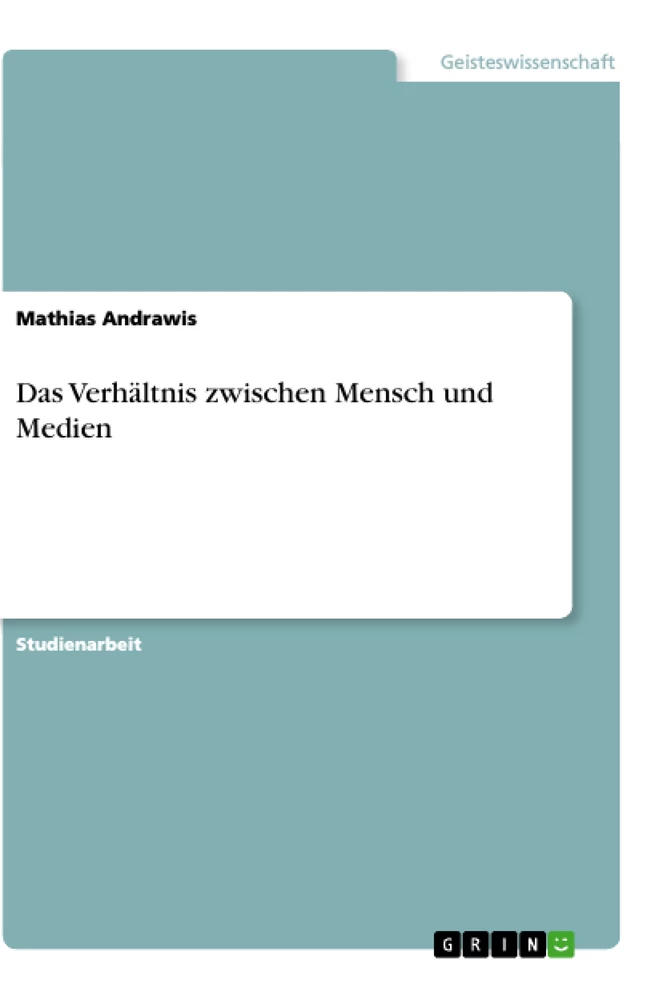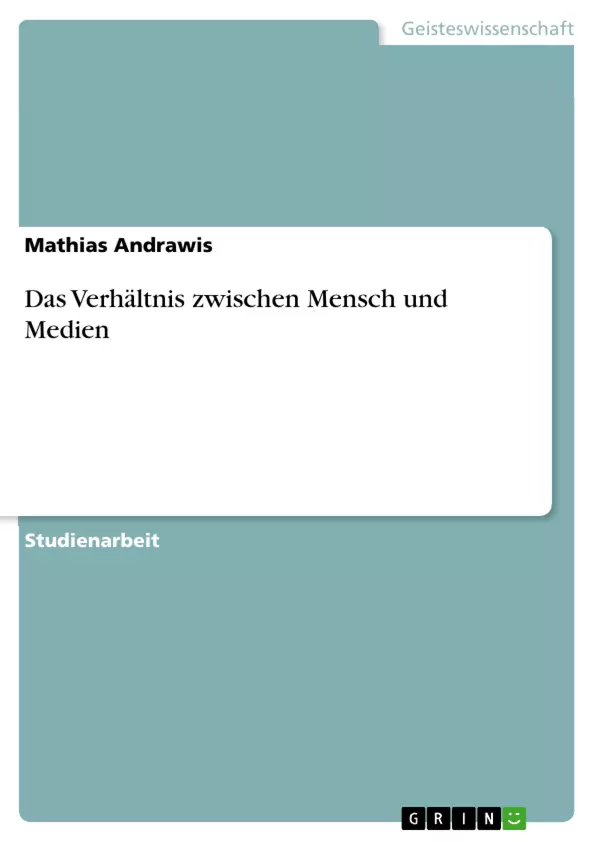Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der Mensch aufgrund der natürlichen Schwächen nicht mit der Leistungsfähigkeit der erzeugten Geräte mithalten kann. Ein Taschenrechner rechnet schneller, die Sinneszone wird durch den Blindenstock erweitert und Fabrikmaschinen arbeiten konsequenter. Aufgrund der Begrenztheit der sturen Leiblichkeit, im Gegensatz zu den modifizierbaren, reproduzierbaren und durchkalkulierten Geräten, muss der Mensch in seinem Gefühl der Unfähigkeit und Sterblichkeit verharren. Der Mensch flieht somit in die Ikonomanie, um sich über die Abgründe der Realität hinwegzutrösten. Ausgelöst wird die prometheische Scham, so Günther Anders, durch den unmittelbaren Umgang mit den selbstgemachten perfekten Dingen. Aufgrund der Tatsache, dass die unüberschaubaren Variationen von Medien und der Ausweg aus dem Labyrinth der Medientheorien, nur zur Quelle der Aporien führen würde, soll auf die Klärung des Medienbegriffes verzichtet werden, um einen Tunnelblick zu vermeiden und ein ganzheitliches Denken zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritik der Medien
- Die Verderblichkeit des Leibes
- Die Überwindung des Schams
- Frei sind die Dinge unfrei ist der Mensch
- Der Mensch als unersetzbarer Defekt
- Selbstzerstörung und Identitätskriese
- Probleme der Identitätsfindung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht medienanthropologische Systeme und deren Verhältnis zwischen Medien und Mensch, mit besonderem Fokus auf Günther Anders' Kritik an der Technokratie in seinem Werk „Die Antiquiertheit des Menschen“. Ziel ist es, die These zu belegen, dass Technokratie die Selbstermächtigung des Menschen abschafft.
- Kritik der Medien und deren Auswirkungen auf das menschliche Denken und Gedächtnis
- Anders' Konzept der prometheischen Scham und die Überlegenheit der Technik über den Menschen
- Die Begrenztheit des menschlichen Körpers im Vergleich zur Modifizierbarkeit von Technik
- Die Folgen der Technokratie für die menschliche Identität und Selbstermächtigung
- Vergleichende Betrachtung verschiedener medientheoretischer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der medienanthropologischen Systeme ein und benennt den Fokus auf Günther Anders' Kritik an der Technokratie. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Technik in den Mittelpunkt und kündigt die behandelten Kapitel an. Der Bezug auf Platons Phaidros-Dialog wird bereits hier hergestellt, um die kritische Auseinandersetzung mit der Technikgeschichte vorwegzunehmen. Die Arbeit legt den Grundstein für die anschließende Analyse von Anders' Werk und der Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf den Menschen. Der Verzicht auf eine genaue Definition des Begriffs "Medium" wird begründet und als methodische Entscheidung zur ganzheitlichen Betrachtung dargestellt.
Kritik der Medien: Dieses Kapitel beleuchtet die Medienkritik, beginnend mit Platons Skepsis gegenüber der Schrift als Gedächtnisprothese. Es wird argumentiert, dass Platons Kritik auch heute noch relevant ist, da die Abhängigkeit von Medien zu oberflächlichem Wissen und Vergessen führen kann. Der Vergleich zwischen dem antiken Denken und der heutigen Nutzung von Plattformen wie Wikipedia verdeutlicht den anhaltenden Trend zur oberflächlichen Informationsaufnahme. Die Diskussion über die negativen Konsequenzen technologischer Fortschritte wird eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf das menschliche Denken und Verhalten gelegt wird. Die kritische Auseinandersetzung mit Günther Anders' Werk wird vorbereitet, indem sein biographischer Kontext und dessen Einfluss auf sein Denken skizziert wird.
Die Verderblichkeit des Leibes: Dieses Kapitel untersucht den "Grundmakel" des Menschen im Vergleich zur Perfektion der technischen Erzeugnisse, ausgehend von Anders' Konzept der prometheischen Scham. Der Fokus liegt auf der Medienanthropologie und der Verbindung von Medien und Körper. Die Unvollkommenheit des menschlichen Körpers im Gegensatz zur Modifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit technischer Artefakte wird herausgestellt. Kant's Konzept der Freiheit des Verstandes wird in Relation zu Anders' Kritik an der Technokratie gesetzt, um die Problematik der menschlichen Unfähigkeit im Angesicht technologischer Überlegenheit zu beleuchten. Der Abschnitt unterstreicht die zentrale Rolle des Körpers in der medienanthropologischen Diskussion und seine Verletzlichkeit angesichts technologischer Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Medienanthropologie, Günther Anders, Technokratie, Prometheische Scham, Medienkritik, Gedächtnisprothese, Mensch-Maschine-Verhältnis, Identität, Selbstermächtigung, Platon, Phaidros-Dialog, Kulturindustrie.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Antiquiertheit des Menschen" - Medienanthropologische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert medienanthropologische Systeme und das Verhältnis zwischen Mensch und Medien, insbesondere im Kontext von Günther Anders' Kritik an der Technokratie in seinem Werk "Die Antiquiertheit des Menschen". Der Fokus liegt auf der These, dass Technokratie die menschliche Selbstermächtigung abschafft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kritik der Medien und deren Auswirkungen auf Denken und Gedächtnis, Anders' Konzept der prometheischen Scham und die Überlegenheit der Technik über den Menschen, die Begrenztheit des menschlichen Körpers im Vergleich zur Modifizierbarkeit von Technik, die Folgen der Technokratie für die menschliche Identität und Selbstermächtigung sowie einen Vergleich verschiedener medientheoretischer Ansätze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Medienkritik, ein Kapitel zur "Verderblichkeit des Leibes", ein Kapitel zum Menschen als Defekt, ein Kapitel zu Selbstzerstörung und Identitätskrise, ein Kapitel zu Problemen der Identitätsfindung, einen Schluss und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor. Die Kapitel untersuchen verschiedene Aspekte der Medienanthropologie im Kontext von Anders' Werk.
Wie wird Günther Anders' Werk in die Analyse einbezogen?
Günther Anders' "Die Antiquiertheit des Menschen" bildet den zentralen Bezugspunkt der Arbeit. Seine Kritik an der Technokratie, sein Konzept der prometheischen Scham und seine Analyse des Verhältnisses von Mensch und Technik werden detailliert untersucht und analysiert.
Welche Rolle spielt Platon in dieser Arbeit?
Platons Skepsis gegenüber der Schrift als Gedächtnisprothese (im Phaidros-Dialog) dient als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Medienkritik. Die Arbeit zeigt Parallelen zwischen Platons Kritik und den Herausforderungen der heutigen Medienlandschaft auf.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Medienanthropologie, Günther Anders, Technokratie, prometheische Scham, Medienkritik, Gedächtnisprothese, Mensch-Maschine-Verhältnis, Identität, Selbstermächtigung, Platon, Phaidros-Dialog und Kulturindustrie.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass die Technokratie die Selbstermächtigung des Menschen abschafft. Diese These wird durch die Analyse von Anders' Werk und medienanthropologischen Perspektiven belegt.
Wie wird der Begriff "Medium" in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit verzichtet auf eine explizite Definition des Begriffs "Medium", um eine ganzheitliche Betrachtung medienanthropologischer Systeme zu ermöglichen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine analytische und vergleichende Methode, um Anders' Werk im Kontext verschiedener medientheoretischer Ansätze zu untersuchen.
- Arbeit zitieren
- Mathias Andrawis (Autor:in), 2019, Das Verhältnis zwischen Mensch und Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496681