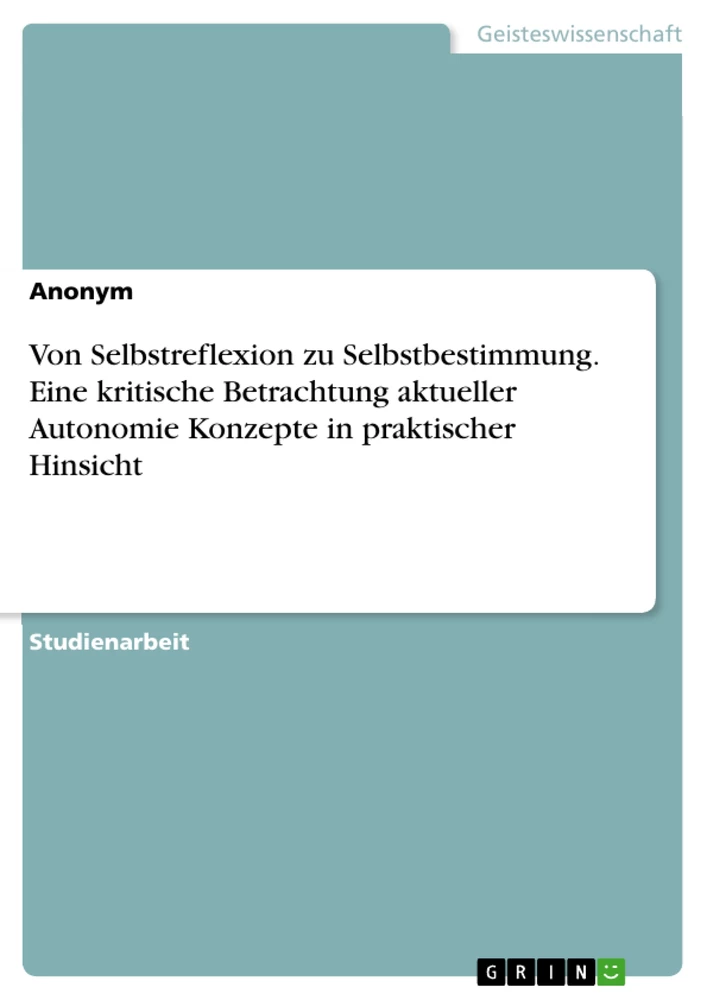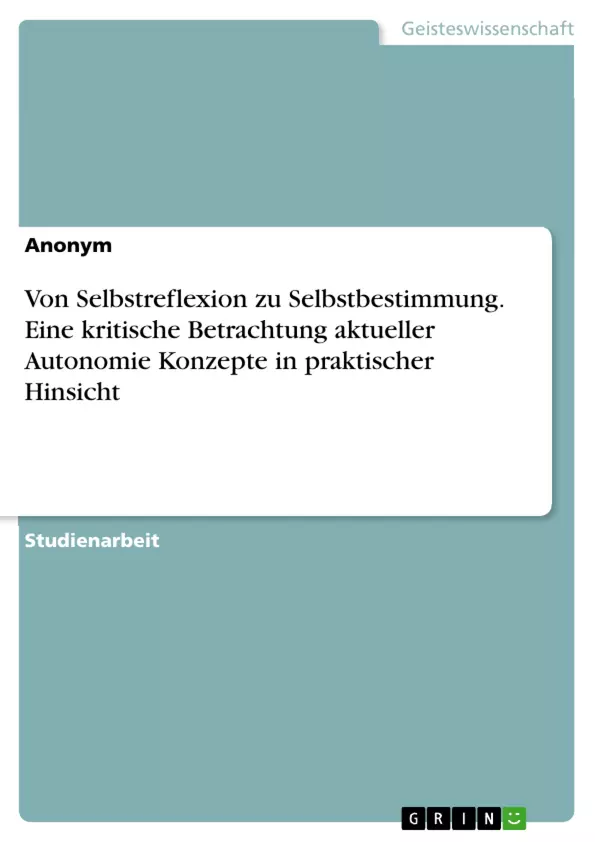Die Hausarbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt stelle ich Mackenzies relationales Autonomiekonzept vor, in welches sie unter anderem das narrativ-historische Konzept von John Christman implementiert. Im Weiteren werde ich erläutern was ein Selbst, eine Identität oder ein Ich, über das reflektiert werden soll, überhaupt ist. Im zweiten Abschnitt beschreibe ich Christmans Verständnis von Entfremdung und kritischer Reflexion. Im dritten Abschnitt diskutiere ich diese beiden Begriffe, inwiefern sie Probleme aufwerfen und im vierten Abschnitt fokussiere ich mich auf Christmans und Mackenzies Fähigkeitsanforderungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Mackenzies Autonomie Konzept
- Mackenzies drei Dimensionen der Autonomie.
- Diachronic practical identity.
- Historical Reflection and Alienation
- Die Natur des Geistes..
- The Internal Observer....
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie Autonomie in der heutigen Zeit, in der Menschen mit einer Vielzahl von Wertvorstellungen und Lebensstilen konfrontiert sind, erreichbar ist. Sie analysiert, wie Identitätskonzepte von Selbsterfahrung, Selbstbestimmung und Autonomie in praktische Reflexionsprozesse überführt werden können.
- Konzepte der personalen Autonomie nach Harry G. Frankfurt und Catriona Mackenzie
- Die Bedeutung der Selbstreflexion und der Entwicklung kritischer Reflexionsfähigkeiten
- Die Herausforderung der Entfremdung und deren Auswirkungen auf die Identität
- Die Rolle von emotionalen, imaginativen und sozialen Fähigkeiten für die Selbstbestimmung
- Das Problem der „verkörperten Identität“ und die Notwendigkeit einer „diachronic practical identity“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Autonomie und Identität ein und beleuchtet die Herausforderungen, die sich in der heutigen Gesellschaft für die Bildung einer kohärenten Identität ergeben. Im ersten Kapitel wird Mackenzies relationales Autonomiekonzept vorgestellt. Es wird darauf eingegangen, dass Mackenzies Konzept die „diachronic practical identity“ als ein zentrales Element zur Bewältigung des Problems der verkörperten Identität begreift. Das zweite Kapitel beleuchtet Christmans Verständnis von Entfremdung und kritischer Reflexion. Es wird dargelegt, dass Entfremdung aus dem Konflikt zwischen der „verkörperten Identität“ und dem „selbstbestimmten Willen“ entsteht. Das dritte Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die sich aus Christmans und Mackenzies Konzepten ergeben. Insbesondere wird die Frage behandelt, wie mit inneren Konflikten und verkörperter Entfremdung umgegangen werden kann. Das vierte Kapitel fokussiert sich auf Christmans und Mackenzies Fähigkeitsanforderungen für kritische Reflexion.
Schlüsselwörter
Personale Autonomie, Identität, Selbstreflexion, kritische Reflexion, Entfremdung, „verkörperte Identität“, „diachronic practical identity“, emotionale Fähigkeiten, imaginative Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Catriona Mackenzie unter „relationaler Autonomie“?
Mackenzie betont, dass Autonomie nicht isoliert entsteht, sondern durch soziale Beziehungen und den kulturellen Kontext geprägt und ermöglicht wird.
Was ist eine „diachronic practical identity“?
Es ist ein Identitätskonzept, das den Menschen als ein Wesen begreift, das sich über die Zeit hinweg (diachron) durch Handlungen und Reflexionen selbst definiert.
Wie definiert John Christman „Entfremdung“?
Entfremdung entsteht laut Christman, wenn ein Individuum seine eigenen Wünsche oder Identitätsmerkmale bei kritischer Reflexion nicht als zu sich gehörig anerkennen kann.
Welche Rolle spielen Emotionen für die Selbstbestimmung?
Emotionale Fähigkeiten sind laut der Arbeit essenziell, um eigene Werte zu erkennen und authentische Entscheidungen zu treffen, die über rein rationale Überlegungen hinausgehen.
Was ist das Problem der „verkörperten Identität“?
Es beschreibt die Herausforderung, dass unsere Identität oft durch körperliche Merkmale oder soziale Zuschreibungen bestimmt wird, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Von Selbstreflexion zu Selbstbestimmung. Eine kritische Betrachtung aktueller Autonomie Konzepte in praktischer Hinsicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496868