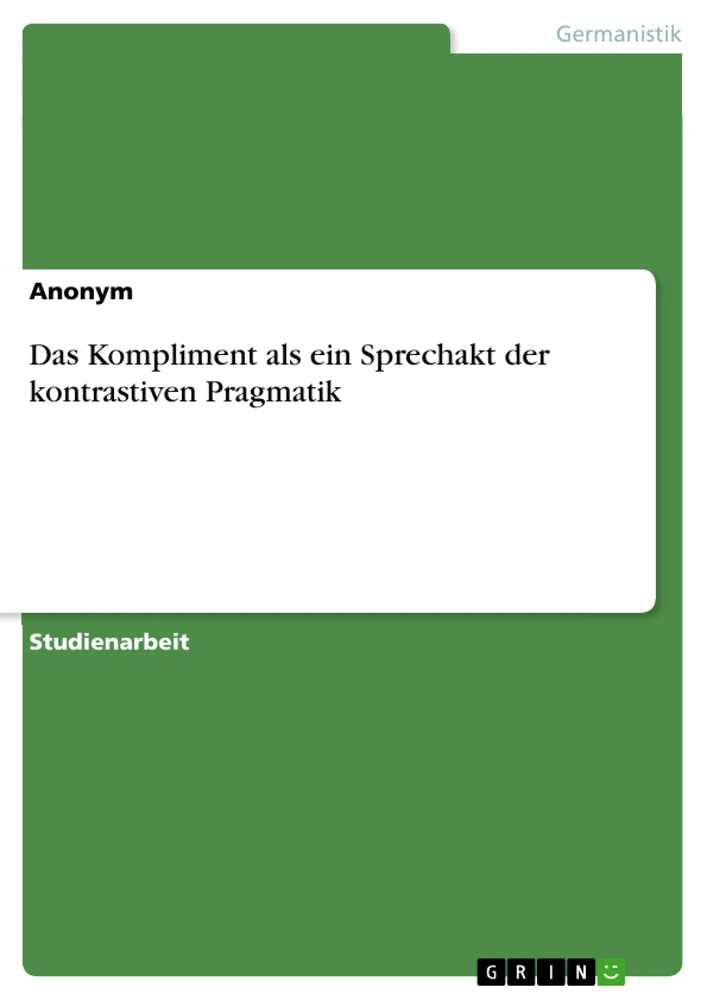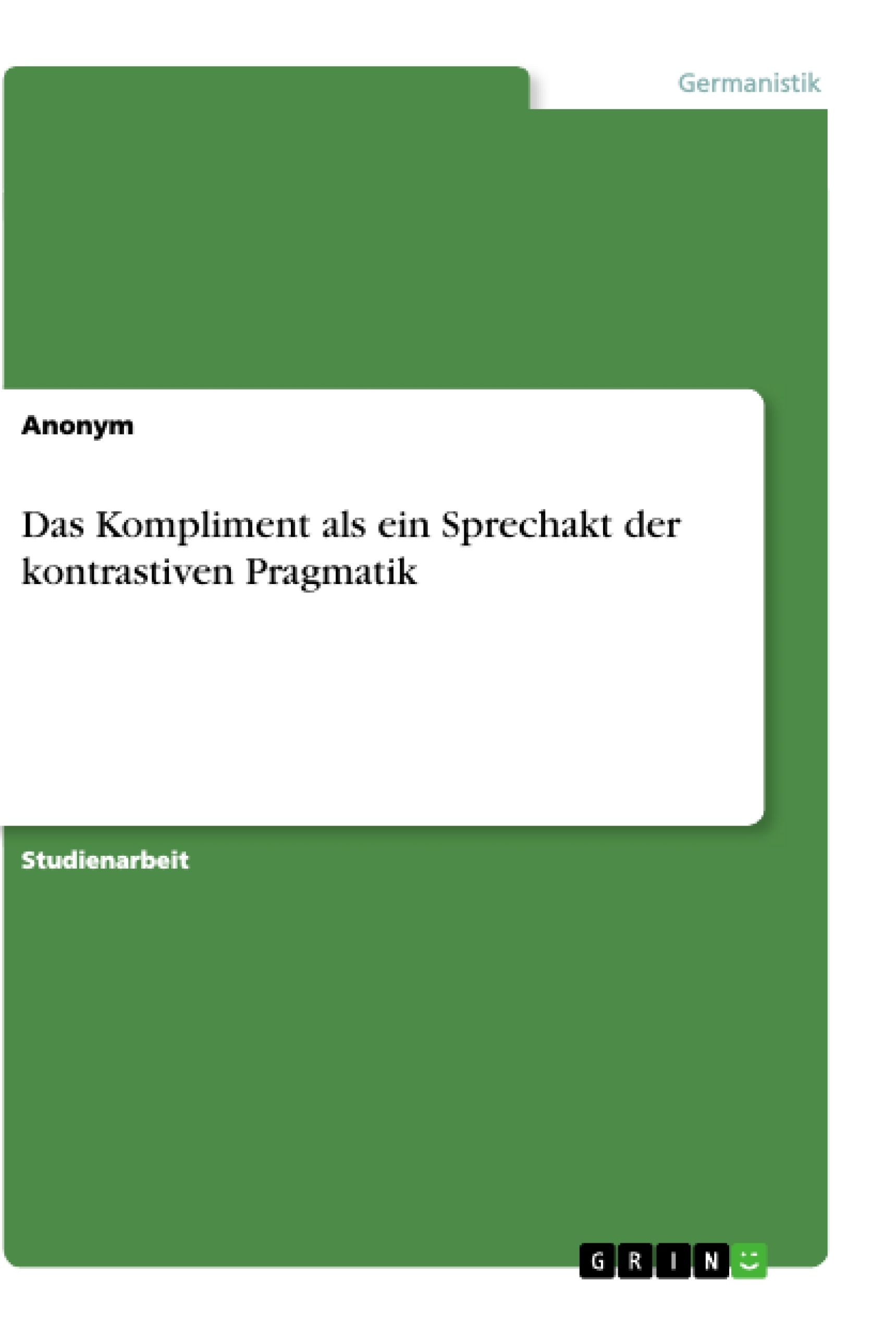In dieser Arbeit werden Greins Untersuchungen zum Thema des Sprechakts "Kompliment" nochmals aufgegriffen, um der grundlegenden Fragestellung, wie sich der Sprechakt des Kompliments in verschiedenen Sprachgemeinschaften und Kulturen unterschiedet, auf den Grund zu gehen.
Fortführend wird eine eigene empirische Forschung und deren Ergebnisse vorgestellt und mit Greins Ergebnissen verglichen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragestellung zu beantworten und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Kulturen herauszufiltern.
Das Kompliment ist ein Sprechakt, der in alltäglichen Lebensbereichen immer wieder auftaucht. In den meisten Kulturen dient er als Ausdruck von Höflichkeit, trotzdem wird der Sprechakt in jeder Sprachgemeinschaft unterschiedlich gebraucht und anerkannt. Der Sprechakt wurde in den letzten Jahren von Sprachwissenschaftlern vielseitig empirisch untersucht, beispielsweise von Herbert und Holmes.
Durch die Untersuchungen des Sprechakts erhielt man Einsichten in jede einzelne Sprachgemeinschaft und somit auch in die Unterschiede der verschiedenen Wertesysteme und Sprachgebräuche. Auch Marion Grein hat durch ihre Untersuchung "Der Sprechakt des Komplimentierens im interkulturellen Vergleich" einige grundlegende Ergebnisse ermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definition
- 3. Höflichkeitstheorie nach Brown/Levinson (1987)
- 4. Grein, Marion (2008): „Der Sprechakt des Kompliments im interkulturellen Vergleich“
- 5. Eigene Untersuchung zum interkulturellen Vergleich des Sprechakts in Bezug auf Anwendung und Reaktionen
- 5.1 Auswertung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Sprechakt des Kompliments im interkulturellen Vergleich. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in verschiedenen Sprachgemeinschaften und Kulturen herauszuarbeiten. Die Arbeit stützt sich auf die Forschung von Marion Grein und präsentiert Ergebnisse einer eigenen empirischen Untersuchung.
- Der Sprechakt des Kompliments in verschiedenen Kulturen
- Die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson im Kontext von Komplimenten
- Funktion und Status von Komplimenten
- Interkulturelle Unterschiede im Umgang mit Komplimenten
- Vergleich eigener empirischer Forschung mit den Ergebnissen von Grein
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung legt die Grundlage der Arbeit, indem sie die Relevanz des Sprechakts "Kompliment" im alltäglichen Leben und in der interkulturellen Kommunikation betont. Sie verweist auf frühere Forschungsarbeiten von Herbert (1990) und Holmes (1988), die wichtige Einblicke in die Unterschiede verschiedener Wertesysteme und Sprachgebräuche liefern. Die Arbeit von Marion Grein (2008) wird als wichtiger Bezugspunkt genannt, und es wird die Zielsetzung formuliert, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit Komplimenten in verschiedenen Kulturen zu untersuchen, basierend auf einer eigenen empirischen Studie, die im Vergleich zu Greins Ergebnissen analysiert werden soll.
2. Definition: Dieses Kapitel definiert den Sprechakt "Kompliment" als "freundliche Anerkennung des Sprechers über etwas, das den Hörer betrifft" (Searle/Vanderveken, 1985). Es wird die Grundbedingung erörtert, dass ein Kompliment positiv vom Gesprächspartner gewertet werden muss, um als solches zu gelten. Holmes (1987) Definition wird zitiert und erläutert, die betont, dass Komplimente positive Eigenschaften, Fähigkeiten oder Besitztümer des Adressaten hervorheben. Das Kapitel erweitert die Definition, indem es weitere Funktionen von Komplimenten nach Mulo Farenkia (2004) und verwandte Sprechakte nach Wagner (2001) beschreibt, die die Vielschichtigkeit des Sprechakts unterstreichen.
3. Höflichkeitstheorie nach Brown/Levinson (1987): Dieses Kapitel präsentiert die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson, die auf Goffmanns Konzept des "face" basiert. Es erklärt die Unterscheidung zwischen "positive face" (Wunsch nach Anerkennung) und "negative face" (Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit). Die Theorie der "face-threatening acts" (FTAs) wird eingeführt und es wird erläutert, wie Komplimente als positive Höflichkeitsstrategie eingesetzt werden können, um das "positive face" des Gesprächspartners zu wahren und gleichzeitig eine positive Verbindung herzustellen. Der Unterschied zur negativen Höflichkeit wird ebenfalls dargestellt.
4. Grein, Marion (2008): „Der Sprechakt des Kompliments im interkulturellen Vergleich“: Dieses Kapitel fasst Greins Arbeit zum interkulturellen Vergleich von Komplimenten zusammen. Es werden die von Grein identifizierten Funktionen von Komplimenten erläutert, nämlich die Aufwertung des positiven Gesichts des Hörers, das Ausdrücken von Gemeinsamkeiten und das Schaffen eines Solidaritätsgefühls. Die Arbeit betont auch den nicht immer positiven Status von Komplimenten, abhängig von den kulturellen Gepflogenheiten und der Gewichtung des negativen Gesichts in verschiedenen Kulturen.
Schlüsselwörter
Kompliment, Sprechakt, interkulturelle Kommunikation, Höflichkeitstheorie, Brown/Levinson, positive und negative Höflichkeit, face-threatening acts, interkultureller Vergleich, empirische Forschung, Grein, Solidarität, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkultureller Vergleich des Sprechakts "Kompliment"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Sprechakt des Kompliments im interkulturellen Vergleich. Sie analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Komplimenten in verschiedenen Sprachgemeinschaften und Kulturen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Komplimenten in verschiedenen Kulturen herauszuarbeiten. Die Arbeit stützt sich auf die Forschung von Marion Grein und präsentiert Ergebnisse einer eigenen empirischen Untersuchung, um diese mit Greins Ergebnissen zu vergleichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Sprechakt des Kompliments in verschiedenen Kulturen, die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson im Kontext von Komplimenten, die Funktion und den Status von Komplimenten, interkulturelle Unterschiede im Umgang mit Komplimenten und einen Vergleich der eigenen empirischen Forschung mit den Ergebnissen von Grein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einführung, Definition des Sprechakts "Kompliment", der Höflichkeitstheorie nach Brown/Levinson, der Zusammenfassung der Arbeit von Grein (2008), der eigenen empirischen Untersuchung mit Auswertung und einem Fazit.
Wie wird das Kompliment definiert?
Der Sprechakt "Kompliment" wird als "freundliche Anerkennung des Sprechers über etwas, das den Hörer betrifft" definiert (Searle/Vanderveken, 1985). Es wird betont, dass ein Kompliment positiv vom Gesprächspartner gewertet werden muss, um als solches zu gelten. Die Definition wird durch weitere Funktionen von Komplimenten nach Mulo Farenkia (2004) und verwandte Sprechakte nach Wagner (2001) erweitert.
Welche Rolle spielt die Höflichkeitstheorie von Brown/Levinson?
Die Arbeit präsentiert die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson, die auf Goffmanns Konzept des "face" basiert. Es wird erklärt, wie Komplimente als positive Höflichkeitsstrategie eingesetzt werden können, um das "positive face" des Gesprächspartners zu wahren und eine positive Verbindung herzustellen. Der Unterschied zur negativen Höflichkeit wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die Arbeit von Marion Grein (2008)?
Die Arbeit von Marion Grein (2008) dient als wichtiger Bezugspunkt. Ihre identifizierten Funktionen von Komplimenten (Aufwertung des positiven Gesichts, Ausdruck von Gemeinsamkeiten, Schaffung von Solidarität) werden erläutert. Die Arbeit betont auch den nicht immer positiven Status von Komplimenten, abhängig von kulturellen Gepflogenheiten.
Wie wird die eigene empirische Untersuchung durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet eine eigene empirische Untersuchung zum interkulturellen Vergleich des Sprechakts "Kompliment" in Bezug auf Anwendung und Reaktionen. Die Auswertung dieser Untersuchung wird im fünften Kapitel vorgestellt und mit den Ergebnissen von Grein verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kompliment, Sprechakt, interkulturelle Kommunikation, Höflichkeitstheorie, Brown/Levinson, positive und negative Höflichkeit, face-threatening acts, interkultureller Vergleich, empirische Forschung, Grein, Solidarität, Anerkennung.
Welche weiteren Forschungsarbeiten werden erwähnt?
Die Arbeit verweist auf frühere Forschungsarbeiten von Herbert (1990) und Holmes (1988), die wichtige Einblicke in die Unterschiede verschiedener Wertesysteme und Sprachgebräuche liefern. Holmes (1987) Definition von Komplimenten wird zitiert und erläutert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Das Kompliment als ein Sprechakt der kontrastiven Pragmatik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496869