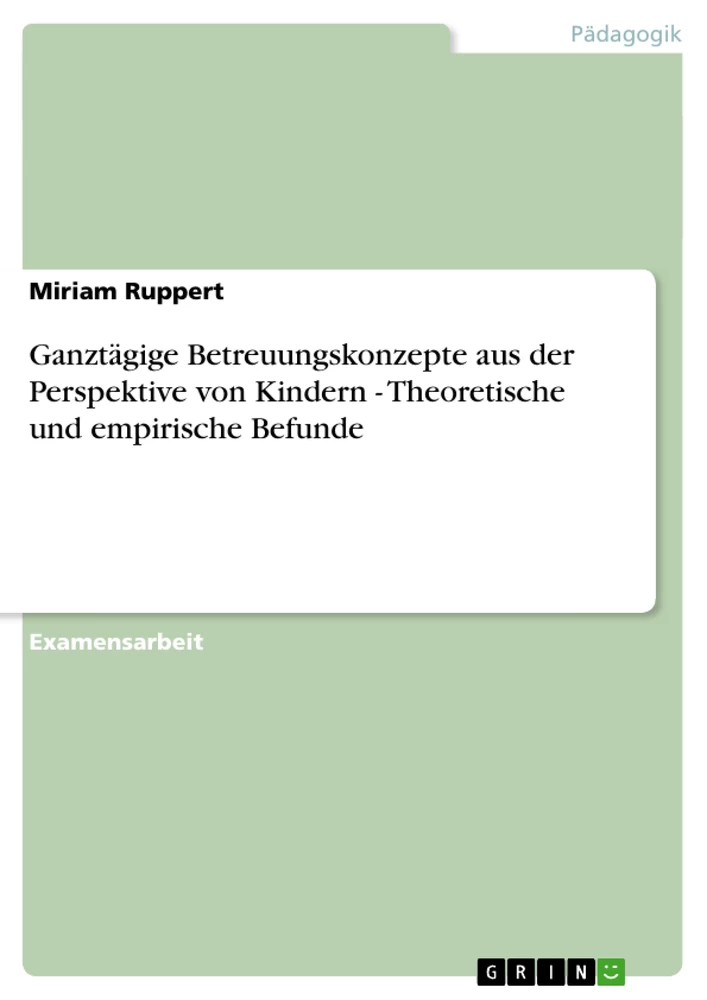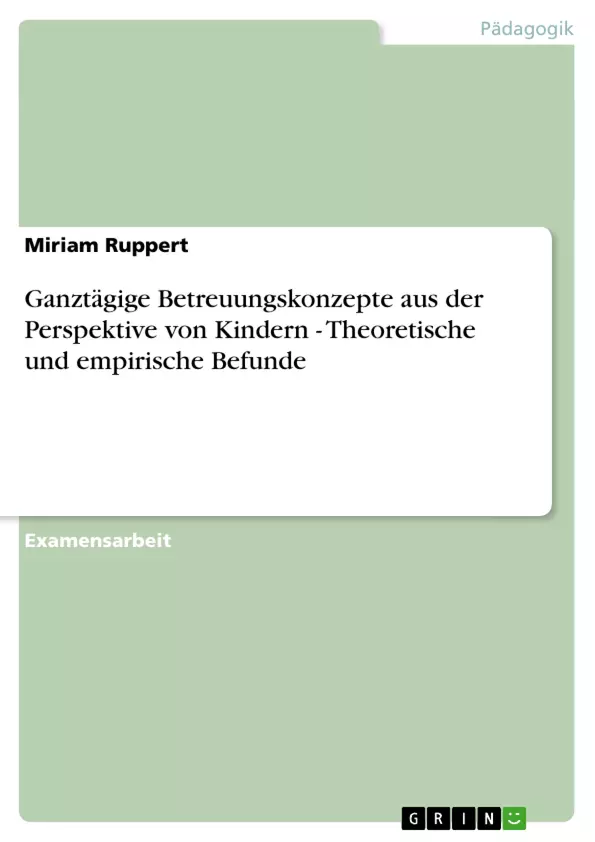In der vorliegenden Arbeit wird versucht, ganztägige Betreuungskonzepte aus der Perspektive von Kindern zu erfassen und darzulegen. In diesem Zusammenhang werden vor allem die Tagesabläufe und das Wohlbefinden der Kinder in den Betreuungskonzepten beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ganztägige Betreuung von Grundschulkindern – eine theoretische Grundlage
- Begriffsbestimmung für ganztägige schulische und außerschulische Bildungs- und Erziehungsformen
- Ganztagsschule, als Oberbegriff für ganztägig geführte Schulen
- Offene Schule
- Ganztagsschule
- Tagesheimschule
- Fünf Modelle ganztägiger schulischer und außerschulischer Betreuung
- Modelle mit additivem Ansatz
- Modelle mit integrativem Ansatz
- Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung ganztägiger Betreuung für Grundschulkinder in Deutschland
- Entwicklung der Zuständigkeitsbereiche
- Pädagogische und historische Entwicklung der Ganztagsschule
- Von dem klassischen Modell der ganztägigen Unterrichtsschule zur halbtägigen Unterrichtsschule
- Entwicklung der Ganztagsschule nach dem Ersten Weltkrieg
- Entwicklung der Ganztagsschule nach dem Zweiten Weltkrieg
- Entwicklungsstand der Ganztagsschule in den verschiedenen Bundesländern
- Von der 'klassischen' ganztägigen Unterrichtsschule zur `modernen Ganztagsschule im angelsächsischen Raum
- Pädagogische und historische Entwicklung des Hortes
- Begriffsbestimmung für ganztägige schulische und außerschulische Bildungs- und Erziehungsformen
- Ganztägige Betreuung von Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen am Beispiel Wuppertal
- Betreuungssituation der Stadt Wuppertal
- Die Konzepte von Hort, `SiT' und `Dreizehn Plus' incl. dem Konzept 'Verlässliche Grundschule von acht bis eins' in Nordrhein-Westfalen
- Der Hort in Nordrhein-Westfalen
- Der Schülertreff `SiT' in Nordrhein-Westfalen
- 'Dreizehn Plus' und die 'Verlässliche Grundschule von acht bis eins' in Nordrhein-Westfalen
- Das neue Konzept der `Offenen Ganztagsschule im Primarbereich' in Nordrhein-Westfalen
- Auftrag und Ziele der `Offenen Ganztagsschule'
- Organisation der `Offenen Ganztagsschule'
- Empirische Untersuchung: Wohlbefinden und Tagesabläufe von Grundschulkindern in ganztägigen Betreuungen
- Vorgehen und Planung bei der empirischen Untersuchung
- Entwicklung der Untersuchungsinstrumente
- Vorüberlegungen zur Durchführung der Untersuchung
- Beschaffung von Informationen und Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen der Stadt Wuppertal
- Auswahl der Untersuchungseinrichtungen und Kontaktaufnahme
- Durchführung der empirischen Untersuchung
- Die Betreuungseinrichtungen
- Die Liegi – Kids´ an der Gemeinschaftsgrundschule Liegnitzer Straße
- Das 'Mauseloch' an der Engelbert-Wüster-Weg-Grundschule in Ronsdorf
- Die Hortgruppen St. Paul in Langerfeld
- Treff 51' der Schülertreff in Velbert-Neviges
- Vergleich der Betreuungseinrichtungen
- Durchführung der Interviews
- Die Betreuungseinrichtungen
- Ergebnisse der Untersuchung
- Rahmendaten der Kinder
- Teilstudie I: Tagesabläufe von Grundschulkindern in ganztägigen Betreuungseinrichtungen
- Zu Hause, vor der Schule
- Betreuung vor dem Unterricht
- Nachmittagsbetreuung
- Zu Hause, nach der Nachmittagsbetreuung
- Teilstudie II: Das Wohlbefinden von Grundschulkindern in ganztägigen Betreuungseinrichtungen
- Förderung individueller Interessen
- Hausaufgaben und Lernverhalten
- Mitbestimmung und Wahlfreiheit
- BetreuerInnenqualitäten
- Freundschaften
- Wohlbefinden nach eigenen Angaben
- Freiwilligkeit
- Räumlichkeiten
- Vorgehen und Planung bei der empirischen Untersuchung
- Entwicklung und verschiedene Modelle ganztägiger Betreuungskonzepte
- Die Situation der ganztägigen Betreuung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in Wuppertal
- Die Perspektive der Kinder auf die Tagesabläufe und das Wohlbefinden in verschiedenen Betreuungseinrichtungen
- Die Relevanz der Untersuchung für die Einführung der `Offenen Ganztagsschule im Primarbereich' in Nordrhein-Westfalen
- Der Vergleich verschiedener Betreuungskonzepte und die Analyse ihrer Qualität
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und das Ziel der Untersuchung vor. Es wird betont, dass die Perspektive der Kinder in der bisherigen Forschung zu ganztägiger Betreuung vernachlässigt wurde.
- Ganztägige Betreuung von Grundschulkindern – eine theoretische Grundlage: Dieses Kapitel definiert verschiedene Begriffsformen der ganztägigen Betreuung, beschreibt unterschiedliche Modelle und gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland.
- Ganztägige Betreuung von Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen am Beispiel Wuppertal: Dieses Kapitel beleuchtet die Betreuungssituation in Wuppertal und stellt verschiedene Betreuungskonzepte wie den Hort, `SiT' und `Dreizehn Plus' vor. Außerdem wird das Konzept der `Offenen Ganztagsschule im Primarbereich' in Nordrhein-Westfalen detailliert beschrieben.
- Empirische Untersuchung: Wohlbefinden und Tagesabläufe von Grundschulkindern in ganztägigen Betreuungen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Durchführung der empirischen Untersuchung. Es werden verschiedene Betreuungseinrichtungen in Wuppertal vorgestellt, die teilgenommen haben, und die Ergebnisse der Interviews mit den Kindern zusammengefasst.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ganztägige Betreuungskonzepte aus der Perspektive von Grundschulkindern und beleuchtet dabei insbesondere die Tagesabläufe und das Wohlbefinden der Kinder in diesen Einrichtungen. Die Studie füllt eine Forschungslücke, indem sie die Erfahrungen der Kinder in den Mittelpunkt stellt und nicht nur die Sichtweisen von Eltern, BetreuerInnen oder Lehrkräften berücksichtigt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Ganztägige Betreuung, Grundschule, Kinderperspektive, Tagesabläufe, Wohlbefinden, Betreuungskonzepte, Hort, `SiT', `Dreizehn Plus', `Offene Ganztagsschule im Primarbereich', Nordrhein-Westfalen, Wuppertal, empirische Untersuchung, Interview
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Studie zur Ganztagsbetreuung?
Die Arbeit untersucht ganztägige Betreuungskonzepte aus der Perspektive der Kinder, insbesondere deren Tagesabläufe und Wohlbefinden.
Welche Modelle der Ganztagsbetreuung werden unterschieden?
Es wird zwischen additiven Ansätzen (Unterricht und Betreuung getrennt) und integrativen Ansätzen (Unterricht und Freizeit verzahnt) unterschieden.
Wie beurteilen Kinder ihr Wohlbefinden in der Betreuung?
Das Wohlbefinden hängt laut der Interviews stark von der Mitbestimmung, der Qualität der Betreuer, den Räumlichkeiten und der Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen, ab.
Was ist die "Offene Ganztagsschule" in NRW?
Ein Konzept im Primarbereich, das Bildung, Erziehung und Betreuung verbindet, wobei die Teilnahme nach der Anmeldung für ein Schuljahr verbindlich ist.
Welche Rolle spielen Hausaufgaben im Ganztag?
Die Begleitung der Hausaufgaben ist ein zentraler Bestandteil, wobei die Kinder dies je nach Betreuungskonzept als Unterstützung oder Belastung empfinden.
- Quote paper
- Miriam Ruppert (Author), 2004, Ganztägige Betreuungskonzepte aus der Perspektive von Kindern - Theoretische und empirische Befunde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49695