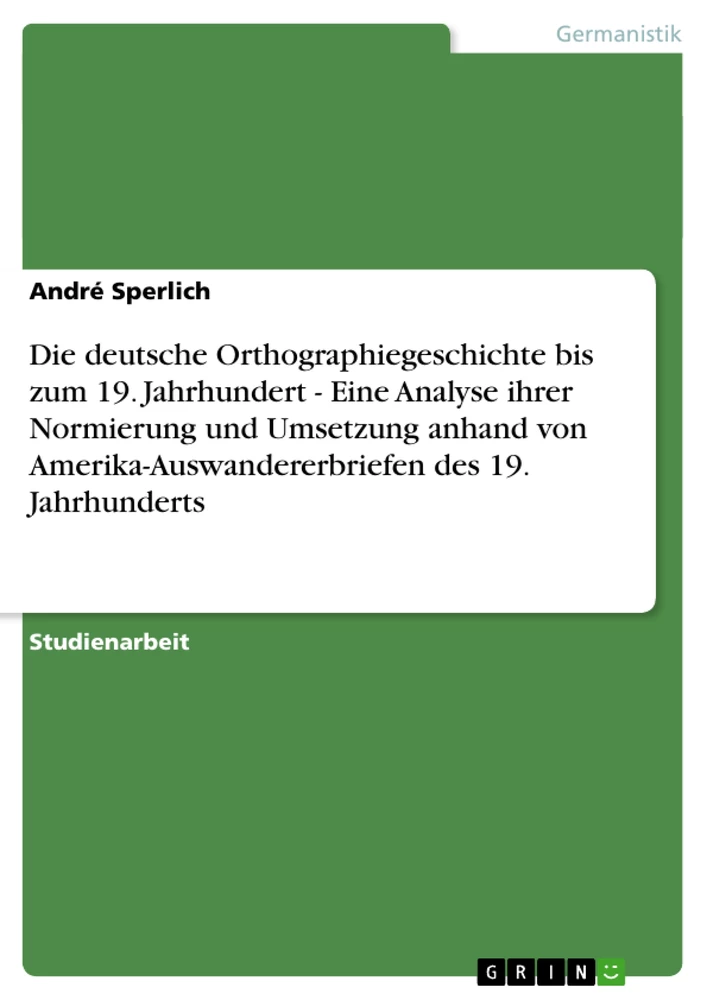Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich im Theorieteil zunächst ausführlich mit der Entwicklung der deutschen Orthographie von ihren historischen Anfängen bis ins 19. Jahrhundert. Sie geht detailliert auf zahlreiche Normierungsversuche ein und erläutert mögliche Gründe für ihr Scheitern. Ebenso werden einige typische Merkmale der deutschen Schriftlichkeit des betrachteten Zeitabschnitts betrachtet und es wird beschrieben, welchen Wandeln die Schreibkonventionen bis zur endgültigen Normierung im Jahr 1901 unterlegen waren. Berücksichtigt werden hier auch die Umsetzung der ermittelten Schreibkonventionen in den Alltagsbriefen der Bevölkerung und die daraus resultierenden Mehrfachschreibungen.
Anschließend werden einige Informationen über die Auswanderung aus Deutschland nach Amerika dargelegt, gefolgt von der Klärung der Frage, was Auswandererbriefe überhaupt sind und warum sie etwas über die orthographischen Normen des 19. Jahrhunderts und deren Umsetzung aussagen können. Der Empirieteil der Arbeit weist die zuvor beschriebenen Schreibkonventionen und deren Problematiken anhand zweier Auswandererbriefe aus den Jahren 1855 und 1887 nach. Hierzu werden exemplarisch einige orthographische Besonderheiten der betrachteten Briefe herausgestellt und sie mit der zuvor ermittelten vorherrschenden Schreibkonvention in Verbindung gesetzt. Im Anschluss daran wird die Frage nach der Briefkonzeption als eher mündlich oder schriftlich tradiert behandelt, was dann in die abschließende Zusammenfassung und Bewertung der Analyse münden wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Theorieteil
- 1. Problemstellung
- 2. Die Entwicklung der normierten Schriftlichkeit bis 1901
- 2.1. Entwicklung der deutschen Schriftlichkeit bis zum 15. Jahrhundert
- 2.2 Entwicklungen im 16. Jahrhundert
- 2.3 Entwicklungen im 17. Jahrhundert
- 2.4 Entwicklungen im 18. Jahrhundert
- 2.5 Normierung im 19. Jahrhundert
- 2.5.1 Entwicklungen bis 1876
- 2.5.1 Die I. Orthographische Konferenz 1876
- 2.5.2 Die II Orthographische Konferenz 1901
- 3. Auswandererbriefe – Zeugen der Entwicklung einer normierten Orthographie?
- 3.1 Wie kommt es zur Auswanderung?
- 3.2 Was sind Auswandererbriefe und können sie etwas über die orthographischen Normen des 19. Jahrhunderts aussagen?
- II. Empirieteil
- 1. Hintergrund der betrachteten Briefe
- 1.1 Brief von C. Städler
- 1.2 Brief von Johanna Getzlaff
- 2. Bereiche mit orthographischen Variationen.
- 2.1 Groß- und Kleinschreibung
- 2.1.1 Brief von C. Städler
- 2.1.2 Brief von Johanna Getzlaff
- 2.2 Getrennt- und Zusammenschreibung
- 2.3 Graphemische Schreibvariationen
- 2.3.1 th/t
- 2.3.2 d/t
- 2.3.3 ie/i
- 2.4 Orthographische Besonderheiten
- 2.1 Groß- und Kleinschreibung
- 3. Sprachliche Konzeption der Briefe
- 3.1 Brief von C. Städler
- 3.2 Brief von Johanna Getzlaff
- 4. Zusammenfassung
- 1. Hintergrund der betrachteten Briefe
- III. Literatur
- IV. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Entwicklung der deutschen Orthographie vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Normierung und die Gründe für das Scheitern früherer Versuche. Darüber hinaus untersucht sie die Umsetzung der Schreibkonventionen in Alltagsbriefen von Auswanderern nach Amerika im 19. Jahrhundert.
- Entwicklung der deutschen Orthographie von ihren Anfängen bis zum 19. Jahrhundert
- Normierungsversuche und ihre Gründe für das Scheitern
- Typische Merkmale der deutschen Schriftlichkeit im betrachteten Zeitraum
- Auswandererbriefe als Quelle zur Analyse der Orthographienormierung
- Orthographische Besonderheiten in Auswandererbriefen des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Der Theorieteil der Arbeit beleuchtet zunächst die Entwicklung der deutschen Orthographie von ihren Anfängen bis ins 19. Jahrhundert. Er analysiert die verschiedenen Normierungsversuche, ihre Gründe für das Scheitern und die typischen Merkmale der deutschen Schriftlichkeit im betrachteten Zeitraum. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Schreibkonventionen bis zur endgültigen Normierung im Jahr 1901. Die Arbeit untersucht auch, wie die normierte Schriftlichkeit in den Alltagsbriefen der Bevölkerung umgesetzt wurde und welche Mehrfachschreibungen daraus resultierten. Im Anschluss werden Informationen über die Auswanderung aus Deutschland nach Amerika dargelegt und die Frage geklärt, inwiefern Auswandererbriefe Einblicke in die orthographischen Normen des 19. Jahrhunderts und deren Umsetzung geben können.
Der Empirieteil widmet sich der Analyse zweier Auswandererbriefe aus den Jahren 1855 und 1887. Es werden exemplarisch orthographische Besonderheiten der Briefe hervorgehoben und in Bezug zu den zuvor ermittelten vorherrschenden Schreibkonventionen gesetzt. Abschließend wird die Frage nach der Briefkonzeption, ob sie eher mündlich oder schriftlich geprägt ist, behandelt. Die Ergebnisse münden dann in die abschließende Zusammenfassung und Bewertung der Analyse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der deutschen Orthographiegeschichte, Normierungsversuchen, Auswandererbriefen, Schreibkonventionen, Mehrfachschreibungen, Sprachgeschichte und Schriftkultur. Die Analyse fokussiert auf die Entwicklung der normierten Schriftlichkeit bis 1901 und die Umsetzung der Schreibkonventionen im 19. Jahrhundert anhand von Auswandererbriefen.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die deutsche Orthographie endgültig normiert?
Die endgültige Normierung erfolgte im Jahr 1901 nach der II. Orthographischen Konferenz.
Warum sind Amerika-Auswandererbriefe für die Sprachforschung wichtig?
Diese Alltagsbriefe zeigen, wie die Bevölkerung Schreibkonventionen in der Praxis umsetzte und welche Variationen (z.B. th/t, d/t) vor der Normierung üblich waren.
Welche orthographischen Variationen werden im Brief von C. Städler analysiert?
Die Analyse fokussiert auf die Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung sowie graphemische Variationen wie ie/i.
Was geschah bei der I. Orthographischen Konferenz 1876?
Sie war ein früher Versuch der Vereinheitlichung, der jedoch aufgrund von Widerständen und unterschiedlichen Ansätzen zunächst scheiterte.
Sind Auswandererbriefe eher mündlich oder schriftlich konzipiert?
Die Arbeit untersucht die sprachliche Konzeption und stellt fest, dass viele Briefe stark von der mündlichen Ausdrucksweise der Schreiber geprägt sind.
- Arbeit zitieren
- André Sperlich (Autor:in), 2005, Die deutsche Orthographiegeschichte bis zum 19. Jahrhundert - Eine Analyse ihrer Normierung und Umsetzung anhand von Amerika-Auswandererbriefen des 19. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49696