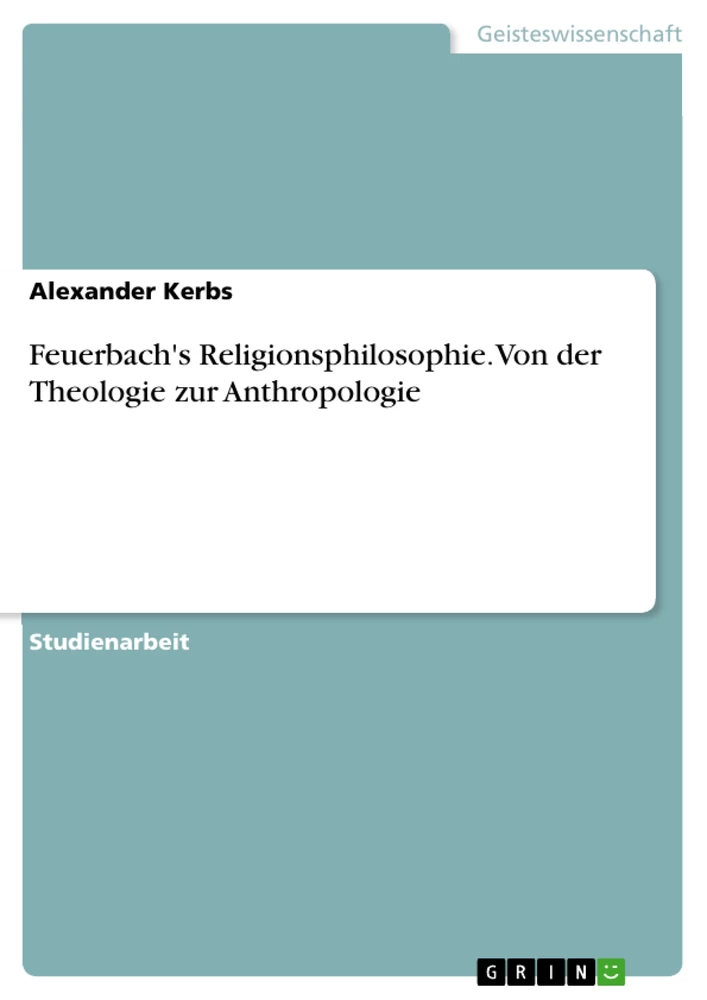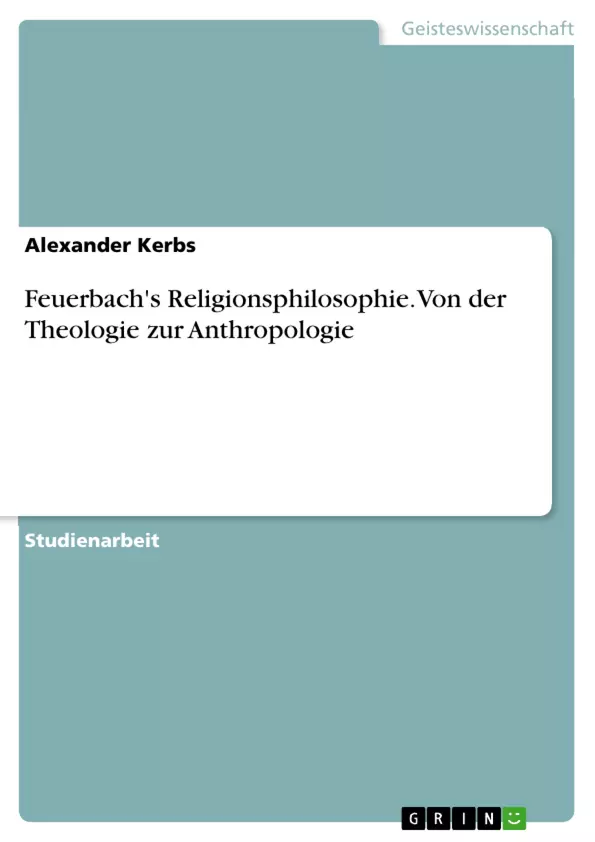Ist die Religion ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft oder ist sie nur eine Projektion unserer Wünsche und Hoffnungen? Dieser Frage ging Ludwig Andreas Feuerbach im 19. Jahrhundert nach und wollte beweisen, dass den religiösen Mythen und Prophezeiungen natürliche und einfache Erklärungen zugrunde liegen, die sich durch naturwissenschaftliche Methoden erklären lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Überblick
- Theologie im 19. Jahrhundert
- Begriff der Anthropologie
- Anthropologie
- Philosophische Anthropologie
- Feuerbach's Philosophie der Sinne
- Das Wesen des Christentums
- Von der Theologie zur Anthropologie?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Feuerbachs Religionsphilosophie und untersucht, ob seine „empirisch-philosophische Analyse“ ausreichend ist, um die Theologie als Anthropologie zu etablieren. Die Arbeit beleuchtet die historischen und philosophischen Grundlagen von Feuerbachs Thesen und diskutiert seine Kritik an der Religion im Kontext des deutschen Idealismus und der Theologie des 19. Jahrhunderts.
- Feuerbachs Religionsphilosophie und ihre Einordnung in die Philosophiegeschichte
- Die Kritik Feuerbachs an der Religion und seine anthropologische Sichtweise
- Die Rezeption von Feuerbachs Philosophie und ihre Bedeutung für die Religionskritik
- Der Zusammenhang zwischen Theologie und Anthropologie
- Die Rolle der empirischen Analyse in Feuerbachs Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Philosophie und Theologie des 19. Jahrhunderts, mit besonderem Fokus auf den deutschen Idealismus und die christliche Dogmatik. Dieses Kapitel dient als Grundlage für die Einordnung von Feuerbachs Philosophie.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Begriff der Anthropologie, sowohl in der allgemeinen als auch in der philosophischen Bedeutung. Es werden verschiedene Auffassungen der philosophischen Anthropologie dargestellt.
Kapitel drei konzentriert sich auf Feuerbachs Philosophie der Sinne und seine Religionskritik, die in seinem Hauptwerk „Das Wesen des Christentums“ dargestellt wird. Dieses Kapitel beleuchtet Feuerbachs These, dass Religion eine Projektion menschlicher Bedürfnisse und Wünsche ist und seine anthropologische Interpretation des Christentums.
Schlüsselwörter
Feuerbach, Religionsphilosophie, Anthropologie, Theologie, Deutscher Idealismus, Christentum, Empirismus, Religionskritik, Sinnlichkeit, Projektion, Mensch, Geschichte, Philosophie, Wissenschaft, Dogmatik
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Feuerbachs Religionskritik?
Feuerbach argumentiert, dass Gott eine Projektion menschlicher Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse ist und die Theologie daher eigentlich Anthropologie sei.
Was bedeutet "Von der Theologie zur Anthropologie"?
Es beschreibt Feuerbachs Bestreben, religiöse Mythen durch naturwissenschaftliche und empirisch-philosophische Analysen des Menschen zu erklären.
Welches Werk von Feuerbach steht im Mittelpunkt?
Das Hauptwerk, das in dieser Arbeit analysiert wird, ist "Das Wesen des Christentums".
Wie ordnet sich Feuerbach in die Philosophiegeschichte ein?
Er wird als bedeutender Kritiker im Kontext des deutschen Idealismus und der Theologie des 19. Jahrhunderts betrachtet.
Was versteht Feuerbach unter der "Philosophie der Sinne"?
Feuerbach betont die Sinnlichkeit und empirische Analyse als Grundlage für das Verständnis der menschlichen Existenz anstelle rein abstrakter Theologie.
- Quote paper
- Alexander Kerbs (Author), 2019, Feuerbach's Religionsphilosophie. Von der Theologie zur Anthropologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497350