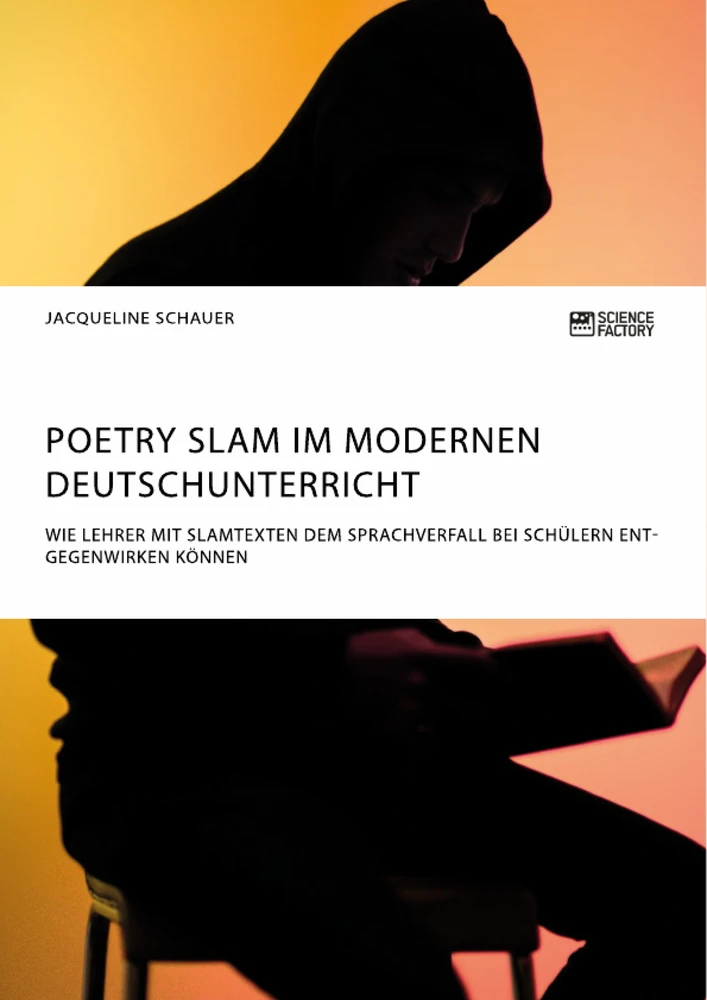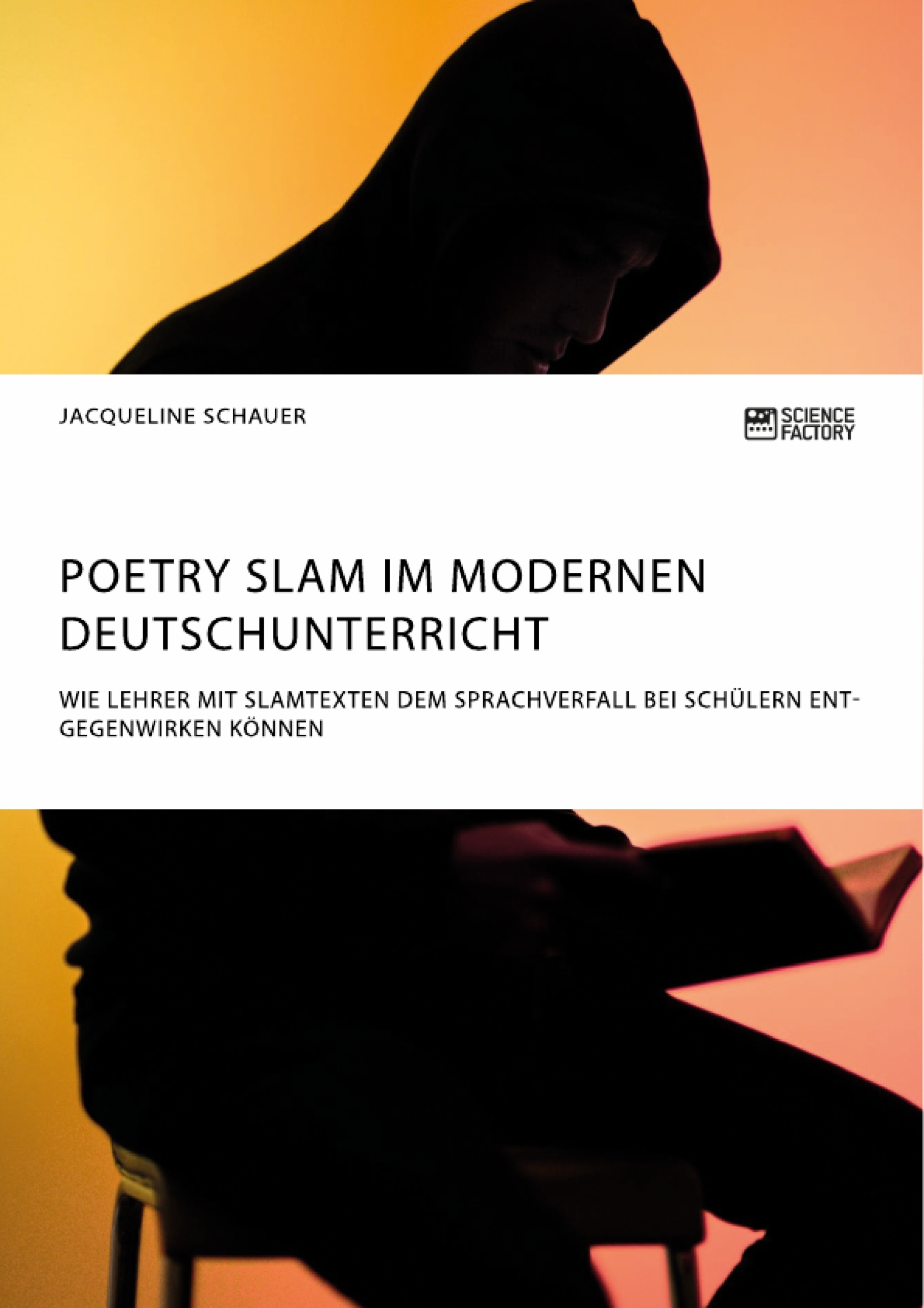Kinder und Jugendliche haben immer weniger Lust, längere Texte zu lesen. Sie kommunizieren verstärkt über die Social Media-Kanäle und drücken sich im Deutschen zunehmend schlechter aus.
Poetry Slam ist eine modernde Literaturbewegung, die wegen ihrer Dynamik und der Vielfalt ihrer Themen gern von Jugendlichen genutzt wird. Sollten sie nicht auch im Unterricht die Möglichkeit bekommen, sich mit ihrem Selbst- und Weltverständnis stärker auseinanderzusetzen? Können Deutschlehrer/innen die neuen Medien sinnvoll in den Unterricht integrieren und dabei gezielt den Blick auf Sprache und Sprachgebrauch schärfen?
Jacqueline Schauer zeigt, welche vielseitigen Möglichkeiten Poetry Slam dem modernen Deutschunterricht bietet und für welche Klassenstufen er sich eignet. Sie betont, dass es auch für Fremdprachenlernende geeignete didaktische Konzepte gibt. Ihr Buch richtet sich an Pädagog/innen.
Aus dem Inhalt:
- Sprachkompetenz;
- Wettbewerb;
- Kreativität;
- Unterhaltung;
- Rhythmus;
- Stil
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Poetry Slam - Herkunft und Definition
- Poetry Slam - Die Regeln
- Veranstaltungscharakteristika
- Merkmale von Slam Poetry
- Möglichkeiten von Poetry Slam im modernen Deutschunterricht: Optimale Kompetenzförderung am Beispiel der Bildungsstandards und des Lehrplans 15
- Förderung des Kompetenzbereichs Sprechen und Zuhören
- Förderung des Kompetenzbereichs Schreiben
- Förderung des Kompetenzbereichs Lesen - mit Texten und Medien umgehen
- Förderung des Kompetenzbereichs Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
- Poetry Slam als Mittel zur Motivation und Identitätsbildung
- Der performative Charakter Poetry Slams
- Aktualität, Authentizität und Offenheit
- Identifikation und Selbsterfahrung
- Vom Umgang mit Konflikten durch Schreibhandeln
- Interkulturelle Kompetenz: Selbst- und Fremdverstehen
- Poetry Slam - ein demokratisches Format
- Mögliche Grenzen von Poetry Slam
- Unterrichtsentwurf: Doppelstunde zum Thema „Poetry Slam - Was ist das und wie bewerte ich einen Slamtext?"
- Überlegungen zu einer möglichen Folgestunde
- Didaktische Überlegungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einbindung von Poetry Slam in den modernen Deutschunterricht. Sie untersucht, wie Lehrer mithilfe von Slamtexten dem Sprachverfall bei Schülern entgegenwirken können und welche Kompetenzen im Deutschunterricht mithilfe des Poetry Slams gefördert werden können.
- Poetry Slam als didaktisches Mittel im Deutschunterricht
- Förderung von Sprachkompetenz und Kreativität
- Motivation und Identitätsbildung durch Poetry Slam
- Mögliche Grenzen und Herausforderungen
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Poetry Slams im Deutschunterricht vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Forschungsstand zur Thematik.
Kapitel 3 widmet sich der Herkunft und Definition von Poetry Slam. Es werden die Regeln, Veranstaltungscharakteristika und Merkmale von Slam Poetry erörtert.
Kapitel 4 untersucht die Möglichkeiten des Poetry Slams im Deutschunterricht. Es wird gezeigt, wie Poetry Slam zur Förderung verschiedener Kompetenzbereiche im Deutschunterricht beitragen kann, z.B. Sprechen, Zuhören, Schreiben, Lesen und Sprache und Sprachgebrauch untersuchen.
Kapitel 5 beleuchtet die Bedeutung von Poetry Slam für Motivation und Identitätsbildung. Die performative Natur von Poetry Slam, die Aktualität, Authentizität und Offenheit von Slamtexten sowie die Identifikationsmöglichkeiten und Selbsterfahrungen, die Poetry Slam bietet, werden diskutiert.
In Kapitel 6 werden mögliche Grenzen von Poetry Slam im Deutschunterricht thematisiert.
Kapitel 7 präsentiert einen Unterrichtsentwurf für eine Doppelstunde zum Thema „Poetry Slam - Was ist das und wie bewerte ich einen Slamtext?“. Es werden Überlegungen zu einer möglichen Folgestunde und didaktische Überlegungen zur Durchführung der Unterrichtsstunde angestellt.
Schlüsselwörter
Poetry Slam, Deutschunterricht, Sprachkompetenz, Kreativität, Motivation, Identitätsbildung, Bildungsstandards, Lehrplan 15, performativer Charakter, Aktualität, Authentizität, Interkulturelle Kompetenz, Grenzen, Unterrichtsentwurf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Poetry Slam?
Ein Poetry Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem Autoren ihre selbstverfassten Texte innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe (meist 5-6 Minuten) live vor Publikum vortragen. Die Bewertung erfolgt direkt durch das Publikum oder eine Jury aus Zuschauern.
Wie kann Poetry Slam im Deutschunterricht genutzt werden?
Er eignet sich hervorragend zur Förderung der Kompetenzbereiche Sprechen, Zuhören, Schreiben und Lesen. Durch den performativen Charakter und die moderne Sprache motiviert er Schüler, sich kreativ mit Texten auseinanderzusetzen.
Kann Poetry Slam dem Sprachverfall bei Schülern entgegenwirken?
Ja, da Slam-Texte einen bewussten Umgang mit Sprache, Rhythmus und Stilmitteln erfordern. Schüler lernen, ihre Ausdrucksfähigkeit zu schärfen und Sprache gezielt einzusetzen, um eine Wirkung beim Publikum zu erzielen.
Welche Rolle spielt Poetry Slam für die Identitätsbildung?
Slam-Texte sind oft sehr persönlich und authentisch. Das Schreiben und Vortragen ermöglicht es Jugendlichen, sich mit ihrem Selbst- und Weltverständnis auseinanderzusetzen und Konflikte durch kreatives Schreiben zu verarbeiten.
Eignet sich Poetry Slam auch für den Fremdsprachenunterricht?
Ja, es gibt didaktische Konzepte für Fremdsprachenlernende. Poetry Slam fördert hier spielerisch den Wortschatz, die Aussprache und das kulturelle Verständnis der Zielsprache.
- Quote paper
- Jacqueline Schauer (Author), 2019, Poetry Slam im modernen Deutschunterricht. Wie Lehrer mit Slamtexten dem Sprachverfall bei Schülern entgegenwirken können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497479