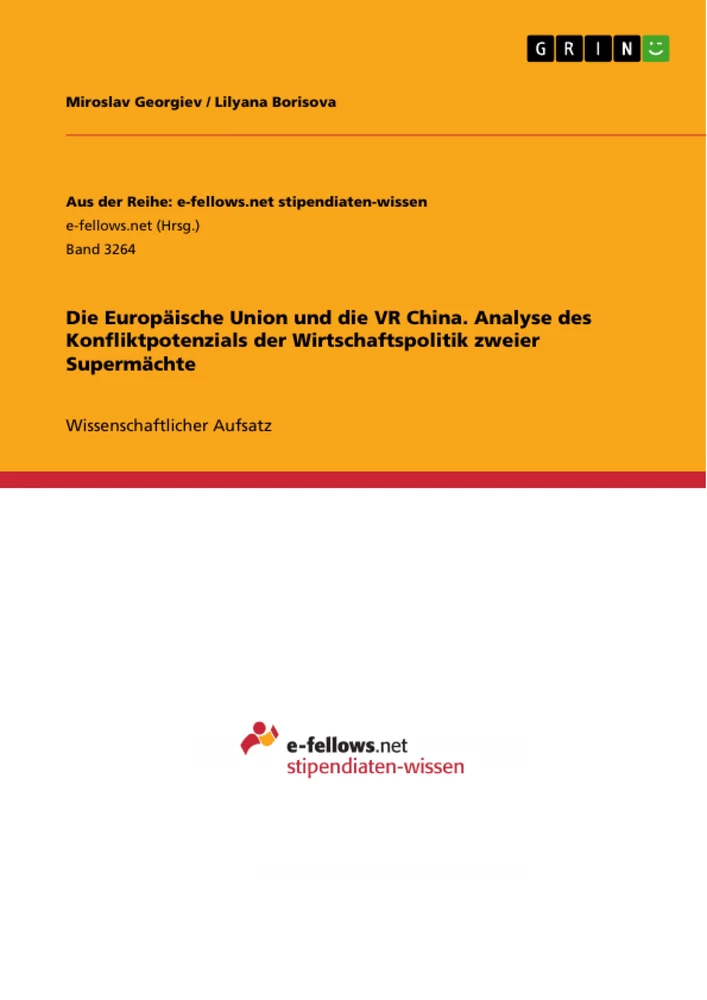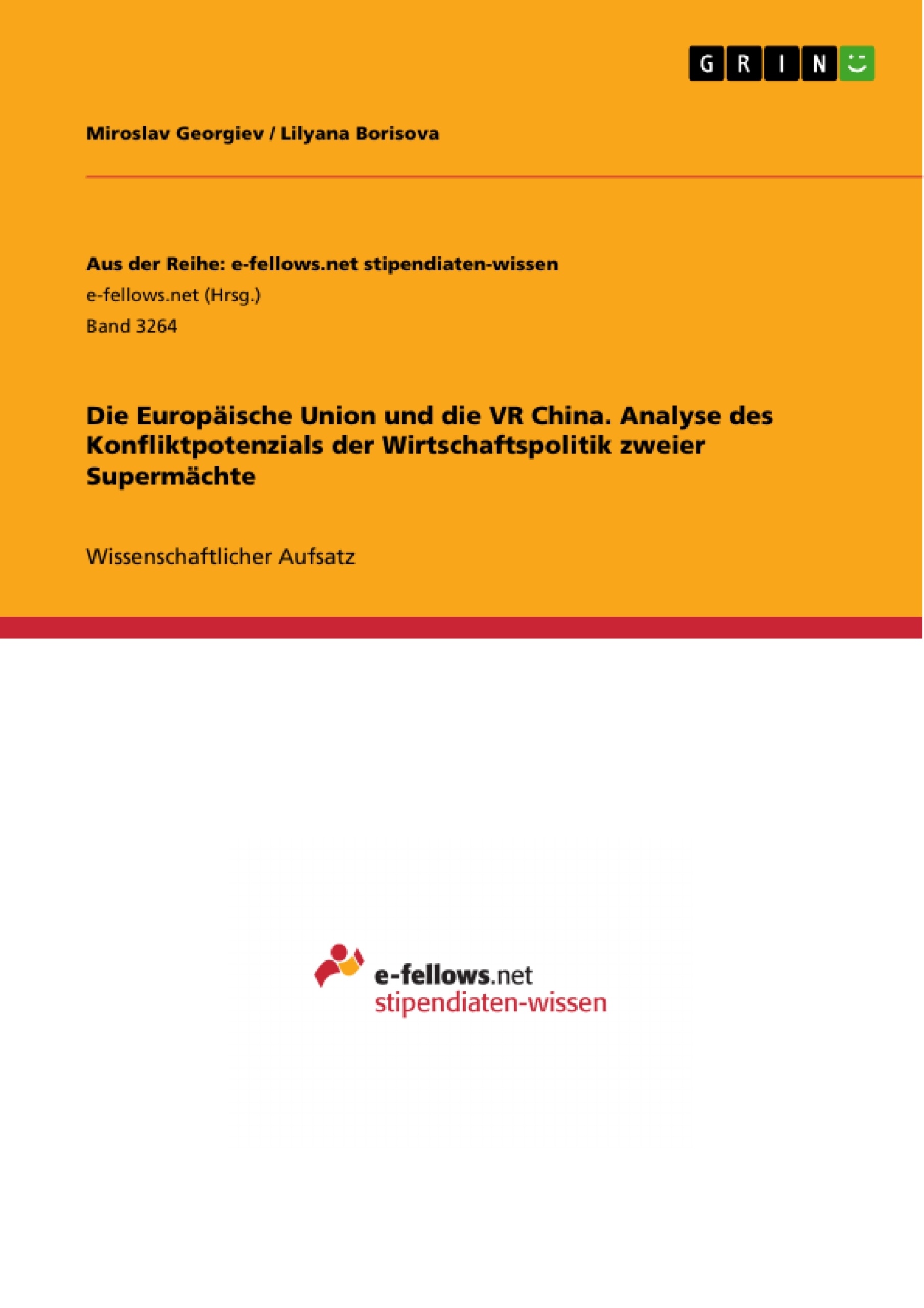Diese Arbeit untersucht mögliche Konfliktpunkte zwischen der Europäischen Union ("EU") und China bezüglich ihrer Wirtschaftspolitik.
Die EU ist nominal (nach den Vereinigten Staaten) und nach Kaufkraftparität (nach der VR China) die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt (soweit die EU als ganze und nicht nach Mitgliedsstaaten betrachtet wird). Das BIP der Europäischen Union wurde 2018 auf nominal 18,8 Bil. US-Dollar geschätzt, was ca. 22 % der Weltwirtschaft ausmacht. VR Chinas ("China") Volkswirtschaft ist zugleich nominal die drittgrößte der Welt (nach den Vereinigten Staaten und der EU). Es ist somit kein Wunder, dass die EU und China sehr enge wirtschaftliche Beziehungen miteinander pflegen.
Der Warenverkehr zwischen der EU und China belief sich in 2017 auf ca. 573 Mrd. EUR, wobei zwei Drittel davon die Einfuhr der EU aus China darstellen. Die EU hat auch erhebliche Bedeutung für die chinesische Wirtschaft und ist in 2018 der größte Importeur in China. Diese Wirtschaftsbeziehungen sowie die nahezu bedeutungslose sicherheitspolitische Konfliktpunkte sorgen dafür, dass beide Parteien bestrebt sind, das wirtschaftliche Wachstum beider Volkswirtschaften fortzusetzen und entsprechend für beide Seiten eine Win-Win-Situation zu erziehen, bei der die Unternehmen der beiden Volkswirtschaften von diesen guten Geschäftsbeziehungen profitieren können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung der Beziehungen zwischen VR China und EU
- Die Wirtschaft als Schwerpunkt der Politik der beiden Akteure – eine Grundlage für ökonomische Interdepenz und Spannungsverhältnisse
- Die protektionistischen Maßnahmen der chinesischen Wirtschaftspolitik – die Basis der europäischen Unzufriedenheit
- Die Regulierung der chinesischen Unternehmen in der EU
- Nationale Gesetze und Investitionsprüfung
- Gegenmaßnahmen auf EU-Ebene
- Das chinesische Engagement in Europa
- One Belt One Road Initiative
- Initiative „16+1“
- Prinzipielle Grundlage
- Der Stand in 2018
- Die kurzfristigen wirtschaftlichen Ziele der MOEL gegenüber der langfristigen strategischen Vision Chinas
- Chinas Investitionsmuster und Direkte Investionen in den MOEL
- Chinas Infrastrukturbauprojekte
- Chinesische Kreditvergabepraktiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel analysiert die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Volksrepublik China (VR China) mit besonderem Augenmerk auf die wirtschaftlichen Interdependenzen und Spannungsverhältnisse. Die Autoren beleuchten die historische Entwicklung der Beziehungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Auswirkungen der chinesischen Wirtschaftspolitik auf die EU.
- Die zunehmende ökonomische Interdependenz zwischen EU und China
- Die protektionistischen Maßnahmen der chinesischen Wirtschaftspolitik
- Die Regulierung chinesischer Unternehmen in der EU
- Die Auswirkungen der chinesischen Investitionen auf die europäische Wirtschaft
- Die unterschiedlichen Perspektiven der EU und Chinas auf die Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die EU und China als zwei der größten Volkswirtschaften der Welt vor und betont die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Akteuren. Außerdem wird auf das bestehende Konfliktpotenzial hingewiesen.
- Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und China, angefangen von der Unterzeichnung des „EC-China Trade and Economic Cooperation Agreement“ in den 1980er Jahren bis hin zur zunehmenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den 1990er Jahren. Der Artikel analysiert die Ursachen für die positive Entwicklung der Beziehungen und die Bedeutung der Sicherheitspolitik für die Stabilität der Beziehungen.
- Kapitel 3 beleuchtet die Rolle der Wirtschaft als Schwerpunkt der Politik beider Akteure. Der Artikel untersucht die protektionistischen Maßnahmen der chinesischen Wirtschaftspolitik, die zu Unzufriedenheit in der EU führen. Außerdem werden die Regulierungsmechanismen für chinesische Unternehmen in der EU, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, dargestellt.
- Kapitel 4 konzentriert sich auf das chinesische Engagement in Europa, insbesondere auf die „One Belt One Road Initiative“ und die „16+1 Initiative“. Der Artikel analysiert die Ziele, die Investitionsmuster und die Kreditvergabepraktiken Chinas im Hinblick auf diese Initiativen.
Schlüsselwörter
EU, VR China, Wirtschaftsbeziehungen, Protektionismus, Investitionen, „One Belt One Road Initiative“, „16+1 Initiative“, Konfliktpotenzial, Interdependenz, Sicherheit, Handelspolitik
Häufig gestellte Fragen
Wie wichtig sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China?
Die EU und China gehören zu den drei größten Volkswirtschaften der Welt; 2017 belief sich der Warenverkehr auf ca. 573 Mrd. Euro, was eine enorme gegenseitige Abhängigkeit bedeutet.
Was sind die Hauptkonfliktpunkte in der Wirtschaftspolitik?
Zentrale Probleme sind protektionistische Maßnahmen Chinas, ungleicher Marktzugang für europäische Firmen und die staatliche Regulierung chinesischer Unternehmen in der EU.
Was ist die "One Belt One Road Initiative"?
Es ist Chinas langfristige strategische Vision ("Neue Seidenstraße"), durch Infrastrukturprojekte und Investitionen globalen Einfluss zu gewinnen, auch in Europa.
Was verbirgt sich hinter der "16+1 Initiative"?
Es ist ein Kooperationsformat zwischen China und mittel- sowie osteuropäischen Ländern (MOEL), das in der EU oft kritisch als Versuch der Spaltung der Union gesehen wird.
Wie reagiert die EU auf chinesische Investitionen?
Die EU verstärkt die Investitionsprüfung und erlässt Gesetze, um strategisch wichtige Branchen vor der Übernahme durch staatlich subventionierte ausländische Firmen zu schützen.
- Quote paper
- Miroslav Georgiev (Author), Lilyana Borisova (Author), 2019, Die Europäische Union und die VR China. Analyse des Konfliktpotenzials der Wirtschaftspolitik zweier Supermächte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497922