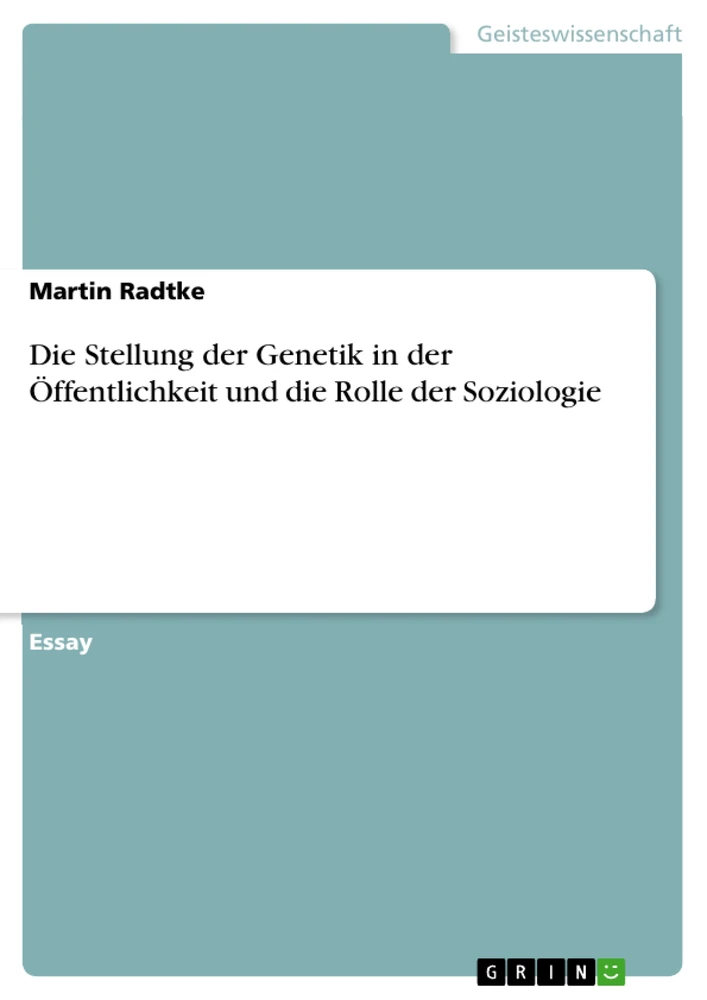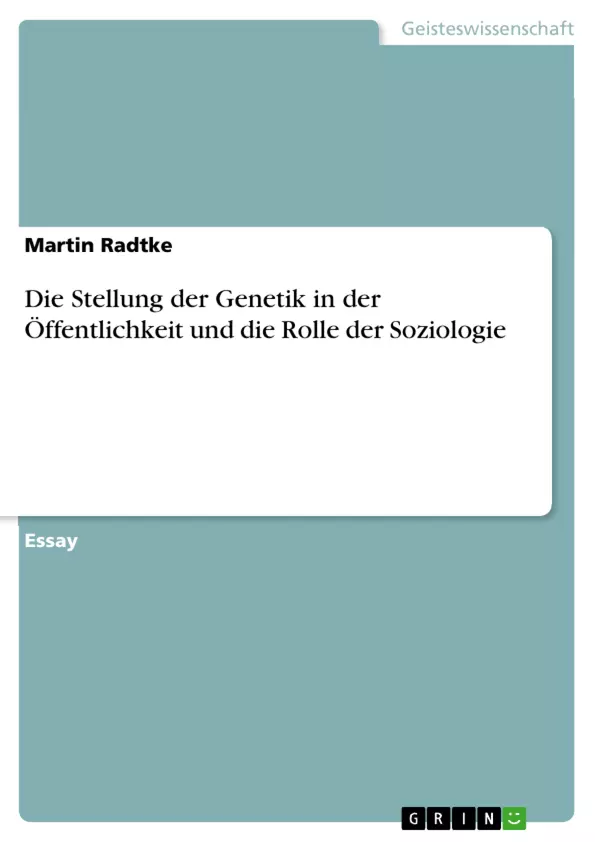Die Genforschung hat spätestens seit dem letzten Drittel des 20 Jahrhunderts zahlreiche Fortschritte erzielen können, aufgrund derer eine stetige Zunahme der Gestaltungsmöglichkeiten der Natur durch den Menschen zu verzeichnen sind. Die Entdeckung der Struktur der DNA in Form einer Doppelhelix in den 1950er Jahren war eine wichtige Voraussetzung für die Gründung des Humangenomprojekts, welches kein geringeres Ziel hatte als die Entschlüsselung des menschlichen Genoms – was auch kurz nach der Jahrtausendwende als erreicht erklärt wurde (vgl. Nationales Genomforschungsnetz). [...] Mit dem Aufkommen und der Weiterentwicklung der Genforschung im Allgemeinen und der Humangenomforschung im Besonderen entsteht ein öffentlicher Diskurs über deren Chancen und Risiken. Dieser wird beispielsweise bereits gegen Ende der 1990er Jahre im Rahmen eines Sammelbands herausgegeben von Jäger (vgl. 1997) und Merten (vgl. 1999) analysiert. Danach nehmen sich Gerhards und Schäfer in den frühen 2000ern (vgl. 2006; 2007) erneut dem Gendiskurs an. Auffällig ist dabei z.B. die zentrale Erkenntnis von Gerhards und Schäfer (vgl. 2007: 218) des nahezu vierfach so hohen Standings – also die relative Häufigkeit des Vorkommens eines Akteurs oder einer Akteursgruppe – der Biologen und Naturwissenschaftler im Vergleich zu den Sozial- und Geisteswissenschaftlern. Darüber hinaus stellen Genforscher ihren Forschungsgegenstand und ihre Ergebnisse eher positiv dar, während insbesondere Sozialwissenschaftler eine eher kritischere Haltung einnehmen (vgl. ebd.: 220). Obwohl Gene und Umwelt in einem wechselseitigen Interaktionsverhältnis zu einander stehen, scheinen die Disziplinen der Genforschung und der Sozialwissenschaften eher in einem Gegensatzverhältnis zueinander zu stehen. Deutet man diesen Umstand als ein mögliches Aufleben der Debatte um das Selbstverständnis und die Legitimation der Soziologie wie sie beispielsweise bereits 1996 unter dem Titel „Wozu heute noch Soziologie?“ (Fritz-Vannahme 1996) geführt wurde, ergibt sich für die vorliegende Arbeit die folgende Fragestellung: Inwiefern konkurrieren Soziologie und Genforschung um eine wirksame Stellung in der Öffentlichkeit?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Genetik, Soziologie und die Öffentlichkeit
- III. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle der Genetik in der Öffentlichkeit und untersucht die Interaktion mit der Soziologie in diesem Kontext. Sie analysiert den Diskurs um die Genforschung, insbesondere die Humangenomforschung, und fragt nach der Stellung der Soziologie im öffentlichen Streit um die Chancen und Risiken der genetischen Erkenntnisse.
- Die Rolle der Genforschung in der öffentlichen Berichterstattung
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Sozial- und Naturwissenschaften auf die Humangenomforschung
- Die Frage nach der Legitimation der Soziologie im Kontext der Genforschung
- Die Bedeutung von Gen-Umwelt-Interaktionen für das Verständnis sozialen Verhaltens
- Die Rezeption und Verwendung von genetischen Metaphern in der öffentlichen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Einleitung und die zentralen Fragen der Untersuchung. Das zweite Kapitel fokussiert auf das Verhältnis von Soziologie, Öffentlichkeit und Genforschung. Es analysiert die mediale Berichterstattung über die Humangenomforschung und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Sozial- und Naturwissenschaften auf diese Thematik.
Schlüsselwörter
Genetik, Soziologie, Humangenomforschung, öffentlicher Diskurs, mediale Berichterstattung, Gen-Umwelt-Interaktion, Soziobiologie, Wissenschaftskommunikation, Legitimation der Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Warum konkurrieren Soziologie und Genforschung in der Öffentlichkeit?
Beide Disziplinen versuchen, menschliches Verhalten zu erklären – die Genetik durch biologische Anlagen und die Soziologie durch Umwelteinflüsse, was zu einem Diskurs über Deutungshoheit führt.
Was war das Ziel des Humangenomprojekts?
Das Ziel war die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms, was kurz nach der Jahrtausendwende erreicht wurde.
Wie unterscheiden sich Natur- und Sozialwissenschaftler in ihrer Haltung zur Genforschung?
Naturwissenschaftler stellen ihre Ergebnisse oft positiv dar, während Sozialwissenschaftler häufig eine kritischere Haltung gegenüber den gesellschaftlichen Risiken einnehmen.
Was bedeutet der Begriff 'Standing' im Kontext der Wissenschaftskommunikation?
Standing bezeichnet die relative Häufigkeit des Vorkommens eines Akteurs in der medialen Berichterstattung. Biologen haben hier oft ein höheres Standing als Sozialwissenschaftler.
Welche Rolle spielt die Gen-Umwelt-Interaktion?
Sie beschreibt das wechselseitige Verhältnis zwischen Erbanlagen und sozialen Einflüssen, das für ein ganzheitliches Verständnis sozialen Verhaltens essenziell ist.
- Citation du texte
- Martin Radtke (Auteur), 2018, Die Stellung der Genetik in der Öffentlichkeit und die Rolle der Soziologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498033