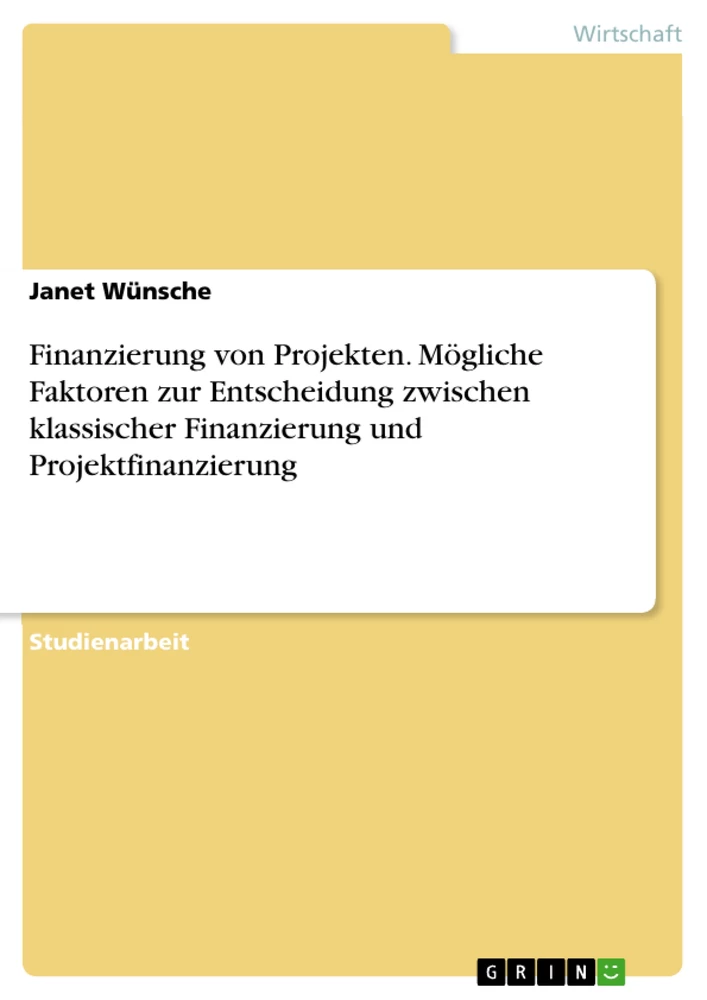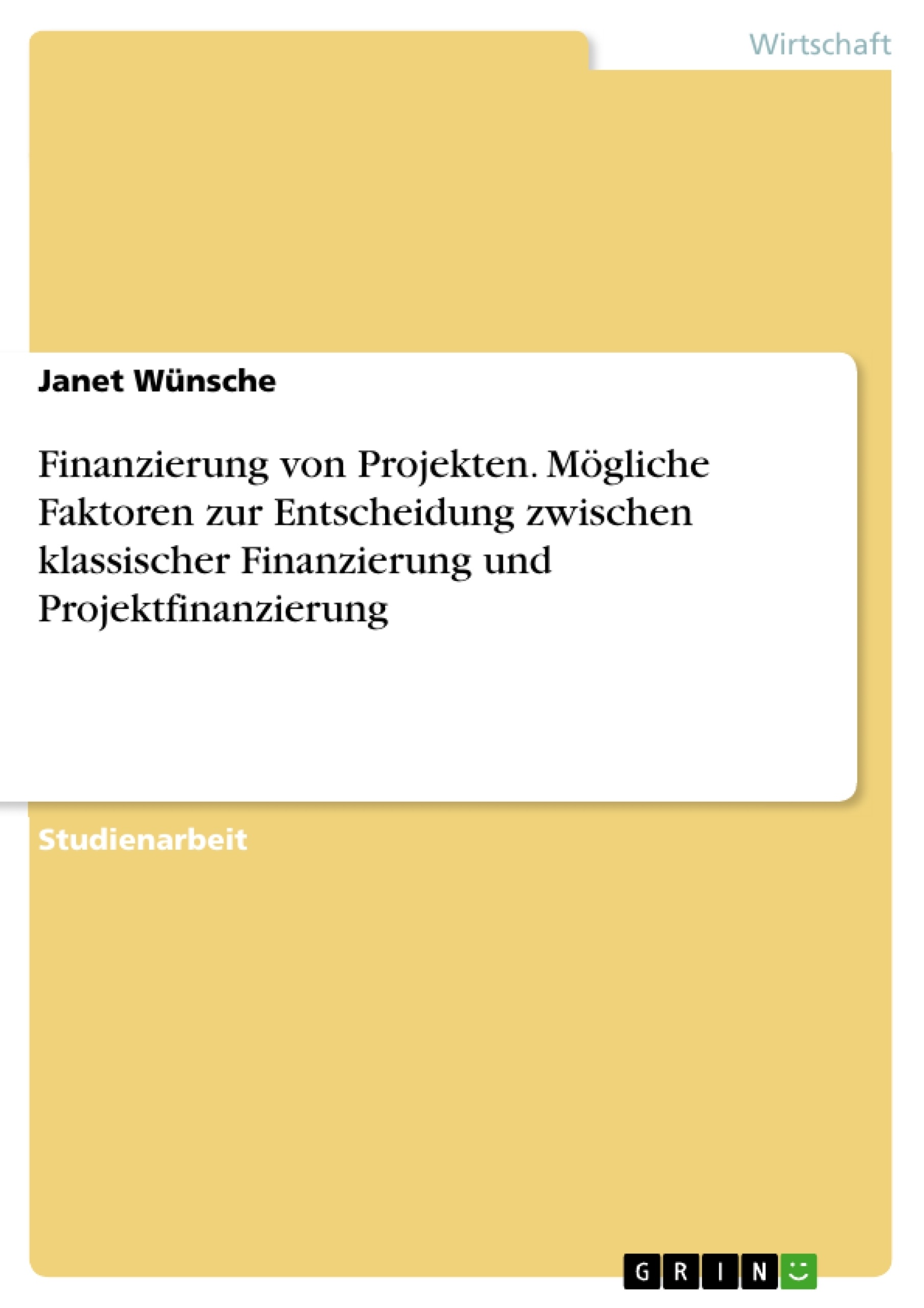Projektfinanzierungen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Plant ein Unternehmen ein neues Projekt, stellt diese Art der Finanzierung eine mögliche Alternative zur Finanzierung in der eigenen Bilanz dar. Weshalb Unternehmen eine Alternative in Betracht ziehen und welche Gründe dafür oder dagegen sprechen zeigt diese Arbeit im weiteren Verlauf.
Viele umfangreiche Projekte bringen enorme Risiken für die durchführenden Unternehmen mit sich, wie bspw. den Verlust des eingesetzten Kapitals oder gar einer Insolvenz. Nicht jedes Unternehmen kann und will die Risiken eines verhältnismäßig umfangreichen Projekts eigenverantwortlich tragen bzw. das Kapital aus dem Geschäftsbetrieb aufbringen oder das Projekt in der eigenen Bilanz ausweisen. Eine bekannte Methode zur Verteilung der Risiken stellt die Projektfinanzierung dar. Jedoch bieten sowohl die Durchführung und Finanzierung eines Projekts im eigentlichen Unternehmen (im weiteren Verlauf auch „klassische Finanzierung“ genannt), sowie eine Projektfinanzierung Vor- und Nachteile, die im Laufe der Arbeit erläutert werden. Dies wirft die Frage auf, mithilfe welcher Faktoren die Entscheidung zwischen der klassischen Finanzierung und einer Projektfinanzierung getroffen werden kann und ob sich eine der beiden Finanzierungsformen als geeigneter für Projektvorhaben herausstellt.
Zu Beginn dieser Arbeit wird im zweiten und dritten Kapitel erläutert, welche Vor- und Nachteile die klassische Finanzierung, wie auch die Projektfinanzierung aufweisen. Im vierten Kapitel werden verschiedene Faktoren und Szenarien vorgestellt, die für eine Entscheidung zwischen den beiden Finanzierungsformen (der klassischen, wie auch der Projektfinanzierung) relevant sind. Am Ende der Arbeit wird ein kurzes Fazit gezogen und die wichtigsten Erkenntnisse werden kurz zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Begriffsabgrenzung
- Aufbau der Arbeit
- Klassische Finanzierung
- Merkmale der klassischen Finanzierung
- Vor- und Nachteile klassischer Finanzierung
- Projektfinanzierung
- Merkmale der Projektfinanzierung
- Beteiligte der Projektfinanzierung
- Vor- und Nachteile der Projektfinanzierung
- Faktoren zur Entscheidungsfindung
- Art und Umfang des Projekts
- Aufstellung und finanzielle Lage der Unternehmung
- Risikomanagement und Haftung
- Kapitalaufbringung und ROI
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Finanzierung von Projekten und untersucht die verschiedenen Faktoren, die bei der Entscheidung zwischen klassischer Finanzierung und Projektfinanzierung eine Rolle spielen. Die Arbeit beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Finanzierungsformen und stellt verschiedene Szenarien vor, die für die Auswahl der geeigneten Finanzierungsstrategie relevant sind.
- Unterscheidung der Finanzierungsmöglichkeiten im Kontext von Projekten (klassische Finanzierung vs. Projektfinanzierung)
- Analyse der Vor- und Nachteile beider Finanzierungsformen
- Identifizierung relevanter Entscheidungskriterien für die Wahl der Finanzierungsstrategie
- Bewertung der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen
- Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Einleitung, der Problemstellung und der Begriffsabgrenzung. Dabei wird der Fokus auf die Definition von Projekten und ihre Bedeutung in Unternehmen gelegt. Im zweiten Kapitel werden die Merkmale der klassischen Finanzierung sowie ihre Vor- und Nachteile näher betrachtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Projektfinanzierung, wobei die Merkmale, Beteiligten und Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsform im Detail beleuchtet werden. Das vierte Kapitel analysiert verschiedene Faktoren, die für die Entscheidungsfindung zwischen klassischer Finanzierung und Projektfinanzierung relevant sind, wie zum Beispiel Art und Umfang des Projekts, die finanzielle Lage des Unternehmens, das Risikomanagement und die Kapitalaufbringung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Schlüsselbegriffen der Projektfinanzierung, wie z.B. klassische Finanzierung, Projektfinanzierung, Risikomanagement, Kapitalaufbringung, ROI und Entscheidungsfindung. Sie analysiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsformen und beleuchtet die wichtigsten Faktoren, die bei der Wahl der geeigneten Strategie eine Rolle spielen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen klassischer Finanzierung und Projektfinanzierung?
Bei der klassischen Finanzierung haftet das Unternehmen mit seiner gesamten Bilanz. Bei der Projektfinanzierung basiert die Rückzahlung primär auf dem Cashflow des Projekts selbst (Off-Balance-Sheet).
Wann lohnt sich eine Projektfinanzierung für ein Unternehmen?
Sie lohnt sich besonders bei sehr umfangreichen, riskanten Projekten, die die Kapazität der Unternehmensbilanz übersteigen würden oder bei denen Risiken auf mehrere Partner verteilt werden sollen.
Welche Vorteile bietet die klassische Finanzierung?
Die klassische Finanzierung ist meist kostengünstiger in der Abwicklung, erfordert weniger komplexe Verträge und bietet dem Unternehmen die volle Kontrolle über das Projekt.
Welche Rolle spielt das Risikomanagement bei der Projektfinanzierung?
Das Risikomanagement ist essenziell, da Risiken identifiziert und vertraglich zwischen den Beteiligten (Banken, Sponsoren, Zulieferern) aufgeteilt werden müssen.
Was bedeutet ROI im Zusammenhang mit der Finanzierungswahl?
Der Return on Investment (ROI) hilft zu beurteilen, ob die höheren Kosten einer Projektfinanzierung durch die Risikoentlastung und die erzielten Gewinne gerechtfertigt sind.
- Quote paper
- Janet Wünsche (Author), 2019, Finanzierung von Projekten. Mögliche Faktoren zur Entscheidung zwischen klassischer Finanzierung und Projektfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498190