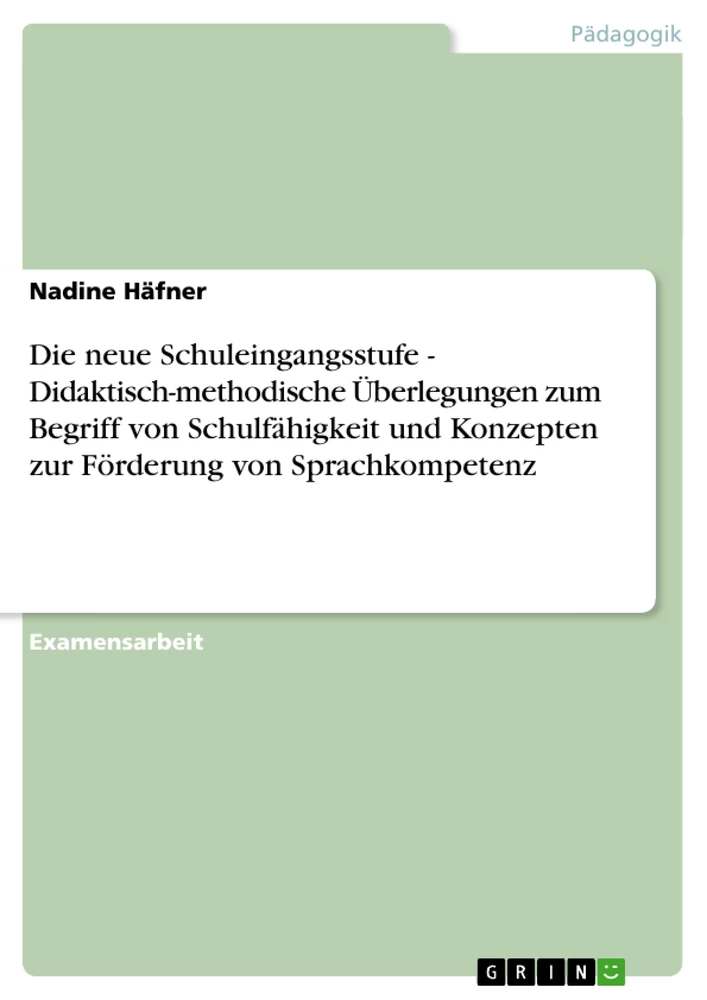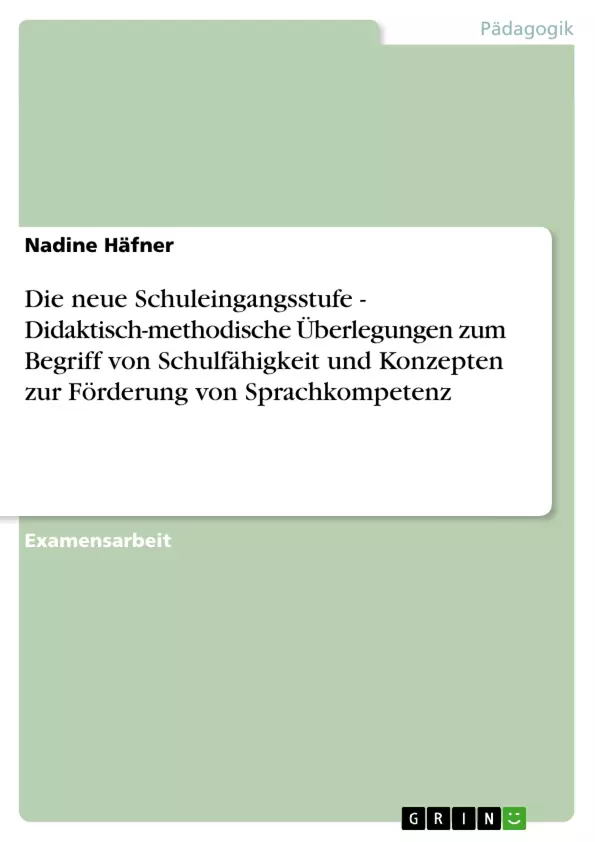Seit Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahre 2000 steht das Thema „Bil-dung“ (endlich ?) wieder einmal im Zentrum öffentlichen Interesses.
Die Ursachensuche für das schlechte Abschneiden 15-jähriger deutscher Schüler2 unter anderen in den Bereichen Lesefertigkeit und Textverständnis beschäftigt sowohl Politiker als auch Fach- und Wissenschaftsexperten sowie Eltern und Schüler.
Seither vergeht kaum eine Woche ohne Veröffentlichungen in Printmedien, Hörfunk und Fernsehen.
Das Ergebnis der nun veröffentlichten, zweiten PISA Studie belegt darüber hinaus, dass nur in wenigen anderen Staaten der Welt die Leistungen der 15-Jährigen so stark an die soziale Herkunft gekoppelt sind wie hier zu Lande.
Dazu meint die FAZ vom 06.11.05: „Was passiert, wenn ein Drittel einer Altersgruppe nicht in der Lage ist, vernünftig Zeitung zu lesen? Was bedeutet das für das politische Bewusstsein?“
Im Leitartikel der FAZ vom 31.10.05meint Heike Schmoll:
„Melanchthons Empfehlung sich beim Lernstoff vom Besten das Beste auszuwählen, und zwar, ´was zur Kenntnis der Natur und zur Bildung des Charakters beiträgt´, wäre modernen Bildungstheoretikern zu wünschen. Lehrpläne sähen dann anders aus, Diskussionen über einen Bildungskanon erledigten sich von selbst. … Melanchthon wuss-te, dass Sprache und Denken, Wort und Erkenntnis untrennbar miteinander verknüpft sind. Seine eigene Sprache zu finden ist deshalb nicht zufällig mit der Selbstwerdung und Mündigkeit verbunden. Deshalb gehören Sprach- und Stilschulung zu seinen Hauptanliegen, weil sie der Charakterbildung dienten. … Jeder sollte die Möglichkeit haben, selbst zu lesen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Grundlegend für die Befreiung aus jeglicher Unmündlichkeit ist darum die Lesefähigkeit.“
Die KMK-Vizepräsidentin Doris Ahnen (SPD) folgert darüber hinaus in der Frankfurter Rundschau, „für die Minister sei ´völlig klar´, dass die Leistung an den Schulen deutlich verbessert und mehr Chancengleichheit erreicht werden müsse. … Schwächere Schüler müssten früher gefördert werden. Entscheidend für den Schulerfolg für Migrantenkinder sei zudem, dass diese die deutsche Sprach frühzeitig erlernen.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungsaufgabe Schulanfang
- Der Schuleintritt – eine Herausforderung
- Vom Schulreifebegriff zur Entwicklung von Schulfähigkeit
- Subjektive Theorien
- Schuleingangsdiagnostik
- Entwicklungstendenzen
- Das Kieler Einschulungsverfahren
- Informelle Verfahren
- Die neue Schuleingangsstufe
- Die Sprachstandserhebung - eine gesetzliche Neuregelung
- Sprach- und Lesekompetenz
- Sprachkompetenz
- Lesekompetenz und Schriftsprache
- Phonologische Bewusstheit
- Die internationale Grundschulleseuntersuchung (IGLU)
- Fördermaßnahmen zur Entwicklung der gesprochenen Sprache
- Das kanadische Sprachentwicklungskonzept „Learning Language and Loving it”
- ,,Vorlaufkurse\" in Deutschland / Hessen
- Sprachförderung in der Vorklasse
- Von der gesprochenen Sprache zur Schriftsprache
- Lesekonzepte im Anfangsunterricht
- Der klassische Fibellehrgang in der Diskussion
- Das Modell Reichen - eine Alternative?
- ,,Stimmen aus der Praxis”
- Protokoll einer Sprachstandserhebung
- Vorüberlegungen zu einem Leitfadeninterview:
- Kriterien der Auswahl einer Interviewpartnerin
- Interview im Wortlaut:
- Gedanken zum Interview
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Übergangsproblematik Kindergarten - Grundschule und der Frage nach gezielten Fördermöglichkeiten zur Sprachentwicklung im frühen Kindesalter. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Konzepts der neuen Schuleingangsstufe nach Dr. Karlheinz Burk und der Lehr- und Lernmethodik „Lesen durch Schreiben“ nach Dr. Jürgen Reichen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit, Effizienz und Auswirkung auf die Sprachentwicklung von Kindern im Übergang vom Vorschulischen zum Schulischen Arbeiten. Die Arbeit beleuchtet den Begriff „Schulfähigkeit“ in seiner Entwicklung und untersucht diagnostische Möglichkeiten als Voraussetzung für erfolgreiche Fördermaßnahmen.
- Die Entwicklung des Begriffs "Schulfähigkeit" und die Bedeutung von Sprachkompetenz im Kontext der neuen Schuleingangsstufe
- Die Analyse und Evaluation der Konzepte der neuen Schuleingangsstufe und des "Lesen durch Schreiben"-Modells
- Die Rolle von Sprachstandserhebungen und diagnostischen Verfahren in der frühzeitigen Förderung von Sprachkompetenz
- Die Herausforderungen der Sprachförderung für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
- Die Relevanz von praktischer Erfahrung und „Stimmen aus der Praxis“ für die Weiterentwicklung der Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die aktuelle Debatte um Bildung in Deutschland im Kontext der PISA-Studien und betont die Bedeutung von Sprach- und Lesekompetenz für den Schulerfolg. Kapitel 2 beleuchtet den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule als eine Entwicklungsaufgabe und analysiert den Begriff "Schulfähigkeit" sowie verschiedene Ansätze der Schuleingangsdiagnostik. Kapitel 3 widmet sich der neuen Schuleingangsstufe und der gesetzlichen Neuregelung zur Sprachstandserhebung. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Sprach- und Lesekompetenz, wobei die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb hervorgehoben wird. Kapitel 5 beschreibt verschiedene Fördermaßnahmen zur Entwicklung der gesprochenen Sprache, darunter das kanadische Sprachentwicklungskonzept „Learning Language and Loving it“, Vorlaufkurse in Deutschland und Hessen, sowie Sprachförderung in der Vorklasse.
Schlüsselwörter
Schulfähigkeit, Schuleingangsstufe, Sprachkompetenz, Lesekompetenz, Sprachstandserhebung, Sprachförderung, Lesen durch Schreiben, Kindergarten-Grundschule-Übergang, PISA-Studien, Didaktik, Methodik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die 'neue Schuleingangsstufe'?
Die neue Schuleingangsstufe ist ein pädagogisches Konzept zur flexiblen Gestaltung des Schulanfangs, das besonders die individuelle Sprachentwicklung und Schulfähigkeit fördert.
Was versteht man unter dem Modell 'Lesen durch Schreiben'?
Dieses von Dr. Jürgen Reichen entwickelte Modell ermöglicht Kindern den Schriftspracherwerb durch eigenständiges Schreiben von Wörtern mithilfe einer Anlauttabelle.
Wie hat sich der Begriff 'Schulfähigkeit' gewandelt?
Der Fokus verschob sich von einer rein biologischen „Schulreife“ hin zu einer entwicklungspsychologisch orientierten „Schulfähigkeit“, die auch das soziale Umfeld einbezieht.
Warum sind Sprachstandserhebungen vor der Einschulung wichtig?
Sie dienen dazu, Förderbedarf – insbesondere bei Migrantenkindern – frühzeitig zu erkennen, um einen erfolgreichen Schulstart zu ermöglichen.
Was ist 'phonologische Bewusstheit'?
Es ist die Fähigkeit, die lautliche Struktur der Sprache zu erkennen (z. B. Reime, Silben), was eine grundlegende Voraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen ist.
Welchen Einfluss hatten die PISA-Studien auf die Grundschuldidaktik?
Die PISA-Ergebnisse verdeutlichten die starke Kopplung von Schulerfolg und sozialer Herkunft, was zu verstärkten Bemühungen um Chancengleichheit und frühe Sprachförderung führte.
- Arbeit zitieren
- Nadine Häfner (Autor:in), 2005, Die neue Schuleingangsstufe - Didaktisch-methodische Überlegungen zum Begriff von Schulfähigkeit und Konzepten zur Förderung von Sprachkompetenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49859